I
Benjamin ist auf dem Weg zur Galerie. Frisch gewaschenes Haar, Wintermantel, schwarze Jeans und dazu passende Lederschuhe. An der Ecke biegt er in die Straße ein: Gelächter, das Klirren von Sektgläsern, Zigarettenrauch weht ihm entgegen. Die Gäste stehen in ihren Mänteln, königsblau und creme, unter der Leuchtschrift der Galerie. Vorteilhaftes Licht, denkt er.
Er geht auf die Gruppe zu, in der er Stephan stehen sieht. Gratulation, sagt Benjamin zu ihm und meint es fast so.
Stephan klopft ihm auf die Schulter. Na endlich, sagt er, ich dachte schon, du kneifst.
Bevor er antworten kann, hat sich Stephans Frau Katharina dicht neben ihn gestellt. Ich bin so gespannt auf deine Laudatio, sagt sie und stößt ihm den Ellenbogen in die Seite. Wieder so ein Appell an den Betrieb?
Benjamin lächelt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Für solche rebellischen Sachen bin ich zu alt.
Stephan lacht laut auf. Du bist fünfzig, du bist nicht alt. Fünfzig ist das neue dreißig.
Er versteht, dass Stephan an diese Dinge glaubt.
Eine junge Frau tritt aus der Galerie, sie balanciert ein Tablett mit Sektgläsern, hält es dezent in seine Richtung, ohne ihn anzusehen. Pflichtpraktikum, wahrscheinlich Kulturwissenschaften, von ihnen sieht er viele. Dankend lehnt er ab.
Dann ist sechzig also auch das neue vierzig?, will Katharina wissen und zwinkert ihrem Mann zu, aber Stephan ist bereits von Frauke, der Galeristin, abgelenkt.
Jetzt, wo der Herr Professor da ist, kann es ja losgehen. Die Nachbar*innen hier …, Frauke verdreht die Augen. Nach zehn Uhr darfst du nicht mal mit dem Schlüssel klimpern. Sie wendet sich ab, ruft: Husch, husch, zur Kunst, und Benjamin möchte im Boden versinken. An der Tür lässt er Stephan und Katharina den Vortritt, sieht das Plakat für Stephans Ausstellung. Es leuchtet schweinchenrosa und blutfarben im Fenster wie die Auslage einer Fleischerei. Der Titel in weißen Buchstaben darüber: Berührung und andere wesentliche Bedürfnisse.
Malen soll man nur, was man berührt hat, ist sein erster Satz. Katharina bekommt eine Gänsehaut. Zum einen wegen der Kälte (Frauke ist geizig und heizt kaum). Zum anderen ist Benjamin ein überraschend guter Redner, obwohl er normalerweise entweder gar nichts sagt oder alles ironisch meint. Er fährt fort, über die verschiedenen Arten von Berührung zu sprechen, die physische und die metaphysische, die materielle und die immaterielle. Er sagt, man müsse sich von der Welt berühren lassen, nah herantreten. Katharina schaut auf Stephan, der vor dem Fenster steht und an seinem Sekt nippt. Seit Jahren schon hat er nur noch das berührt, was sich für ihn lohnt (siehe Frauke). Es macht ihr nichts mehr aus, zu wissen, dass er mit Galeristinnen und Praktikanten, mit Fotografen und Journalistinnen schläft, wahrscheinlich hat er auch mit Benjamin geschlafen für dessen Laudatio. Sie lächelt in sich hinein, stellt sich vor, wie Stephan nackt auf dem Bauch liegt, Benjamin küsst seinen Hintern. Sie würde es ihm beinahe gönnen, von Anfang an hat sie Benjamins unglückliches Liebesleben mitverfolgt. Wann immer es um das Thema geht, sagt Stephan, Benjamin habe unrealistische Ansprüche. Katharina ärgert sich hin und wieder, dass sie wegen der Sache damals nicht noch mehr mit Benjamin geflirtet hat. Selbst jetzt, wenn sie es versucht, begreift er es nicht (oder will es nicht begreifen). Schade, dass Beziehungen immer so festgelegt sein müssen. Einmal ein Freund, immer nur Freund. Einmal die Ehefrau des Künstlers, nie etwas anderes als die Ehefrau des Künstlers. Einmal die Mutter von Zwillingen, immer Mutter von Zwillingen. Manchmal würde sie gern wieder achtzehn sein und alles, worauf sie sich irgendwann einmal festgelegt hat, offenlassen. Sexualität, Beruf, Wohnort, Partner, Kinder. Wer wäre sie dann? Wäre sie überhaupt jemand? Sie kann nicht verstehen, dass Leute an ihrer Identität festhalten, ja sie sogar aufbauen und stärken wollen, wenn es doch das Beste wäre, sie an den Nagel zu hängen. Laut würde sie das niemals sagen, vor allem nicht vor Frauke, die in Wahrheit nicht mit Kunst, sondern mit Identitäten ihr Geld macht. Dass sie die Einzelausstellung eines alten weißen Malers in ihrer Galerie duldet, kann nur eins bedeuten. Katharina atmet schwer aus und denkt an ihren Qi-Gong-Lehrer, loslassen und entspannen, loslassen und entspannen.
Benjamin spricht jetzt davon, dass Stephans Arbeiten die Angstlosigkeit des Künstlers zeigen, selbst die schwersten Umstände der menschlichen Existenz nicht unberührt zu lassen (die Stephan selbst natürlich nie erlebt hat).
– Themen, die die aufmerksame Beobachterin erahnen kann.
Katharina freut sich über diesen schön gegenderten Seitenhieb. Benjamin weiß natürlich genau, dass es so etwas wie aufmerksame Beobachterinnen auf Vernissagen nicht gibt. Alle sind wegen des Sekts gekommen oder wegen der Kontakte. Sie verlagert ihr Gewicht von einem Bein aufs andere, räuspert sich leise, hört wieder hin.
– wie wir in Berührung zu uns selbst stehen, zum anderen, zur vermeintlichen Wirklichkeit. Wie können wir uns selbst berühren? Berührt werden?
Eine perfekte Pause. Katharina würde wetten, dass in diesen zwei Sekunden alle, ausnahmslose alle, an Sex denken.
– Was passiert, wenn Berührung ausbleibt? Stephan Pragers Bilder erinnern uns an die heute mehr denn je entscheidende Frage: Welche Spuren wollen wir hinterlassen, auf unseren Körpern, den Körpern der anderen, in der Welt?
Es herrscht Stille, dann nickt Benjamin abschließend, und alle klatschen. Stephan geht nach vorn, umarmt seinen Freund und klopft ihm dabei kräftig auf den Rücken. Blitzlicht hier und da, dann tritt Benjamin zur Seite, während Stephan strahlend den Fotografen und dann Frauke zunickt, das Sektglas hebt. Katharina geht auf Benjamin zu, beugt sich zu ihm und sagt leise: Du kannst es nicht lassen, wieder ein Appell. Aber ein schöner. Benjamin schaut sie abwesend an und entschuldigt sich. Er müsse zur Toilette.
Eine Weile schließt er sich im Badezimmer ein, schaut in den Spiegel, streicht das Haar hinter die Ohren, bald vollkommen grau. Heute sieht er besonders müde aus, die Falten liegen tief. Tränenflüssigkeit sammelt sich unerwartet in seinen Augen. Die Leute draußen erscheinen ihm weit entfernt, selbst das Gesicht im Spiegel kommt ihm beliebig vor. Er wischt sich über die Lider. Wie armselig. Da predigt er über Berührung und Nähe, die Bedeutung von Gemeinschaft und Beteiligung, dabei ist er derjenige, der einsam im Badezimmer steht und sentimentalen Gedanken nachhängt. Dreißig Jahre sind vergangen, seitdem Stephan zum ersten Mal zu ihm gesagt hat: Malen sollte man nur, was man berührt hat. Es war in Stephans Wohnung auf einer seiner ständigen Feiern während Benjamins erstem Semester. Stephan war die meiste Zeit betrunken, das ist er heute auch.
Benjamin atmet schwer aus und wirft die Papiertücher in den Mülleimer. Ein letzter Blick in den Spiegel, dann öffnet er mit einem leichten Kopfschütteln die Tür.
Stephan ist immer noch von Leuten umringt und beachtet ihn nicht. Draußen vor der Fensterfront unterhalten sich Katharina und Frauke, beide rauchen. Benjamin stellt sich dazu, und wieder hält ihm die Praktikantin das Tablett hin. Dieses Mal lächelt sie ihn an, fragt: Einen Sekt, Professor Leiser, und er nimmt ein Glas. Dabei bemerkt er, dass sie in der Januarkälte leicht zittert.
Frauke, fragt er, was versprichst du eigentlich deinen Mitarbeiterinnen für unbezahlte Arbeit an Samstagabenden?
Katharina kichert. Attacke, sagt sie.
Wer sagt, dass es unbezahlte Arbeit ist, antwortet Frauke. Einblicke in die Cultural Industries, Förderung von Management- und Social-Media-Skills. Ich würde das nicht unbezahlt nennen. Sie zieht an ihrer Zigarette und bläst den Rauch hinauf, er wabert um die Leuchtschrift der Galerie. Das rote Licht, das auf Fraukes Kurzhaarfrisur fällt, lässt sie teuflisch aussehen.
Nennen wir es Sektausschenken, sagt er, für den Werdegang.
Die Mundwinkel der Praktikantin zucken. Dann erschrickt sie. Jemand hat ihr eine Hand auf den Rücken gelegt und sagt: Da bist du, hab dich gesucht. Sie tritt ein Stück zur Seite und gibt die Sicht auf einen Mann frei, den sie als ihren Freund vorstellt. Konstantin Mai.
Der junge Mann grüßt, sein Blick fällt auf Benjamin, der ihm direkt gegenübersteht. Auch Benjamin erschrickt. Er fühlt ein Kribbeln im Nacken, das ihm die Wirbelsäule hinunterrinnt, in die Beine fährt, die ihm plötzlich unangenehm bewusst sind: wie er dasteht, so ungelenk, und Konstantin anstarrt, seine Augen nicht braun, nicht grün, ein Fastgelb mit kleinen dunklen Punkten darin. Er schaut Benjamin noch für einen Moment an, bevor er sich Frauke zuwendet. Die sagt: Ach, hallo, schön, dass wir uns kennenlernen. Jorinde hat so viel von dir erzählt. Du studierst auch Kunst?
Benjamins Blick klebt immer noch an Konstantin, der nickt und sieht dabei aus, als könnte er nicht glauben, dass man viel über ihn geredet haben soll.
Wir sprechen gerade über Werdegänge, erklärt Jorinde. Lebensläufe und wie man sie poliert.
Benjamin räuspert sich. Mit Sekt zum Beispiel, sagt er und trinkt sein Glas leer.
Jorinde lächelt. Haben Sie sich das eigentlich ausgedacht? Das mit dem Nur malen, was man berührt hat?
Benjamin überlegt, ob er einen Witz machen soll, aber ihm fällt keiner ein. Also antwortet er: Der Satz stammt ursprünglich von meinem Vater. Er hat in einem Fischereibetrieb gearbeitet und immer gesagt, man solle besser nur töten, was man angefasst habe. Das mache es schwerer. Stephan hat den Satz vor vielen Jahren auf die Kunst umgemünzt.
Und? Macht es das? Schwerer, meine ich, fragt Konstantin, der auf Benjamins leeres Sektglas schaut.
Das müssten Sie meinen Vater fragen.
Ich wusste gar nicht, dass dein Vater in einer Fischerei gearbeitet hat, sagt Katharina, als hätte sie etwas Wichtiges verpasst.
Benjamin wechselt das Thema: Und Sie studieren Malerei?
Konstantin Mai schaut auf. Medienkunst, zweites Semester.
Das erstaunt ihn. Der junge Mann wirkt nicht wie jemand aus dem zweiten Semester. Er muss über dreißig sein. Wenn fünfzig das neue dreißig ist, ist dreißig vielleicht auch das neue zehn, denkt Benjamin, aber er merkt, dass das keinen Sinn ergibt.
Ich geh mal den Sekt auffüllen, sagt Jorinde, und Konstantin antwortet schnell: Ich komm mit.
Hastig nimmt sich Benjamin ein neues Glas vom Tablett, bevor Jorinde mit ihrem Freund verschwindet. Er trinkt es in einem Zug aus, denkt, nein, es ist albern. Manch einer hat fastgelbe Augen und sieht jemandem ähnlich. Er fängt an, Gespenster zu sehen, weil er nach der Rede an früher hat denken müssen. Er strafft die Schultern und hört Katharina sagen: Knuffiges Paar, die beiden.
Jorinde ist eine echte Bereicherung, antwortet Frauke, so zuverlässig. Ich meine, ich brauche schlicht und einfach keine Leute, die Freitagabend 19 Uhr zum Yoga müssen. So hält man Kultur nicht am Laufen. Sie schaut Benjamin von der Seite an. Manche Menschen haben eben Spaß an ihrer Arbeit. Trotz angeblicher Unterbezahlung. Das Wort Spaß betont sie, als hätte sie ihre Zweifel, dass er weiß, was es bedeutet.
Er überlegt, ob er sich wieder mit Frauke anlegen soll. Stattdessen geht er zurück in die Galerie. Stephan kommt von der Toilette und reibt sich die Hände an der Hose ab. Danke für die warmen Worte, Benji, sagt er und grinst.
Ich hoffe, du hast die Anspielung verstanden.
Falls du mein Gebot von früher meinst: Na klar.
Benjamin grinst zurück. Damals hattest du wenigstens noch Prinzipien.
Die habe ich auch heute noch, bloß heißen sie jetzt anders: Nur malen, was Geld bringt, zum Beispiel. Stephan breitet die Arme aus. Und siehe da.
Wenigstens einer von uns hat erreicht, was er wollte.
Jetzt schau nicht so deprimiert, Benji-Biene. Lass uns lieber noch was trinken.
Stephan legt ihm den Arm um die Schultern und schüttelt ihn. Ein Teil von Benjamin mag es, Biene genannt und geschüttelt zu werden. Niemand anderes als Stephan würde das wagen. Dafür liebt er ihn. Dem anderen Teil ist das alles schrecklich unangenehm.
Nach dem vierten Sekt tritt Benjamin vor die Tür und bittet Katharina um eine Zigarette. Du rauchst doch nicht mehr, sagt sie und gibt ihm Feuer, hält dabei die Hände ganz nah an sein Gesicht. Bevor sie ihn in ein Gespräch verwickeln kann, zieht er das Handy aus der Tasche und runzelt die Stirn, als hätte er eine wichtige Nachricht bekommen. Tatsächlich hat seine Mutter zwei Mal versucht, ihn zu erreichen.
Ich muss kurz, sagt er und winkt mit dem Telefon.
An der Straßenecke öffnet er den Browser, tippt ein: Konstantin Mai. Er ist sich bewusst, dass er größere Beherrschung an den Tag legen sollte. Es ist der Alkohol. Neben ihm, unter dem Schild an der Ecke, liegt eins der ersten Weihnachtsopfer des neuen Jahres. Ein toter Baum, Splitter einer Christbaumkugel glitzern zwischen den Gehwegplatten. Er schaut zurück aufs Telefon. Wahrscheinlich gibt es diesen Namen so häufig wie Fische im Meer, aber trotzdem. Das erste Ergebnis ist die Webseite eines Komikers, geboren 1988, das kann er nicht sein. Danach folgen Einträge von Branchenseiten: Konstantin Mai, Head of Analytics; Konstantin Mai, Sales Manager; dann das Profil eines Mitarbeiters des Opernhauses: Konstantin Mai, Flötist.
Er steckt das Telefon zurück in die Manteltasche, beobachtet, wie sich jemand bei Frauke verabschiedet. Selbst aus der Entfernung hört er Stephans Lachen. Einen Augenblick steht Benjamin da, zieht noch einmal an der Zigarette, bevor er sie auf den Boden wirft. Sie landet neben dem Weihnachtsbaum. Der ist recht klein, vielleicht einen Meter lang. Er beugt sich über ihn, betrachtet die bräunlichen Nadeln. Dann, ruckartig, als müsste er sich losreißen, geht er, ohne sich zu verabschieden, in Richtung U-Bahn-Haltestelle davon.
Am Sonntagmorgen schlägt Benjamin um 11:27 Uhr die Augen auf. Er liegt da, lauscht den Autos, die über das Kopfsteinpflaster fahren, unter dem Fenster bellt ein Hund, jemand brüllt: Ey, weg da! Seine Wohnung wird einzig von einem Kachelofen beheizt, und weil das Feuer heruntergebrannt ist, herrscht Eiseskälte im Zimmer. Die Wohnung ist in all den Jahren nie renoviert worden. Er hat einen dieser selten gewordenen Vermieter, der alle in Frieden lässt. Die Wände haben nie eine Raufasertapete gesehen, die Dielen kein Schleifgerät. Es fällt ihm schwer, aufzustehen, bei 15 Grad. Wie jeden Winter denkt er über einen Umzug nach, aber wenn etwas in seinem Leben einem eigenen Kind am nächsten kommt, dann diese Wohnung.
Das Schlafzimmer ist sparsam eingerichtet, wie auch der Rest der 65 Quadratmeter: ein Kleiderschrank in der Ecke, eine Kommode neben der Tür und das Massivholzbett, in dem er liegt. Darüber, genau in der Mitte, hängt das einzig Dekorative in diesem Raum, ein Plakat aus der Hamburger Kunsthalle. Ein Bild von Gerhard Richter: Brücke (am Meer), von 1969, Benjamins Zeugungsjahr, handsigniert.
Unter dem melancholischen Bild dreht er sich schwerfällig um, als würde ihm etwas wehtun. Er schlüpft in die Hausschuhe, greift nach dem anthrazitfarbenen Bademantel. Ein Schauer breitet sich auf seinen Armen und Beinen aus, als der kalte Stoff die Haut berührt. Er geht zum Ofen, hockt sich davor. Mit einer Sprühflasche befeuchtet er die Luft, um die Rußpartikel zu binden, die er mit der Bürste aufwirbelt. Er greift nach Holzscheiten und Anzündholz, stapelt es, wie er es seit drei Jahrzehnten stapelt. In die Spalte legt er Anzünder und hält das Feuerzeug daran. Sofort schießen die Flammen auf. Er beobachtet, wie das Feuer am Holz leckt, lauscht dem Knistern, wärmt sein Gesicht, dann vibriert das Telefon auf dem Nachttisch. Er steht auf, legt sich zurück ins Bett und liest: Stephan sagt, er hat den Kater des Jahres (und es ist erst Januar!). Musste ihn nach Hause schleppen. Du wurdest sehnlichst vermisst. Benjamin legt das Telefon weg. Er kann mit solchen Nachrichten wenig anfangen. Soll er darin einen Vorwurf lesen oder Zärtlichkeit? Es ist ihm nicht entgangen, dass Katharina gestern wieder versucht hat, ihn mit zweideutigen Bemerkungen in Verlegenheit zu bringen. Vielleicht braucht sie eine Herausforderung, vielleicht reizt sie das Drama – der beste Freund des Ehemannes und so weiter. Benjamin ist nie darauf eingegangen, Katharina ist nicht sein Typ. Sie findet alle nett oder schauspielert überzeugend. Immerhin ist sie Lehrerin, wahrscheinlich gehört das zum Berufsbild, vor den Kindern zu stehen und gut gelaunt zu sein, egal, wie lästig sie tatsächlich sind. Vielleicht trinkt sie deshalb mit Stephans Affäre Sekt, als könnte nichts sie stören, als hätte sie alles im Griff. Er ist sich sicher, dass es ihr bei diesen Annäherungsversuchen nicht um ihn geht. Sie meint ihn nicht wirklich. Stephan würde sagen, Benjamin habe zu hohe Ansprüche. Uli hätte gesagt, er interpretiere zu viel rein. Er würde sagen, das sei doch das Mindeste.
Er nimmt das Telefon wieder vom Nachttisch und antwortet: Mein Beileid zum Kater. Fünfzig ist wohl doch nicht das neue dreißig. Irgendwie beruhigend.
Sein Daumen verharrt über dem Display. Er hebt den Kopf, blickt in die Zimmerecke, dann zur Tür, als würde er jemanden erwarten. Er schaut zurück aufs Telefon, löscht Irgendwie beruhigend und schickt die Nachricht ab.
Die Frau hinter dem Tresen ist neu. Sie fragt, was er will, dabei nimmt er immer dasselbe und muss es normalerweise nicht sagen, weil Jeremia weiß, was er will. Aber der arbeitet sonntags nicht, das einzig Richtige, findet Benjamin. Trotzdem schade.
Aeropress, sagt er.
Welche Bohne, fragt die Neue und hält zwei Tüten in die Höhe.
Er seufzt in sich hinein. Die Kolumbianische.
Sie nickt und dreht sich um, wiegt die korrekte Menge Kaffeebohnen ab. Er beobachtet ihre Handbewegungen, wie sie die Tüte aufnestelt, die Bohnen in einen silbernen Becher schüttet, der auf einer Küchenwaage steht. Jeremia hält seine Nase immer dicht an die Tütenöffnung und atmet tief ein. Seine Mimik spricht von der Liebe für das, was er tut. Jeremia zeigt sich Benjamin gegenüber jedes Mal dankbar, dass er einen Aeropress-Kaffee bestellt, den er, Jeremia, zubereiten darf. Nicht irgendeinen Hafermilch-Latte. Dass diese Liebe der Neuen abgeht, ist offensichtlich. Gleichzeitig ist Benjamin natürlich bewusst, dass Lohnarbeit ein Fluch ist, den man niemals lieben darf. Er weiß auch, dass es verwerflich ist, sich in einem Café, in dem der kleine Cappuccino 3,50 Euro kostet, zu den Stammkund*innen zu zählen. Oder überhaupt Kaffee zu trinken, der auf Plantagen am anderen Ende der Welt zum Trocknen in der Klimawandeldürre ausliegt oder in einem endlosen, ressourcenverschwendenden Prozess von seinem Fruchtfleisch rein gewaschen wird.
Die Neue arrangiert die Aeropress auf der Waage, dreht sich zur Mühle, kippt die Bohnen hinein. Über das laute Mahlgeräusch hinweg sagt sie: 4,70 Euro macht das dann.
Benjamin bezahlt sonst erst, wenn er den Kaffee entgegengenommen hat. Schweigend hält er die Bankkarte hoch und fügt ein bemühtes Lächeln hinzu.
Die Frau tippt etwas in die Kasse, deutet auf das Kartenlesegerät und wendet sich wieder der Aeropress zu. Das Gerät fragt, ob er 10, 15, 20 oder 30 Prozent Trinkgeld geben will. Er tippt auf die 10, im nächsten Moment bereut er es.
Hier, bitte schön, sagt die Neue und reicht ihm Kanne und Tasse auf einem silbernen Tablett.
Vielen Dank, sagt er und geht auf seinen Fensterplatz im hinteren Teil des Ladens zu.
Er schenkt sich einen Schluck Kaffee ein, bewegt die Tasse kreisend in der rechten Hand und atmet den Dampf ein. Na ja, denkt er und trinkt. Er holt das Telefon aus der Manteltasche und öffnet, ohne darüber nachzudenken, den Browser. Er schaut auf die zuletzt besuchte Webseite, dann erinnert er sich an Konstantin Mai und seine von Sekt und Sentimentalität provozierte Schwäche, den armen Medienkünstler durch eine Suchmaschine zu jagen. So etwas Albernes. Das Telefon klingelt in seiner Hand, er erschrickt. Es könnte wieder seine Mutter sein. Aber auf dem Display steht Sibylla Melani.
Sibylla, sagt er, und seine Stimme klingt weich.
Hey, Benjamin.
Ich hoffe nicht, dass du dich meldest, um für heute Abend abzusagen.
Im Gegenteil.
Er lächelt, als er sie das sagen hört.
Ich wollte dir vorschlagen, ins Theater zu gehen. Ich habe was gefunden, dachte, das wäre was für dich.
Was denn?
Warten auf Godot.
Er lacht. Weil ich vergeblich auf jemanden warte?
Sibylla lacht auch. Ich dachte, du merkst es nicht.
Was?
Mein pädagogisches Motiv.
Inwiefern hältst du es für pädagogisch wertvoll, mich zu Warten auf Godot einzuladen?
Ach, jetzt lade ich dich also ein? Nice move.
Für einen Moment genießt er Sibyllas Spitzfindigkeit.
Also, gehen wir?
Wie könnte ich ablehnen, Sibylla?
Brav. Ich schick dir die Infos. Bis später.
Sie legt auf, und Benjamin nimmt seine Tasse, lehnt sich zurück. Der Kaffee schmeckt doch besser als erwartet. Er notiert sich in Gedanken, nächsten Sonntag wiederzukommen. Jede*r verdient eine zweite Chance.
Benjamin, denkt sie, Benjamin, Benjamin, als könnte sie ihn so herbeizitieren. Wie immer ist er zu spät, und sie ist pünktlich. Sie könnte ebenfalls später kommen, wo sie doch weiß, sie wird warten müssen. Aber dann würde sie sich an sein Verhalten, sein Fehlverhalten, um genau zu sein, anpassen. So weit kommt’s noch, denkt sie und friert.
Sibylla hat vor dem Verlassen des Hauses die Wetter-App gecheckt und sich deswegen für die olivgrüne Winterfunktionsjacke entschieden. Dabei wollte sie eigentlich den roten Mantel tragen, die attraktivere Wahl. Für den hatte selbst Benjamin schon anerkennende Worte übrig, aber niemals würde sie so tief sinken, ihre Kleiderwahl von seinem Geschmack abhängig zu machen. Sie wippt ein wenig in den Knien, in der Hoffnung, ihre Beine aufzuwärmen. Sie streicht an ihren Haaren herum, justiert die Spange am Hinterkopf neu. Insgeheim mag sie es, auf Benjamin zu warten. Es erinnert sie an die Unverbindlichkeit ihres Arrangements. Er könnte kommen oder sie versetzen, könnte sie innig lieben oder übermorgen alles beenden. Allermeist ist er aber doch sehr gewillt, ihren Wünschen nachzukommen, Fußmassagen zum Beispiel oder Füßeküssen, Unverbindlichkeit hin oder her.
Seit einem Jahr treffen sie sich, höchstens vierzehntäglich, für ein Abendessen im Restaurant, einen Museumsbesuch, einen Spaziergang – mit anschließendem Sex. Ihr Mann Andrew sitzt währenddessen zu Hause, weiß von allem und freut sich oder trifft seinerseits eine Bekanntschaft, von der Sibylla ebenfalls weiß und wegen der sie sich dann mehr oder weniger für Andrew freut. Sie hat Benjamin an der Universität kennengelernt, als sie für ein Semester als Gastdozentin jungen, aufstrebenden Menschen zu vermitteln versucht hat, dass der Kunstbetrieb nichts weiter ist als eine sausage party und sie sich glücklich schätzen können, wenn sie während der Studienzeit eine selbst organisierte, honorarfreie Ausstellung in der Stadt auf die Beine stellen dürfen und hinterher mit Fieber und Gliederschmerzen im Bett liegen.
Da eins von Benjamins Seminaren in jenem Semester den Titel Werk, Markt, Wert – Eine Betriebsanalyse trug, war absehbar, dass sie auf der Weihnachtsfeier des Instituts Wein um Wein miteinander trinken würden, während sie sich permanent gegenseitig recht gaben. Kurz darauf verabredeten sie sich zu einem ersten Abendessen, bei dem Sibylla das Gespräch elegant auf seinen Beziehungsstatus lenkte, woraufhin er sagte: Nein, nein, eine feste Beziehung wäre sowieso nichts für mich, ich bin innerlich viel zu rigide und außerdem zu alt. Sie dachte: Zu alt, als ob. Wenn er nur sehen könnte, mit was für lüsternen Blicken ihn Frauen, Männer und alle dazwischen verschlingen, ganz egal welchen Alters. Mit Sicherheit verlieben sich früher oder später 98 Prozent aller Studierenden in ihn, der Rest identifiziert sich als aromantisch.
In diesem Moment kommt Benjamin die U-Bahn-Treppe hinauf, das Licht des Haltestellenschildes liegt sanft auf seinen Schultern. Sie beobachtet, wie er am Aufgang kurz stehen bleibt, das Telefon aus der Tasche zieht und es gleich wieder einsteckt.
Na, sagt sie und lächelt ihn an, als er nur noch wenige Schritte entfernt ist. Ungebetene Anrufer*innen? Würde mich nicht wundern, wenn dich jemand stalkt.
Ich nehme an, das ist eines deiner versteckten Komplimente, antwortet er. Aber ich muss dich enttäuschen, es war nur meine Mutter.
Und du gehst nicht ran? Wie ungezogen.
Da würde sie sicher zustimmen. Willst du noch eine rauchen, fragt er und holt eine frische Schachtel Zigaretten aus der Manteltasche.
Gewagt, denkt sie, in Anbetracht der Uhrzeit. Und überhaupt, seit wann raucht er?
Wieso nicht, sagt sie, und er zündet ihnen beiden eine Zigarette an.
Ich habe auf dem Weg hierher zwei Kritiken gelesen, sagt er. Es hieß, die Inszenierung sei eine metamoderne Interpretation der vergeblichen Hoffnung auf einen Systemwandel beziehungsweise die perfekte Darstellung des horror vacui.
Sibylla lacht. Kein Wunder, dass kaum noch jemand ins Theater geht, Metamodernismus, gute Nacht. Sie schüttelt sich unwillkürlich.
Ist dir kalt?
Nein, ich musste nur den Gedanken an unseren Elfenbeinturm loswerden.
Immerhin bist du so ehrlich und zählst dich dazu.
Das ist doch Teil unserer Attitüde, sagt sie, aber Benjamin hört nicht zu.
Er holt sein Telefon hervor und seufzt. Schon wieder meine Mutter.
Hartnäckig, sagt Sibylla und hofft, dass er nicht rangeht. In fünf Minuten beginnt das Stück, und sie haben noch nicht einmal ihre Jacken abgegeben. Zur Toilette will sie eigentlich auch noch.
Benjamin nimmt ab. Er formt ein lautloses Sorry mit den Lippen und entfernt sich ein Stück.
Sie hört ihn laut und fröhlich sagen: Nur keine Sorge, Mutti. Dann schweigt er. Sibylla stellt sich vor, wie Benjamins Mutter über seine spärlichen Besuche klagt. Er sagt etwas, zu leise dieses Mal. Vielleicht erzählt er ihr, dass er mit einer ehemaligen Kollegin ins Theater geht, dass er sich beeilen muss. Die Mutter wahrscheinlich daraufhin: Mit mir gehst du nie ins Theater. Sibylla lächelt und zieht an ihrer Zigarette. Benjamin scharrt mit der Schuhspitze ein paar Kieselsteine auf dem Gehweg zusammen, fährt sich mit ungeduldiger Geste durch die Haare und schaut entschuldigend zu ihr hinüber. Ganz sicher, hört sie ihn fragen, jetzt wieder etwas lauter. Dann Schweigen, ein Nicken, verabschiedende Worte, und er legt auf.
Alles in Ordnung, fragt Sibylla und geht ein paar Schritte, um ihn sanft in Richtung Theatereingang zu bewegen. In drei Minuten beginnt das Stück. Aber Benjamin rührt sich nicht.
Mein Vater ist krank beziehungsweise noch kränker als sonst.
Sibylla bleibt stehen. Schlimm?
Demenz. Er ist schon seit anderthalb Jahren im Heim. Seniorenresidenz, meine ich.
Sie schaut ihn an, sucht in seiner Mimik die Verbitterung, die sie in seiner Stimme zu hören glaubt. Und jetzt?
Vielleicht geht es ihm wirklich schlecht. Manchmal … Er zuckt mit den Schultern und seufzt.
Sibylla hat plötzlich den Eindruck, dass sich etwas zwischen ihnen verschoben hat. Nie haben sie über persönliche Dinge gesprochen, jedenfalls keine, die diesen Blick in Benjamins Augen ausgelöst hätten. Er sieht aus wie ein kleiner Junge, der mit seiner Klassenlehrerin vor der Schule steht und seit Stunden oder Tagen oder Jahren darauf wartet, dass seine Mutter ihn abholt.
Willst du lieber nach Hause?
Er lächelt, schaut an der Theaterfassade hinauf. Nein. Ich will mir lieber diese metamoderne Darstellung des horror vacui ansehen. Komm!
Your choice, sagt sie und denkt: Auf die Minute genau.
Als Benjamin in Richtung Eingang vorangeht, schließt sie zu ihm auf und nimmt, zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit, seine Hand.

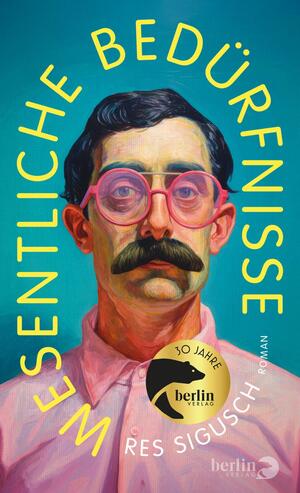
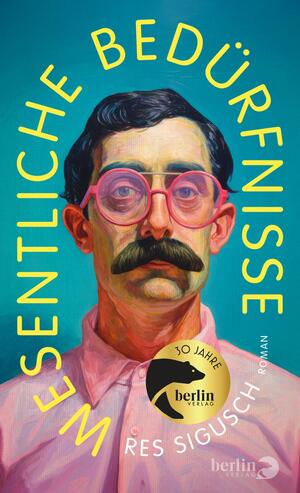





















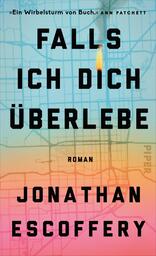
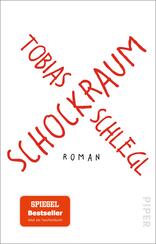









Toxic Man