Teil I
Wie sich Kinder entwickeln
Vielfalt und Individualität
Was das einzelne Kind ausmacht
Sie haben während Ihrer 35-jährigen Tätigkeit als Kinderarzt Tausende von Kindern untersucht, insbesondere im Rahmen der Zürcher Longitudinalstudien. In diesen Studien wurden zwischen 1954 und 2005 das Wachstum und die Entwicklung bei etwa 800 gesunden Kindern von der Geburt bis ins Erwachsenenalter festgehalten und analysiert (Largo et al. 2005). Was ist für den Entwicklungsspezialisten Largo ein Kind?
Für mich zeichnet sich ein Kind durch sein einmaliges Wesen aus. Es hat mich immer wieder erstaunt, wie unverwechselbar Kinder sind. Bereits im ersten Lebensjahr ist das Kind eine Persönlichkeit und beginnt sich spätestens mit 2 Jahren seiner Individualität bewusst zu werden. Seine individuellen Fähigkeiten und Verhaltenseigenschaften setzen sich im Laufe der Kindheit immer mehr durch. Das Beste, was wir als Erwachsene tun können, ist: das Kind so annehmen wie es ist. Seine Individualität von klein auf zu respektieren, scheint mir mit das Wichtigste im Umgang mit Kindern zu sein.
In Ihren Arbeiten (Largo 1999, 2007) betonen Sie immer wieder die extremen Entwicklungsunterschiede bei Kindern, und zwar bereits in den ersten Lebensjahren. Kinder beginnen zum Beispiel in sehr unterschiedlichem Alter zu sprechen. Die einen tun dies bereits früh mit 10 bis 12 Monaten, andere erst mit 24 bis 30 Monaten. Wie offenbaren sich solche Unterschiede bei der Einschulung?
Die Individualität ist ein Ausdruck dieser großen Vielfalt unter den Kindern. Die Vielfalt nimmt im Verlauf der Kindheit immer mehr zu. Wenn eine Lehrerin eine Klasse mit 20 7-jährigen Kindern vor sich hat, dann unterscheiden sich die Kinder in ihrem Entwicklungsalter um mindestens 3 Jahre (Abbildung 1). Es gibt Kinder, die mit 7 Jahren ein Entwicklungsalter von 8 bis 9 Jahren haben und bereits lesen können. Andere mit einem Entwicklungsalter von 5 bis 6 Jahren sind noch weit davon entfernt. Bis zur Oberstufe nehmen die Unterschiede zwischen den Kindern noch einmal deutlich zu. Mit 13 Jahren variiert das Entwicklungsalter um mindestens 6 Jahre zwischen den am weitesten entwickelten Kindern und jenen, die sich am langsamsten entwickeln (Abbildung 2). Hinzu kommt, dass die Jungen als Gruppe im Mittel um eineinhalb Jahre in ihrer Entwicklung hinter den Mädchen zurückliegen. (Beispiele zur Vielfalt in den verschiedenen Entwicklungsbereichen siehe Teil II.) Der Umgang mit dieser sogenannten interindividuellen Variabilität ist für Eltern und Lehrkräfte sehr anspruchsvoll.
Warum die Begabungen bei einem Kind oft sehr unterschiedlich sind
Eltern und auch Lehrer wundern sich immer wieder, wie unterschiedlich die Begabungen bei einem Kind ausgeprägt sein können. Das eine Kind ist gut in Sprache, aber schwach in Mathematik; bei einem anderem ist es genau umgekehrt. Wie lässt sich das erklären?
Das rührt von der Vielfalt im Kind selbst her, der sogenannten intraindividuellen Variabilität; auch sie kann von Kind zu Kind unterschiedlich stark ausfallen. Diese Vielfalt führt dazu, dass jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene sein ihm eigenes Profil von Begabungen oder Kompetenzen aufweist. Vier solche Profile von 10-jährigen Kindern sind in den Abbildungen 3 bis 6 dargestellt. Bei Anna sind alle Fähigkeiten gleich stark ausgeprägt. Ein Kind wie Anna ist mir allerdings noch nie begegnet. Dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nach muss es solche Kinder irgendwo auf der Welt geben, doch sie sind sehr selten. Bei der großen Mehrheit der Kinder sind die Fähigkeiten unterschiedlich ausgebildet. Die Kompetenzprofile von Melissa, Philipp und Joachim zeigen, wie verschieden die Zusammensetzung von Stärken und Schwächen bei einem Kind sein kann. Für die Eltern und vor allem für die Lehrer bedeutet dies, dass sie sich auf jedes einzelne Kind je nach Kompetenz und Lernsituation individuell einstellen müssen. Das ist – zusammen mit den zahlreichen Unterschieden zwischen den Kindern innerhalb einer Klasse – eine große pädagogische Herausforderung für die Lehrkräfte (siehe Teil III).
Wollte man nun den Anspruch umsetzen, dass jedes Kind auf dem ihm entsprechenden Niveau unterrichtet wird, dann müsste man letztlich jedes Kind einzeln unterrichten, um ihm vollauf gerecht zu werden. Ist das nicht eine Illusion?
Wer die Vielfalt negiert, weil er glaubt, individualisierter Unterricht sei nicht realisierbar, der hat kapituliert, aber damit die reale Vielfalt unter den Kindern nicht aus der Welt geschafft. Wenn in einer 2. Klasse an der Grund- oder Primarschule das eine Kind nur bis 10 zählen kann und das andere bereits bis 1000; wenn das eine Kind Bücher liest und das andere noch nicht einmal das ganze Alphabet kennt, dann kann man nicht einfach so tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht. Wie in Teil III gezeigt werden wird, ist eine Individualisierung des Unterrichts möglich und keine Utopie.
Wie entsteht die Vielfalt zwischen den Kindern und jene beim einzelnen Kind?
Die Entwicklung eines Kindes hin zu einem unverwechselbaren Individuum lässt sich im Wesentlichen durch 3 Prozesse charakterisieren:
• Das Kind wächst. Jedes Entwicklungsmerkmal wie die Körpergröße nimmt von Kind zu Kind quantitativ unterschiedlich stark zu.
• Das Kind differenziert seine Fähigkeiten aus. Eine Fähigkeit wie die gesprochene Sprache entwickelt sich von Kind zu Kind qualitativ unterschiedlich bezüglich zeitlichem Auftreten und Ausprägung.
• Das Kind spezifiziert seine Fähigkeiten. Je nach Umwelt, in der das Kind aufwächst, werden Fähigkeiten wie Sprache oder Essverhalten von Kind zu Kind unterschiedlich festgelegt.
Im Verlauf der Pubertät werden diese 3 Prozesse abgeschlossen. Damit haben das körperliche Wachstum, die Motorik und die Entwicklung der sogenannten fluiden Intelligenz ihren Höhepunkt, aber auch ihren Abschluss erreicht. Die kristalline Intelligenz und die Persönlichkeit werden sich noch jahrzehntelang weiterentwickeln (fluide und kristalline Intelligenz siehe Anhang). Die Vielfalt unter den Kindern wird ganz wesentlich durch die Umwelt mitbestimmt. Offensichtlich ist dies bei der Sprache oder dem Beziehungsverhalten. Diese sogenannte Heterogenität ist Ausdruck des sozialen, kulturellen und religiösen Umfeldes, in dem die Kinder leben. Die Heterogenität ist jedoch lediglich ein Teil der Vielfalt. Der entscheidende Anteil an Vielfalt liegt in den Kindern selbst. Selbst wenn die Kinder unter den gleichen sozialen, kulturellen und religiösen Bedingungen aufwachsen würden, wären sie immer noch sehr verschieden. Diese Vielfalt wahrzunehmen und ihr Rechnung zu tragen ist das Anliegen dieses Buches.
Das Wichtigste für die Schule
1. Es gibt kein Entwicklungsmerkmal, welches bei allen gleichaltrigen Kindern gleich ausgeprägt ist.
2. Die Vielfalt unter gleichaltrigen Kindern entsteht, weil Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind unterschiedlich ausgeprägt sind (zum Beispiel die Körpergröße) und unterschiedlich rasch ausreifen (zum Beispiel die gesprochene Sprache) (interindividuelle Variabilität).
3. Die einzelnen Eigenschaften und Fähigkeiten sind im Kind selbst unterschiedlich angelegt und reifen verschieden rasch aus (zum Beispiel kann es sein, dass sich seine sprachlichen Fähigkeiten rascher entwickeln als seine motorischen) (intraindividuelle Variabilität).
4. Mädchen als Gruppe sind von Geburt an immer etwas weiter entwickelt als Jungen. Dies ist auf eine unterschiedliche Zeitskala der biologischen Reifung bei Mädchen und Jungen zurückzuführen.
5. Die soziale, kulturelle und religiöse Umwelt, in der das Kind aufwächst, trägt wesentlich zur Vielfalt unter den Kindern bei (Heterogenität).
6. Die im Kind angelegte Vielfalt in ihrem ganzen Ausmaß wahrzunehmen und als biologische Realität zu akzeptieren ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder in Familie und Schule gerecht zu werden.
Anlage und Umwelt
Wie Anlage und Umwelt auf das Kind einwirken
Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen davon, was bei einem Kind vererbt wird und welchen Beitrag die Umwelt an seiner Entwicklung leistet. Welche Rolle spielen diese Vorstellungen bei unserem Umgang mit einem Kind?
Aus diesen Vorstellungen entstehen Erwartungen, die wir an das Kind stellen. Unsere Erziehungshaltung ist eine andere, wenn wir davon ausgehen, dass die Fähigkeit zu lesen je nach Kind verschieden angelegt ist und unterschiedlich rasch heranreift, oder wenn wir annehmen, dass wir das Kind durch möglichst frühe und intensive Erfahrungen mit dem Alphabet zum Lesen bringen können. Es ist daher wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, wie Anlage und Umwelt die Entwicklung eines Kindes bestimmen.
Was verstehen Sie unter Anlage? Welche Bedeutung haben dabei die Gene?
Die Gene werden uns zwar als magischer Schlüssel für alle Geheimnisse des Lebens präsentiert. Doch unter Anlage verstehe ich weit mehr als nur die Gene. Die Gene allein erklären das Wunder „Mensch“ nicht. Die Gesamtzahl der Gene, das sogenannte Genom, ist beim Menschen weit weniger groß, als man ursprünglich annahm. Selbst niedrige Tiere wie gewisse Reptilien haben fast vergleichbar viele Gene wie der Mensch. Mit dem Schimpansen haben wir mindestens 98,5 Prozent der Gene gemeinsam, fühlen uns aber doch recht verschieden. An den Genen allein kann es also nicht liegen. Es ist vielmehr das Zusammenspiel der Gene, das den großen Unterschied bewirkt. Gene sind wie Balletttänzer in einem Ensemble. Die Anzahl der Tänzer und Tänzerinnen macht nicht die Güte eines Balletts aus. Und man kann auch kaum allein aufgrund der Zusammensetzung der Balletttruppe erahnen, was sie aufführen wird. Mit dem gleichen Ensemble können ganz unterschiedliche Stücke inszeniert werden. Erst wenn sich die Tänzer und Tänzerinnen bewegen, miteinander interagieren, Szenen darstellen und eine Stimmung erzeugen, entsteht eine Ballettaufführung. Dazu muss es eine Choreografie geben, die jeden Einsatz der Tänzer und Tänzerinnen während der ganzen Aufführung minutiös vorgibt. Und so ist es auch mit den Genen. Sie erhalten erst dann ihre Bedeutung, wenn sie aktiv werden, miteinander interagieren, und dies alles nach einem hochkomplexen, zeitlich streng festgelegten Programm. Balletttänzer können straucheln, einander verpassen, eine Sequenz vergessen oder einen Moment lang innehalten, weil sie durch ein Niesen im Publikum irritiert wurden. Das kann ebenso in der pränatalen Entwicklung geschehen: Gene können defekt sein, zum falschen Zeitpunkt aktiv werden oder aus verschiedenen Gründen den Entwicklungsplan nicht genau befolgen. Entscheidend ist also, wie dieser Entwicklungsprozess, der viele Monate in Anspruch nimmt, vonstatten geht. Wir kennen zwar die Gene, verfügen aber nur über ein minimales Wissen darüber, wie die unzähligen Interaktionen zwischen den Genen ablaufen. Es wird noch viele Jahre dauern, falls es überhaupt je gelingen sollte, bis wir diese hochkomplexen Vorgänge verstehen werden. Die Anlage ist also weit mehr als nur der Ausdruck der Gene, sie ist das Produkt einer Entwicklung, die nicht nur 1 bis 2 Stunden dauert wie eine Ballettaufführung, sondern 9 lange Schwangerschaftsmonate, welche die Anlage braucht, um ein lebensfähiges Kind entstehen zu lassen. Bereits während der Schwangerschaft gibt es zudem äußere Faktoren wie virale Erkrankungen oder Drogen wie Nikotin oder Alkohol, welche die Entwicklung des ungeborenen Kindes zusätzlich beeinträchtigen können.
Um das Verständnis für das Zusammenwirken von Anlage und Umwelt zu erleichtern, wollen wir uns zuerst der Grafik zur Körpergröße (Abbildung 7) zuwenden. Wir sehen, dass Kinder in jedem Alter unterschiedlich groß sind und dass Jungen und Mädchen sich unterschiedlich rasch entwickeln. Was ist hier durch die Anlage und was durch die Umwelt bedingt? Und wie wirken Anlage und Umwelt zusammen?
Das Kind kann sein gesamtes Wachstumspotenzial nur realisieren, wenn die Lebensbedingungen optimal sind. Dies ist dann der Fall, wenn es ausreichend ernährt wird, unter guten hygienischen Bedingungen aufwächst und nie ernsthaft über längere Zeit krank ist. Diese Bedingungen sind für die meisten Kinder in Mitteleuropa gegeben. Das heißt, die Unterschiede in der Körpergröße, die wir in unserer Bevölkerung vorfinden, sind mehrheitlich durch die individuell andersgeartete Anlage bedingt. In den Zürcher Longitudinalstudien haben wir festgestellt, dass die Körpergröße zu mindestens 95 Prozent durch die Anlage und zu weniger als 5 Prozent durch die Lebensbedingungen bestimmt wird. Das war früher in Mitteleuropa ganz anders. Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts litt die Bevölkerung noch unter Hungersnöten, und ihre Gesundheit war durch schwere Infektionskrankheiten wie Tuberkulose beeinträchtigt. Unter diesen schlechten Lebensbedingungen waren die Menschen im Mittel 10 bis 15 Zentimeter kleiner als heute. Durch die stete Verbesserung der Lebensbedingungen wurden sie von Generation zu Generation größer. Die Zunahme der Körpergröße hat sich dabei in den bessergestellten sozialen Schichten rascher vollzogen als in den benachteiligten Schichten. Sie hat aber in den letzten 30 Jahren alle sozialen Schichten erreicht. Diese Entwicklung, der sogenannte säkulare Trend (Van Wieringen 1986), ist in unserer Bevölkerung weitgehend zum Stillstand gekommen. In vielen Entwicklungsländern sind die Lebensbedingungen leider immer noch so wie bei uns vor 100 Jahren. Die Menschen sind kleiner, weil sie unter Mangelernährung, schlechten hygienischen Verhältnissen und Krankheiten leiden (Schell et al. 1993).
Man kann also auch unter idealen Umweltbedingungen nicht grenzenlos weiterwachsen. Wo liegt die Obergrenze?
Die Anlage schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung und legt das Optimum fest, das ein Kind erreichen kann. Die Umweltbedingungen bestimmen, wie viel von dieser Anlage realisiert werden kann. Die individuelle Grenze ist also durch die Anlage festgelegt und lässt sich nicht überschreiten. Das Kind kann für seine Körpergröße nur so viel verwerten, wie sein Stoffwechsel zu leisten vermag. Man kann es auch so ausdrücken: Wenn wir ein Kind überfüttern, wird es nicht größer, sondern nur dick. Für die Bevölkerung bedeutet dies, dass selbst unter optimalen Bedingungen starke Unterschiede in der Körpergröße bestehen bleiben. Die Größe eines Kindes wird durch 2 weitere, ebenfalls anlagebedingte Faktoren mitbestimmt: das Geschlecht und die Reifung. Erst im Verlauf der Pubertät stellt sich der doch recht deutliche mittlere Unterschied von 13 Zentimetern zwischen Frauen und Männern ein. Dazu tragen vor allem die Geschlechtshormone bei, die in der Pubertät aktiv werden. Eine rasche oder langsame Reifung kann die Körpergröße ebenfalls erheblich beeinflussen. Wie unterschiedlich die Reifung verlaufen kann, wird am Auftreten der sekundären Geschlechtsmerkmale besonders gut ersichtlich (Abbildung 8). So kann die erste Menstruationsblutung (Menarche) bereits zwischen 9 und 10 Jahren oder aber erst mit 16 bis 17 Jahren auftreten (mittleres Auftreten mit 12,5 Jahren). Ebenso unterschiedlich kann die Entwicklung der Körpergröße verlaufen. Der pubertäre Wachstumsschub und der Abschluss des Längenwachstums stellen sich bei Spätzündern bis zu 6 Jahre später ein als bei Frühentwicklern.
Die große Frage ist nun allerdings, ob dieses Modell auch in Bezug auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten eines Kindes Gültigkeit hat.
Grundsätzlich ja. Das Modell wird zwar immer wieder mit Skepsis bedacht, weil sich das Zusammenwirken von Anlage und Umwelt in anderen Entwicklungsbereichen oft nicht so eindeutig wie bei der Körpergröße aufzeigen lässt. Und auch uns als Eltern oder Fachleuten befallen manchmal Zweifel, weil wir das Kind oft anders haben möchten und dazu neigen, seine Begabungen zu überschätzen. Doch für mich sind die Studienergebnisse eindeutig: In Abbildung 9 ist die Lesekompetenz bei 15-jährigen Schülern in 5 Ländern dargestellt (PISA-Studie 2006; Testmethode siehe Anhang). Achtet man auf den Mittelwert (dicker Strich), so stellt man fest: Kinder in Finnland erbringen eine bessere mittlere Leistung als Kinder in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sowie eine deutlich bessere als Kinder in Mexiko. Besonders beachtenswert ist jedoch die Ausdehnung der Balken. Finnland weist den kürzesten Balken aus, das heißt es verfügt über mehr Kinder, die sehr gut lesen, und über weniger Kinder mit einer sehr niedrigen Lesekompetenz. Die Balken für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind deutlich länger. In allen 3 Ländern gibt es Kinder, die sehr gut lesen, aber auch mehr Kinder mit einer niedrigen Lesekompetenz als in Finnland.
Und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Ähnlich wie bei der Körpergröße können wir daraus Folgendes ableiten:
• Je besser das schulische Angebot, desto besser ist die mittlere Lesekompetenz und umso mehr gute Schüler gibt es (Finnland > Schweiz > Deutschland > Österreich > Mexiko).
• Je schlechter das schulische Angebot, desto niedriger ist die mittlere Lesekompetenz und desto mehr Kinder können kaum oder gar nicht lesen.
• Selbst Finnland gelingt es aber nicht, bei allen Kindern eine gute bis hohe Lesekompetenz zu erreichen. Auch dort verfügt eine Gruppe von Schülern nur über eine geringe oder gar fehlende Lesekompetenz. Die Streubreite variiert also auch in Finnland zwischen sehr hoher bis fehlender Lesekompetenz. Selbst in einem qualitativ sehr guten Bildungssystem wie dem finnischen, das das Entwicklungspotenzial der Bevölkerung wahrscheinlich weitgehend realisiert, bleibt eine große interindividuelle Variabilität der Kompetenz bestehen (siehe Teil III Chancengerechtigkeit). Vergleichbare Resultate wurden im Rahmen der PISA-Studien auch für andere Kompetenzen wie mathematisches Denken, Problemlösungsverhalten oder naturwissenschaftliches Denken erhoben (PISA 2000, 2003, 2006).
Wenn offensichtlich selbst im bestentwickelten Schulsystem große Unterschiede zwischen den einzelnen Schülern bestehen bleiben, ist das eine ziemlich desillusionierende Feststellung, die vielen auf Chancengerechtigkeit bedachten Bildungspolitikern gar nicht behagen dürfte. Trotzdem sollten sie sich zu dieser Einsicht durchringen, wenn sie möglichst allen Kindern gute Lernbedingungen schaffen wollen. Der richtige Umgang mit der Vielfalt ist von großer Bedeutung für die Gestaltung der Schule und die berufliche Integration. Ein mögliches Erklärungsmodell für die PISA-Ergebnisse ist in Abbildung 10 abgebildet. Jede Bevölkerung verfügt, wie für die Körpergröße erläutert, über ein bestimmtes Entwicklungspotenzial. Je ungünstiger die sozioökonomischen Lebensbedingungen sind und je niedriger die Qualität des Bildungssystems in einer Gesellschaft ist, desto weniger Menschen können ihr individuelles Entwicklungspotenzial realisieren. Dabei gibt es in solchen Gesellschaften, wie beispielsweise in Mexiko, immer auch Menschen, die materiell und sozial bevorteilt sind und durchaus einen hohen Bildungsstand erreichen können (siehe Abbildung 9). Je günstiger die Lebensbedingungen und je höher die Qualität des Bildungssystems in einer Gesellschaft sind, desto besser kann das Bildungspotenzial realisiert werden. Doch selbst bei einer vollständigen Realisierung des Entwicklungspotenzials bleibt immer noch eine große Variabilität der Kompetenz bestehen.
Sind die Menschen in den westlichen Ländern im Durchschnitt nicht nur größer, sondern auch klüger geworden?
Der neuseeländische Politologe James R. Flynn hat tatsächlich einen solchen säkularen Trend auch für den Intelligenzquotienten in den Gesellschaften der hoch industrialisierten Länder nachgewiesen. Flynn beobachtete eine mittlere Zunahme von 3 IQ-Punkten pro Jahrzehnt bis in die 90-er Jahre (Flynn 1984). In den Niederlanden betrug die Zunahme zwischen 1952 und 1982 sogar 7 IQ-Punkte pro Dekade. Dieser sogenannte Flynn-Effekt wird auf verschiedene Ursachen zurückgeführt: verbesserte Ernährung und medizinische Versorgung, weniger Kinder in einer Familie und dadurch größere Aufmerksamkeit für das einzelne Kind und seine Bedürfnisse sowie Zunahme der visuellen Medienerfahrung. Für Letzteres spricht, dass der Anstieg des IQ vor allem den nicht sprachlichen, figural-räumlichen Fähigkeiten zuzuschreiben ist. Ein weiterer wichtiger Faktor war wohl auch die Verbesserung des Schulwesens, die bisher benachteiligten Kindern eine bessere Bildung ermöglichte. So war bei Kindern mit hohem IQ in den letzten 20 Jahren kein Flynn-Effekt mehr nachzuweisen, jedoch bei Kindern mit einem tieferen IQ, was wiederum den durchschnittlichen IQ der ganzen Bevölkerung angehoben hat (Kanaya et al. 2003).
Wie stark können wir uns noch verbessern? Wie lange wird der säkulare Trend noch anhalten?
Erste Trendmeldungen zeigen, dass die Zunahme des IQs im Verlauf der 1990-er Jahre zum Erliegen gekommen ist, zumindest in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz (Teasdale et al. 2005). Als Ursache wird unter anderem eine Bildungsverdrossenheit in der Bevölkerung vermutet. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass – wie bei der Körpergröße – das Bildungspotenzial der Bevölkerung weitgehend ausgeschöpft ist. Wenn dem so ist, müssen sich Gesellschaft und Wirtschaft darauf einstellen (siehe Teil III Chancengerechtigkeit).
Noch einmal zum Zusammenwirken von Anlage und Umwelt: Kann der eine Faktor durch den anderen kompensiert werden?
Nein, Anlage und Umwelt können sich nicht gegenseitig kompensieren, denn sie tragen Unterschiedliches zur Entwicklung bei. Ihre Bedeutung wird in den Studien über ein- und zweieiige Zwillinge sowie über Geschwister besonders gut verständlich (Abbildung 11, Wilson 1983). Eineiige Zwillinge, die gemeinsam aufwachsen, weisen von allen Kindern die größtmögliche Ähnlichkeit bezüglich Anlage und Umwelt auf. Sie haben – theoretisch – eine identische Anlage und leben im gleichen Milieu. Unterschiede können sich dennoch ergeben, wenn ihre vorgeburtliche Entwicklung nicht gleich verlaufen ist oder die Eltern mit den beiden Kindern unterschiedlich umgehen. Die Übereinstimmung der intellektuellen Leistungsfähigkeit beträgt im ersten Lebensjahr lediglich 50 Prozent, nimmt aber bis in die Adoleszenz auf beinahe 80 Prozent zu (Näheres siehe Glossar unter Korrelationen). Sie ist damit etwa gleich hoch, wie wenn die gleiche Person zwei Mal getestet wird. Das heißt, eineiige Zwillinge werden sich im Verlauf der Kindheit in ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit immer ähnlicher. Inwieweit diese Übereinstimmung auf die gemeinsame Anlage beziehungsweise gemeinsame Umwelt zurückzuführen ist, lässt sich nicht entscheiden. Diese Frage kann beantwortet werden, wenn man eineiige Zwillinge untersucht, die getrennt voneinander aufwachsen. Es kommt immer wieder vor, dass eineiige Zwillinge von zwei Familien adoptiert werden. Obwohl sie in unterschiedlichen Familien leben und sich nie begegnet sind, verläuft ihre intellektuelle Entwicklung weitgehend so, wie wenn sie gemeinsam aufgewachsen wären. Was vor allem erstaunlich ist: Sie werden sich bis ins Erwachsenenalter immer ähnlicher, wenn auch nicht ganz so ähnlich, wie wenn sie in der gleichen Familie gelebt hätten. Die Übereinstimmung liegt bei fast 70 Prozent (Scarr 1992).
Die Anlage scheint also dominierend zu sein. Wie setzt sich dann die Umwelt durch?
Die Umwelt hat – wie die Nahrung für das Wachstum – weniger eine gestaltende als vielmehr eine Art nährende Rolle. Sandra Scarr (1992) hat sie folgendermaßen beschrieben: Bei eineiigen Zwillingen bewirkt ihre weitgehend identische Anlage, dass sie die gleichen Interessen und Neigungen haben. Sie suchen daher auch in unterschiedlicher Umgebung nach ähnlichen Erfahrungen, soweit die Umwelt diese anbietet und zulässt. Zwillinge beeinflussen mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten die Umgebung auf eine ähnliche Weise, was wiederum den Umgang der Bezugspersonen mit ihnen beeinflusst. Die Umwelt wirkt also weit weniger als bisher angenommen aktiv auf das Kind ein, sondern das Kind selbst ist aktiv. Die Umwelt bestimmt jedoch das Angebot an Erfahrungen, die das Kind machen kann. Die Umwelt wirkt sich dann negativ auf die Entwicklung des Kindes aus, wenn sie ihm Erfahrungen vorenthält. Ein „Überangebot“ an Anregungen verbessert seine Entwicklung hingegen nicht, genauso wenig wie ein Überfüttern die Körpergröße positiv beeinflussen kann. Diese These wird durch die Entwicklung von zweieiigen Zwillingen und Geschwistern gestützt. Zweieiige Zwillinge verfügen zu je 50 Prozent über gemeinsame Erbanlagen. Sie sind sich damit nicht ähnlicher als Geschwister. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie gleich alt sind und im gleichen Milieu aufwachsen. Dieser Umstand führt anfänglich zu einer deutlichen Übereinstimmung in der intellektuellen Entwicklung von etwa 50 Prozent, die damit gleich groß ist wie bei eineiigen Zwillingen. In den folgenden Jahren leben sich zweieiige Zwillinge jedoch zunehmend auseinander, weil sie doch recht verschieden sind und aktiv unterschiedliche Erfahrungen suchen. In der Adoleszenz beträgt die Übereinstimmung etwas mehr als 30 Prozent. Dieser Verlauf mag überraschen, wenn man bedenkt, dass die Kinder zur gleichen Zeit in der gleichen Familie aufwachsen und zumeist auch die gleichen Schulen besuchen. Sie entwickeln sich mit den Jahren immer mehr auseinander, weil sie – genau wie Geschwister – unterschiedliche Interessen und Begabungen haben. Dies führt, obwohl sie im gleichen Milieu groß werden und gleich alt sind, zu unterschiedlichen Entwicklungen.
Zwillinge weisen mit ihren Geschwistern ebenfalls zu 50 Prozent die gleichen Anlagen auf und leben in der gleichen Familie. Der einzige Unterschied ist: Sie sind verschieden alt und müssen daher die Familie unterschiedlich erleben. Wie wirkt sich das aus?
Zwillinge machen mit ihren Geschwistern interessanterweise eine gegenteilige Entwicklung durch wie diejenige, die sie miteinander machen. In den ersten Lebensjahren liegt die Übereinstimmung in ihrer intellektuellen Entwicklung lediglich bei 10 Prozent und ist damit deutlich niedriger als bei zweieiigen Zwillingen. Da sie immerhin zu 50 Prozent eine gemeinsame Anlage haben, werden sich die Zwillinge und ihre Geschwister im Verlauf der Entwicklung jedoch immer ähnlicher. In der Adoleszenz ist ihre Übereinstimmung schließlich etwa gleich groß wie bei zweieiigen Zwillingen. Obwohl sie nicht alterssynchron aufwachsen, werden sie sich ähnlicher, weil sie aufgrund ihrer Anlage die gleichen Erfahrungen suchen und zumeist auch machen können.
Wie sich das Kind entwickelt
Offenbar setzen sich die individuellen Fähigkeiten und Verhaltenseigenschaften im Verlaufe der Entwicklung immer mehr durch. Lässt sich daraus schließen, dass das Kind ein selbstbestimmtes Wesen ist?
In einer gewissen Weise ja. Es ist aber auch ein von der Umwelt extrem abhängiges Wesen: Wenn ihm seine Umwelt die notwendigen Erfahrungen vorenthält, kann es sich nicht seiner Anlage entsprechend entwickeln. Sandra Scarr (1992) hat ein Erklärungsmodell vorgeschlagen, dessen Stärke darin besteht, dass es sich durch Studienresultate bestätigen lässt, im Erziehungs- und Schulalltag nachvollziehbar ist und sich unmittelbar auf die Art und Weise auswirkt, wie wir mit dem Kind umgehen. Dieses Modell geht von folgender Annahme aus:
• Das Kind ist aktiv: Es entwickelt sich aus sich heraus.
• Das Kind ist selektiv: Es sucht sich diejenigen Erfahrungen, die seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand entsprechen. • Das Kind beeinflusst mit seiner Persönlichkeit und seinem Verhalten seine soziale Umgebung, was sich wiederum darauf auswirkt, wie die Umgebung mit ihm umgeht.
Das Kind ist also kein Gefäß, das sich mit beliebigem Inhalt beziehungsweise irgendwelchen Erfahrungen füllen lässt. Vielmehr sucht es sich aktiv jene Erfahrungen, die es braucht, um sich zu entwickeln. Ein deutlicher Hinweis auf die aktiv bestimmte Entwicklung ist die Beobachtung, dass eine Begabung sich umso stärker durchzusetzen versucht, je ausgeprägter sie ist. Wolfgang Amadeus Mozart wuchs in einer Familie auf, die ihn auf das Höchste förderte. Dass sich seine Begabung voll entfalten konnte, ist daher nicht weiter erstaunlich. Der Pianist Arthur Rubinstein wurde in eine Familie hineingeboren, in der – nach seinen eigenen Worten – „niemand auch nur über die geringste musikalische Begabung verfügte“ (Gardner 1985). Er sprach als Kleinkind nur wenig, sang dafür umso mehr und fühlte sich von Tönen und Klängen geradezu magisch angezogen. Bis zum vierten Lebensjahr hatte er sich das Klavierspiel mehr oder weniger selber beigebracht. Bei Rubinstein setzte sich die Begabung auch unter wenig vorteilhaften äußeren Umständen durch. Das Einzige, was er dazu brauchte, war ein Klavier. Wenn wir davon ausgehen, dass das Kind nicht beliebige Erfahrungen verinnerlicht, sondern überwiegend solche, die seinen Interessen und Neigungen entsprechen, sollte seine Individualität im Verlaufe der Entwicklung immer deutlicher in Erscheinung treten: Das Kind wird immer mehr es selbst. Das ist genau das, was wir in der Schule im großen Stil erleben. Verschiedene Studien zeigen überdies, dass sich diese Annäherung an sich selbst bis ins hohe Alter fortsetzt (Baltes et al. 2001).
Können sich Eltern und Lehrer also mehr oder weniger verabschieden und das Kind sich selbst überlassen? Haben sie überhaupt noch eine Aufgabe?
Eltern und Lehrer haben nur geringen Einfluss darauf, welche Erfahrungen ein Kind verinnerlicht. Die enorm wichtige Aufgabe von Eltern und Lehrern besteht vielmehr darin, dem Kind möglichst gute Rahmenbedingungen zu gewährleisten, damit es die Erfahrungen machen kann, die es für seine Entwicklung braucht, und es in seinen Lernbemühungen zu unterstützen. Sie geben beispielsweise dem Kind einen Text zum Lesen, der seiner Kompetenz möglichst gut entspricht und einen Leseerfolg verspricht. Ohne Erfahrungen kann sich das Kind nicht entwickeln und wird nie lesen lernen. Da nützt auch die beste Anlage nichts, so wie auch ein Kind ohne Nahrung nicht wachsen kann. Dem Kind diese Erfahrungen zu ermöglichen, das ist die Aufgabe von Eltern und Lehrkräften. Deshalb sind Bücher im Haushalt und lesende Eltern als Vorbilder auch so wichtig.
Dies kann aber nur gelingen, wenn Eltern und Lehrer den Entwicklungsstand des Kindes erfassen sowie aufgrund des kindlichen Lernverhaltens einschätzen können, welche Erfahrungen das Kind überhaupt machen möchte. Ist das so ohne Weiteres zu schaffen?
Das Wichtigste ist, dass Eltern und Lehrer darauf vertrauen, dass sich das Kind entwickeln will, und sie sich bewusst sind, dass sie für entwicklungsgerechte Erfahrungen sorgen müssen. Wenn es darum geht, den Erlebnisraum des Kindes zu gestalten, sind Kenntnisse über die kindliche Entwicklung hilfreich. Mein Eindruck ist, dass die angehenden Lehrer keine ausreichenden Kenntnisse über die kindliche Entwicklung vermittelt bekommen. Sie müssen sich autodidaktisch im pädagogischen Alltag ein Verständnis für das Verhalten und die Entwicklung des Kindes aneignen. Dabei gibt es nichts Spannenderes für einen Lehrer, als bei einem Kind mithilfe von Beobachtung herauszufinden, woran es wirklich interessiert ist. Wenn er dem Kind dann das richtige Erfahrungsangebot machen kann und dieses vom Kind auch angenommen wird, ist dies für ihn eine sehr befriedigende Erfahrung. Dabei muss der Lehrer die Anforderungen, welche er an das Kind stellt, immer wieder neu an die Bedürfnisse des Kindes anpassen. Je älter das Kind wird, desto größer und komplexer wird der Erfahrungsraum, den es in Anspruch nehmen will (zu Fragen der Umsetzung in der Praxis siehe Teil III).
Wer hat einen stärkeren Einfluss auf das heranwachsende Kind? Die Eltern oder die Schule?
Die Einflussmöglichkeiten der Eltern werden mit zunehmendem Alter des Kindes immer kleiner und diejenigen der Schule immer größer.Sandra Scarr hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sich die Bedeutung der Eltern und Lehrer im Verlaufe der Entwicklung ständig verändert. In den ersten Jahren werden die Erfahrungen, die ein Kind machen kann, in einem hohen Maß durch die Eltern bestimmt. Je älter das Kind wird, desto mehr Erfahrungen macht es außerhalb der Familie und orientiert sich immer mehr an anderen Bezugspersonen, insbesondere an anderen Kindern und deren Umgebung. Im Jugendalter schließlich bleiben den Eltern nur noch wenige Einflussmöglichkeiten auf ihre Kinder. Dann sind es die Schule und vor allem die Peergroups, also die gleichaltrigen Freunde, welche die Erfahrungen eines Jugendlichen bestimmen (Harris 2000). Dabei verhält sich der Jugendliche nicht passiv. Er geht vielmehr selektiv vor und wählt seinen Stärken, Neigungen und Bedürfnissen entsprechend Peers aus und die Erfahrungen, die er machen will. Dabei kann es geschehen, dass er sich in seinen Interessen und Tätigkeiten kaum oder aber sehr weit von seinen Eltern entfernt.
Was das Kind von seinen Eltern erbt
Wie berechtigt ist denn die Hoffnung der Eltern, dass sie ihre eigenen Talente ihren Kindern vererben?
Um eine möglichst anschauliche Antwort zu geben, muss ich noch einmal auf die Körpergröße zurückkommen. Es ist eine Alltagserfahrung, dass große Eltern eher große und kleine Eltern eher kleine Kinder haben (Formel zur Berechnung der Zielgröße siehe Glossar). Am ähnlichsten werden die Kinder ihren Eltern, wenn diese durchschnittlich groß sind (Frauen 165 Zentimeter; Männer: 178 Zentimeter). 50 Prozent der Söhne werden größer und 50 Prozent kleiner als ihr Vater (Abbildung 12, 13). Je stärker die Eltern klein- oder großwüchsig sind, desto mehr werden ihre Kinder von den elterlichen Vorgaben abweichen. Dieses Phänomen wird als „Regression to the Mean“ bezeichnet (Rückentwicklung zur Mitte; siehe Glossar). Ist der Vater lediglich 165 Zentimeter groß, werden seine Söhne mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent größer als er. Sie können bis zu 180 Zentimeter groß werden. Lediglich 16 Prozent werden gleich groß oder gar kleiner als der Vater. Ist der Vater 191 Zentimeter groß, gelten genau die umgekehrten Verhältnisse. 84 Prozent seiner Söhne werden als Erwachsene kleiner sein als er. Einige werden weniger als 180 Zentimeter groß. Lediglich 16 Prozent werden gleich groß wie der Vater oder noch etwas größer. Für eine möglichst genaue Wachstumsprognose muss selbstverständlich die Körpergröße von Mutter und Vater berücksichtigt werden. Die oben gemachte Aussage bleibt dabei erhalten.
Gilt das Gesetz der „Regression to the Mean“ auch für andere Entwicklungsbereiche, insbesondere für die geistigen Fähigkeiten?
Grundsätzlich ja. Je stärker eine Begabung bei den Eltern ausgebildet ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sie sich im gleichen Maß auf ein Kind überträgt. In der Familie von Albert Einstein war es zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch extrem unwahrscheinlich, dass einer seiner beiden Söhne gleich bedeutende oder gar noch bedeutendere Erkenntnisse gehabt hätte als der Vater. Abbildung 14 zeigt, dass die Töchter sich um den Mittelwert herum verteilen, wenn die Mutter über einen durchschnittlichen IQ verfügt. Wenn ihre Mütter extreme Positionen in der Normalverteilung einnehmen, tendieren die Töchter wie bei der Körpergröße zur Mitte hin (Abbildung 15). So werden die Töchter, deren Mütter über einen IQ von 130 verfügen, in 16 Prozent intellektuell gleich oder noch begabter sein als die Mutter. In 84 Prozent werden sie aber intellektuell weniger leistungsfähig, einige sogar nur durchschnittlich sein. Das Gleiche gilt im umgekehrten Sinn, wenn die Mutter einen IQ von 70 aufweist. 84 Prozent der Töchter werden über einen höheren IQ als die Mütter verfügen. Lediglich 16 Prozent über einen gleich großen oder niedrigeren. Für eine genaue Annäherung muss selbstverständlich die intellektuelle Leistungsfähigkeit von Mutter und Vater berücksichtigt werden. Entsprechende Annahmen gelten jedoch auch, wenn der IQ von Mutter und Vater in die Überlegungen miteinbezogen wird. Eine weitere Grundvoraussetzung ist, dass nicht nur ein, sondern mehrere Gene zur Ausbildung eines Entwicklungsmerkmals beitragen, also eine sogenannte multifaktorielle Vererbung vorliegt.
Das Wichtigste für die Schule
1. Die Anlage schafft die Grundvoraussetzungen dafür, dass sich Fähigkeiten und Verhalten ausbilden können. Sie allein bringt aber weder Fähigkeiten noch Verhalten hervor. Das gelingt nur gemeinsam mit der Umwelt.
2. Die organischen und funktionellen Strukturen sind bei jedem Kind anders angelegt und reifen unterschiedlich rasch heran. Fähigkeiten und Verhalten treten daher von Kind zu Kind in verschiedener Ausprägung und in einem anderen Alter auf.
3. Die Anlage schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung und legt das Entwicklungspotenzial eines Kindes fest. Die Umweltbedingungen bestimmen, wie viel von diesem Potenzial realisiert werden kann. Selbst unter idealen Umweltbedingungen kann ein Kind nur entwickeln, was in ihm angelegt ist.
4. Die Umwelt trägt in zweierlei Hinsicht zur Entwicklung eines Kindes bei: Sie befriedigt seine körperlichen und psychischen Bedürfnisse. Und sie ermöglicht dem Kind jene Erfahrungen, die es braucht, um sich Fähigkeiten und Wissen anzueignen. Wenn ihm die Umwelt die notwendigen Erfahrungen vorenthält, kann es sich nicht seiner Anlage entsprechend entwickeln.
5. Das Kind entwickelt sich aus sich heraus:
• Das Kind ist aktiv: Seine Interessen und Neigungen richten sich nach seinem Entwicklungsstand.
• Das Kind ist selektiv: Es sucht bestimmte Erfahrungen. Es orientiert sich an seinen Interessen und Neigungen.
• Es beeinflusst mit seiner Persönlichkeit und seinem Verhalten seine soziale Umgebung, was sich wiederum darauf auswirkt, wie die Umgebung mit ihm umgeht.
6. Die individuellen Fähigkeiten und Verhaltenseigenschaften setzen sich im Verlauf der Entwicklung immer mehr durch. Die Umwelt bestimmt das Angebot an Erfahrungen, die das Kind machen kann. Das Kind bestimmt, was es davon aufnehmen will.
7. Das Kind kann immer nur so viel von der Umwelt aufnehmen, wie ihm von seinem Entwicklungsstand vorgegeben ist. Ein Angebot, welches über seine Bedürfnisse hinausgeht, bleibt ungenutzt oder behindert gar seine Entwicklung.
8. Die Kinder sind den Eltern dann am ähnlichsten, wenn die Eltern in ihren Fähigkeiten durchschnittlich sind. Je weiter die Eltern mit ihren Fähigkeiten vom Durchschnitt entfernt sind, desto mehr weichen ihre Kinder von ihnen ab und neigen ihrerseits dem Durchschnitt zu („Regression to the Mean“).
Lernverhalten
Wie Kinder lernen
Eltern und Lehrkräfte haben oft sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sich Kinder entwickeln und wie sie lernen sollen. Lässt sich überhaupt entscheiden, welche Vorstellungen die richtigen sind?
Sobald wir uns mit Kindern beschäftigen, treffen wir gewisse Annahmen, die auch unsere Erwartungen und unseren Umgang mit dem Kind bestimmen. Ein Beispiel: Wir gehen davon aus, dass Patrick bereit ist, lesen zu lernen, denn er ist schließlich 7 Jahre alt und in der ersten Klasse. Er zeigt jedoch noch kein Interesse an Buchstaben und verweigert sich, sobald er Buchstaben lesen oder malen soll. Häufig werden Kinder, die nicht unseren Erwartungen entsprechen, als faul, ablenkbar, unkonzentriert oder unruhig beschrieben. Wir beklagen uns, dem Kind würden die sogenannten Sekundärtugenden wie Fleiß und Ausdauer sowie eine gute Arbeitshaltung fehlen. Wenn es nur wollte, dann könnte es schon! Je nach unseren Vorstellungen, die wir von der kindlichen Entwicklung haben, werden wir mit einem Kind wie Patrick unterschiedlich umgehen. Entweder wir akzeptieren, dass er noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung und warten folglich ab. Oder aber wir meinen, dass seiner Entwicklung mit Förderung nachgeholfen werden müsse. Es lohnt sich also, die eigenen Vorstellungen über Entwicklung und kindliches Lernen kritisch zu hinterfragen.
Kann man denn ein Kind wie Patrick einfach sich selbst überlassen und darauf warten, dass es selbstständig lernt? Ist er nicht auf die Unterstützung der Erwachsenen angewiesen?
Beides trifft zu. Doch je nach Lernform braucht das Kind eine andere Art von Unterstützung. Kinder lernen auf unterschiedliche Weise.
• Soziales Lernen (Lernen am Modell; Bandura 1976). Das Kind eignet sich soziales Verhalten durch Nachahmung an. Dazu benötigt es Erwachsene und Kinder als Vorbilder (siehe dazu Teil II Sozialverhalten).
• Lernen durch Erfahrung mit der gegenständlichen Umwelt. Die gegenständliche Umwelt lernt das Kind mit seiner Motorik und seinen Sinnen kennen und verstehen, indem es sich intensiv mit Gegenständen beschäftigt. So entwickelt es beispielsweise ein Verständnis für Größe, Form oder Farben. Solche Kenntnisse muss das Kind eigenständig erwerben, wir können sie ihm nicht beibringen. Diese Form des Lernens ist bis in die Pubertät vorherrschend.
• Lernen durch Unterweisung. Beim Unterweisen sollte das Lernangebot in Form und Inhalt den entwicklungsspezifischen Interessen des Kindes angepasst sein. Idealerweise werden dem Kind Erfahrungsmöglichkeiten angeboten, die es selbstständig nutzen und so eigenständig zu neuen Einsichten kommen kann. Eine Form der Unterweisung besteht zum Beispiel darin, dem Kind ein Angebot zu machen. Ein 15 Monate altes Kind schüttelt heftig eine Flasche, um so an den Inhalt heranzukommen. Wenn man ihm zeigt, dass die Flasche durch Kippen entleert werden kann, wird das Kind dieses Verhalten übernehmen, aber nur dann, wenn sein Verständnis dafür bereits so weit entwickelt ist. Genauso ist es mit dem Verständnis für den 10-er-Schritt beim Rechnen. Die meisten 8-jährigen Kinder verstehen problemlos den 10-er-Schritt, einige noch nicht. Wenn ein Kind noch keine innere Vorstellung von dem Zahlenraum jenseits von 10 hat, wird alles Unterweisen nichts fruchten (siehe Üben). Das Interesse lässt sich bei einem Kind nur dann durch Unterweisung wecken, wenn es in seiner Entwicklung so weit ist, dass es verstehen kann, worum es dabei geht.
Und diese Entwicklung lässt sich nicht vorantreiben?
Ich habe in einem Forschungsprojekt über 2 Jahre hinweg auf verschiedene Weise versucht, Kinder zu fördern, und seither weiß ich: Wir können ein Kind noch so lange antreiben und üben lassen, eine Fähigkeit oder ein Verständnis stellt sich erst dann ein, wenn das Kind in seiner Entwicklung so weit ist. Diese Feststellung gilt nicht nur für die ersten Lebensjahre, sondern für das gesamte Schulalter. Spielt und lernt das Kind selbstständig, sollten Erwachsene nicht eingreifen und das Kind anleiten, es sei denn, es bittet darum. Unterstützung sollte nicht darin bestehen, dass ein Lehrer, der permanente Überlegenheit ausstrahlt, Kindern Fähigkeiten und Wissen beibringt. Die ideale Unterstützung besteht darin, dass der Lehrer das Umfeld der Kinder so gestaltet und sie in ihren Aktivitäten so unterstützt, dass sie selbstständig zu Erfahrungen und neuen Einsichten kommen können. Das Kind sollte das Gefühl haben: Ich habe es allein geschafft. Eltern und Lehrer sollten sich so weit wie möglich zurücknehmen. Die Bereitschaft mancher Kinder, sich unterweisen zu lassen, ist erstaunlich groß, und damit besteht auch die Gefahr, dass diese missbraucht wird und die Lust am Lernen dabei verloren geht.
Warum individuelles Lernen notwendig ist
Wie erlebt ein Lehrer die Vielfalt unter seinen Schülern?
Die Abbildung 16 beschreibt die individuelle Entwicklung der Lesekompetenz bei 3 Jungen. Eldar zeigt eine durchschnittliche Entwicklung, er beginnt sich für Buchstaben mit ungefähr 7 Jahren zu interessieren. Mit 16 Jahren ist seine Lesekompetenz vollständig ausgebildet. Lars fängt bereits mit 3 bis 4 Jahren an zu lesen. Er verfügt mit 16 Jahren über eine Lesekompetenz, die deutlich höher ausfällt als diejenige von Eldar. Patrick schließlich begreift das Lesen nicht vor dem 10.Lebensjahr, seine Lesekompetenz bleibt auch mit 16 Jahren niedrig. Wie unterschiedlich die Entwicklung bei diesen 3 Kindern verläuft, zeigen folgende Vergleiche: Lars kann mit 10 Jahren gleich gut lesen wie Eldar mit 16 Jahren und ist bereits mit 8 Jahren so kompetent wie Patrick mit 16 Jahren. Lars und Patrick stellen gewissermaßen die Extremverläufe in der Bevölkerung dar. Die blaue Säule beschreibt die Lesekompetenz bei deutschen Schülern im Alter von 15 Jahren (PISA-Studie 2006). Während etwa 20 Prozent der Schüler einen komplexen Text verstehen, verfügen etwa 20 Prozent über eine Lesekompetenz, die sich auf das Lesen eines sehr einfachen Textes beschränkt. Die Mehrheit der Kinder liegt zwischen diesen beiden Extremen. Die Grafik zeigt: Je älter die Kinder werden, desto mehr unterscheiden sie sich in ihrer Lesekompetenz. Die meisten Kinder, die früh zu lesen beginnen, weisen später eine hohe Lesekompetenz auf. Kinder, die spät mit dem Lesen anfangen, können aufholen und noch eine gute Lesekompetenz erreichen.
Das kindliche Interesse an Buchstaben nehmen wir als Neugier wahr. Irgendwann will es lesen und schreiben lernen. Im Allgemeinen halten wir Neugier für eine Charaktereigenschaft, die mehr oder weniger unveränderbar ist. Trifft diese Vorstellung zu? Und lässt sich Neugier auch wecken?
Als Entwicklungsspezialist würde ich Neugier nicht als Charaktereigenschaft bezeichnen, sondern vielmehr als eine Form von Spannung. Abbildung 17 zeigt die Lernkurve von Lars. Die rote Kurve, die sein Entwicklungspotenzial beschreibt, gibt in etwa die neurobiologische Reifung in Bezug auf die Lesefähigkeit wieder. Für jeden Entwicklungsschritt, zu dem sein Gehirn heranreift, braucht Lars die entsprechenden Erfahrungen, damit er seine Lesekompetenz weiterentwickeln kann. Bei Patrick verläuft die Kurve des Entwicklungspotenzials (blau) viel flacher als bei Lars. Dementsprechend fällt bei ihm auch die Spannung geringer aus. Diese Spannung zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand der Lesekompetenz und dem neurobiologischen Entwicklungsstand nehmen wir als Neugierde war. Das Kind erlebt den Abbau der Spannung als sogenannte Flow-Erfahrung: Es geht vollkommen in seiner Tätigkeit auf und erlebt dabei eine tiefe Befriedigung (Csikszentmihalyi 1990). Lars und Patrick suchen, jeder auf seine Weise, immer wieder neue Erfahrungen, um die Spannung abzubauen. Dabei sind es nicht beliebige Erfahrungen, sondern solche, die bezüglich Wortwahl und Wortschatz, Komplexität der Satzkonstruktion sowie inhaltlicher Aussagen leicht über ihrer aktuellen Lesekompetenz liegen. Idealerweise stimmen der Entwicklungsstand und das Leseangebot diesbezüglich möglichst gut und oft überein. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Neugierde können wir bei einem Kind wecken, wenn wir ihm ein Angebot machen, das im Bereich seiner Lesekompetenz oder – noch besser – leicht darüber liegt. Je besser ein Kind lesen kann, desto weniger wichtig ist der Lesevorgang an sich und desto wichtiger wird die inhaltliche Aussage des Textes. Bei Lars ist es schon bald der Inhalt, der den Reiz des Lesens ausmacht, bei Patrick hingegen bleiben es noch für lange Zeit die formalen Herausforderungen des Lesens.
Und wenn die Neugierde ausbleibt? Was geschieht mit einem Kind wie Patrick, das desinteressiert und widerwillig in der Schulbank sitzt, während Eldar nebenan bereits ganze Sätze liest? Die Neugierde kann ausbleiben, wenn ein Kind über- oder unterfordert wird. Nehmen wir an, Patrick, Eldar und Lars sind alle 10 Jahre alt und besuchen die gleiche Klasse (Abbildung 18). Die Lehrerin orientiert sich am Durchschnitt der Klasse, zu dem Eldar gehört. Sie gibt der Klasse also einen Text, den Eldar gut lesen kann. Damit hat er ein Erfolgserlebnis. Nicht so Lars, der solche Texte bereits mit 8 Jahren gelesen hat. Er langweilt sich und ist unterfordert. Er kann sich anpassen und sich ruhig verhalten, vielleicht ist er aber auch frustriert und wird verhaltensauffällig. Patrick wiederum ist hoffnungslos überfordert. Er wird diesen Text erst im Alter von 16 Jahren verstehen, 8 Jahre später als Lars und 6 Jahre später als Eldar. Auch bei Patrick können sich Überforderung und Frustrationen in Form von Verhaltensauffälligkeiten oder psychosomatischen Symptomen äußern. Die Unterforderung bei Lars und die Überforderung bei Patrick wirken sich zusätzlich negativ aus, indem sie ihre Lernmotivation und ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Die Lernmotivation wird dann gestärkt und das Selbstwertgefühl bestätigt, wenn Anforderungen und Kompetenz des Kindes so weit übereinstimmen, dass das Kind in seinen Lernbemühungen zumeist erfolgreich ist. Selbstverständlich gibt es noch weitere Gründe, weshalb ein Kind keine Neugierde und kein Interesse zeigen kann, zum Beispiel wenn es unter den partnerschaftlichen Spannungen seiner Eltern leidet oder wenn es sich von den anderen Kindern abgelehnt fühlt (siehe dazu Teil III).
Nun gibt es Kinder, die deshalb kaum lesen, weil sie aus einer bildungsfernen Familie stammen. Kann man solchen Kindern durch Nachhilfe auf die Sprünge helfen?
Gehen wir davon aus, Eldar stamme aus einer solchen Familie. Seine Eltern können kaum lesen, da sie selbst nur wenige Jahre oder gar nicht in die Schule gegangen sind. Bücher gibt es bei ihnen zu Hause nicht, und so hat Eldar bis zu seinem ersten Schultag kaum Buchstaben gesehen. Zwischen 7 und 8 Jahren verläuft seine Entwicklungskurve (grün) deutlich unter jener seines Entwicklungspotenzials (rot) (Abbildung 19). Dann beginnt Eldar, sich vermehrt für das Lesen zu interessieren, und die Lehrerin unterstützt ihn dabei. Seine Lesekompetenz nimmt überdurchschnittlich rasch zu, und mit 10 Jahren erreicht er sein Entwicklungspotenzial.
Da wird aber mancher Lehrer einwenden, es lasse sich bei Weitem nicht so rasch mit intensiver Betreuung aufholen, was in der Vorschule verpasst wurde.
Das stimmt. Es kommt leider vor, dass Kinder wie Eldar sich auch im Vorschulalter nur ungenügend entwickeln konnten. Ihre sprachlichen Voraussetzungen sind daher bei Schuleintritt ungenügend und verbessern sich nur beschränkt im Laufe der Schulzeit. So kann es geschehen, dass die Entwicklungskurve seiner Lesekompetenz deutlich unter seinem Entwicklungspotenzial bleibt (gestrichelte Kurve). In welchem Ausmaß ein Kind aufholen kann, hängt von seiner bisherigen Entwicklung, seinem Alter und der Unterstützung ab, die es bekommt.
Wie können Eltern und Lehrer feststellen, ob ein Kind sein Potenzial ausgeschöpft hat oder doch noch Steigerungsmöglichkeiten bestehen?
Für Lehrkräfte und Eltern ist das ein kritischer Punkt. Sie wollen das Kind ja bestmöglich fördern und neigen deshalb dazu, es zu überfordern und somit seine Lernmotivation zu beeinträchtigen. Abbildung 20 beschreibt die Lernkurve, beispielsweise beim Lesen, bei einem Kind in einem bestimmten Alter. Die Lernkurve steigt anfänglich rasch an, das Kind lernt rasch mit wenig Erfahrung. Wenn sich die Lernkurve dem Entwicklungsstand annähert, wird die Lernkurve flacher, und auch viel zusätzlicher Aufwand bringt keine wesentliche Zunahme an Kompetenz. Schließlich wird die Fördergrenze erreicht. Über den Entwicklungsstand hinauszugehen ist dem Kind nicht möglich.Neugierde und Flow-Gefühl verhalten sich spiegelbildlich zu der Lernkurve.Es gibt 4 Anhaltspunkte, die das Erreichen der Fördergrenze anzeigen:
• Der Fortschritt verlangsamt sich nach einer Phase beschleunigter Entwicklung (Abbildung 19, grüne Kurve).
• Der Fortschritt nimmt trotz verstärktem Aufwand immer mehr ab und bleibt schließlich ganz aus (Überforderung).
• Das Kind wird zunehmend lustlos, und seine spontane Lernbereitschaft geht verloren.
• Die Lernbereitschaft kehrt zurück, wenn beim demotivierten Kind die Anforderungen an seinen Entwicklungsstand angepasst werden.
Das vorgegebene Entwicklungspotenzial eines Kindes zu akzeptieren und die eigenen Erwartungen dem Kind anzupassen ist eine Herausforderung für Eltern und Lehrer. Für das Kind bedeutet es jedoch eine große emotionale Entlastung und ist wesentlich für seine Entwicklung, weil nur so seine Lernfreude zurückkehren und auch erhalten bleiben wird.
Unter welchen Bedingungen Üben und Fördern sinnvoll sind
Wir kommen zu einer Frage, die schon Generationen von Lehrern, Eltern und Kindern aufgebracht hat: Was bringt das Üben? Gilt die alte Weisheit nicht mehr, dass es die Übung ist, die den Meister macht?
Kinder sind Weltmeister im Üben. Alle Kinder üben neu erworbene Fähigkeiten aus innerem Antrieb heraus, wie freies Gehen, selbstständiges Essen, Ballspielen oder Lesen. Dieser Antrieb entsteht wie die Neugierde aus der oben erwähnten Spannung. Das vom Kind bestimmte Üben verläuft jedoch nicht monoton, sondern spielerisch variabel. Es dient dazu, Abläufe und Erfahrungen zu verinnerlichen und neue Fähigkeiten mit den bereits vorhandenen zu verbinden. Kinder wollen Erfahrungen machen, lustvoll und freiwillig, aber nur dann, wenn sie aufgrund ihrer Entwicklung das Bedürfnis danach haben und es selbstbestimmt tun dürfen. Wir Erwachsene können und sollten Angebote machen, sollten aber nicht insistieren, wenn das Kind kein Interesse zeigt. Kinder mögen es nicht, etwas üben zu müssen, für das sie noch nicht bereit sind oder aber das sie bereits beherrschen. Im ersten Fall ist die Spannung der Neugierde darauf noch nicht entwickelt, im zweiten ist sie bereits abgebaut.
Gibt es keinen Unterschied zwischen dem Einübenwollen des Gehens, das eine evolutionsgeschichtliche Entwicklung von mehreren Millionen Jahren hinter sich hat, und dem Lesenwollen, einer Kulturtechnik, die lediglich 3000 Jahre alt ist?
Nein, aus meiner Sicht gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied.
Die Neugierde ist also ein wichtiges Merkmal echten Lernens. Kann man nicht dennoch sagen, dass man etwas erst dann begreift, wenn man es ausreichend geübt hat?
Neubauer und Stern (2007) schreiben: „...für das Lernen im Säuglingsalter bis zum Lernen im Greisenalter gilt: Erfolgreiches Lernen findet statt, wenn eingehende Information an bestehendes Wissen angebunden wird.“ Diese Feststellung schließt nahtlos an unser Verständnis von genuiner Motivation und Neugierde an. Wer weiß Bescheid über den Stand des Wissens und der Fähigkeiten eines Kindes? Nur das Kind selbst. Wir können es wahrnehmen in seinem Neugierverhalten und dem Willen, bestimmte Erfahrungen zu machen. Das ist wiederum eine der großen pädagogischen Herausforderungen: das Kind richtig zu lesen, um herauszufinden, wo es steht und welche Erfahrungen es machen will. Wirkliches Verstehen bedeutet, dass das Kind nicht einfach Informationsklumpen memoriert, sondern sich Wissen und Fähigkeiten aneignet, die es mit seinem bestehenden Wissen vernetzen kann (Abbildung 21). Diese Vernetzung kann das Kind nur leisten, wenn es den Lernprozess selbst bestimmt. Es erweitert seinen Zahlenraum, indem es von seinem aktuellen Zahlenverständnis ausgehend mit Zahlen experimentiert und das neu erworbene Verständnis in seinen Zahlenraum einfügt. Wissen, das nur auswendig gelernt ist, und Fertigkeiten, die nur eingeübt sind und nicht mit bestehendem Wissen und bestehenden Fähigkeiten vernetzt sind, werden rasch wieder vergessen, was leider in der Schule nur allzu oft geschieht.
Gibt es also gutes Üben und schlechtes Üben?
In einer gewissen Weise schon. Mit Üben können wohl Bewegungs- oder Handlungsabläufe beschleunigt werden, und mit Auswendiglernen kann Wissen vorübergehend aufgenommen werden. Beides führt aber nicht zum Begreifen. Üben und Auswendiglernen, welche sich nicht am Entwicklungsstand des Kindes orientieren, beeinträchtigen letztlich auch die Lernmotivation und das Selbstwertgefühl. Dies zu vermeiden und dem Kind stattdessen ein entwicklungsgerechtes Angebot zu machen ist pädagogisch anspruchsvoll. Patrick will mit 10 Jahren lesen, aber eben auf seine Weise und so, dass er ein Erfolgserlebnis hat. Ist der Text zu anspruchsvoll, wird er sich verweigern. Geht Patrick jedoch spontan darauf ein, liegt man mit dem Angebot richtig.
Eltern und Lehrer versuchen häufig, das Verständnis des Kindes zu wecken, indem sie logisch argumentieren. Ist auch dies vergebliche Liebesmüh?
Selbst wir Erwachsenen lernen noch mehrheitlich unbewusst. Wenn wir Autofahren lernen, eignen wir uns theoretisches Wissen darüber an, wie ein Auto funktioniert. Um es aber zu beherrschen, reichen diese Kenntnisse nicht aus. Also müssen wir den Wagen fahren und konkrete Erfahrungen beim Lenken, Beschleunigen und Bremsen machen. Diese Form des Lernens durch aktives Handeln und Erleben ist in der Kindheit die vorherrschende. Dieses Lernen entgeht uns aber zum großen Teil und wird unterschätzt, weil es nicht durch rationale Überlegungen bestimmt wird, sondern unbewusst abläuft. Abstrakte Einsichten und darauf basierendes Handeln, die uns Erwachsenen einleuchten, bleiben für Kinder sehr lange unverständlich und sind daher für sie auch nicht anwendbar. Sie werden für die meisten Kinder erst nach dem 10. Lebensjahr bedeutsam. Dazu gehören beispielsweise in der Sprache ein Verständnis für Grammatik und Syntax oder in der Mathematik für Formeln und Algebra.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Es gibt ein berühmtes Beispiel von Jean Piaget, das den Unterschied zwischen konkretem und abstraktem Lernen deutlich macht: Der Inhalt eines rechteckigen Behälters lässt sich nach der Formel „Volumen = Länge × Breite × Höhe“ berechnen. Diese Formel verstehen Kinder erst, wenn sie ausreichend konkrete Erfahrungen mit diesen Größen machen konnten. Bis ins frühe Schulalter haben sie eine unzureichende Vorstellung von der Konstanz von Mengen und Volumina (Piaget 1975). Sie gehen davon aus, dass Flüssigkeitsmengen, deren Flüssigkeitsspiegel unterschiedlich hoch sind, auch unterschiedlich groß sind (Abbildung 22). Sie berücksichtigen bei ihren Überlegungen nur die Höhe des Flüssigkeitsstandes, nicht aber die beiden anderen Dimensionen, die das Flüssigkeitsvolumen mitbestimmen. Zu einem Verständnis für die Raumdimensionen kommen Kinder, wenn sie sich durch wiederholtes Umgießen der Flüssigkeiten mit der Beziehung zwischen Form und Inhalt von Gefäßen praktisch auseinandergesetzt haben. Erst wenn sie durch diese Erfahrungen zu der Einsicht gekommen sind, dass Höhe, Breite und Tiefe der Gefäße gleichermaßen von Bedeutung sind, begreifen sie auch die abstrakte Aussage, dass das Volumen von Flüssigkeiten und Gefäßen aus dem Produkt von Länge, Breite und Höhe berechnet werden kann. Ein solcher Lernprozess lässt sich durch Belehrungen der abstrakten Art oder das Auswendiglernen der Formel nicht abkürzen. Erwachsene unterschätzenhäufig das Ausmaß an Erfahrungen, die Kinder machen müssen, bis sie einen abstrakten Zusammenhang wirklich verstanden haben. Dabei ist die Anzahl an Erfahrungen, die dazu notwendig ist, bei jedem Kind anders. Das Kind sollte daher die Vorgehensweise und das Ausmaß der Erfahrungen so weit wie möglich selbst bestimmen dürfen.
Was die frühkindliche Förderung bewirkt
Die Neurowissenschaften haben sich in den letzten Jahren intensiv mit Themen wie Entwicklung und vor allem mit dem Lernen beschäftigt. Mittlerweile hat sich ein Forschungszweig „Neurodidaktik“ gebildet, und man liest Inserate wie: „Das Genie in Ihrem Kind! Hirnforscher zeigen Eltern, wie sie sein Talent entdecken und fördern können.“ Was haben die Neurowissenschaften aus Ihrer Sicht bislang zum Verständnis des Kindes beziehungsweise des Schulkindes beigetragen?
Der technische Fortschritt in den Neurowissenschaften ist beachtlich. Gewisse Hirnfunktionen können mithilfe von bildgebenden Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanz-Untersuchung seit einigen Jahren dargestellt werden. Diese farbigen Darstellungen haben für Laien und manche Fachleute etwas Faszinierendes, weil sie geistige Funktionen und emotionale Befindlichkeiten sichtbar machen. Eine solche aufsehenerregende Beobachtung war, dass Nervenzellen, sogenannte Spiegelneuronen, das Verhalten eines Menschen im Gehirn anderer Menschen „spiegeln“ können. Das heißt, Handlungen und Gefühle eines Menschen werden im Gehirn des beobachtenden Gegenübers gewissermaßen nachgeahmt und damit nachvollzieh- und spürbar gemacht (Buccino et al. 2004, Bauer 2006). Gleichwohl stimme ich mit der Lernforscherin Elsbeth Stern und der Erziehungswissenschaftlerin Nicole Becker überein, die die meisten Erkenntnisse der Neurodidaktik entweder für relativ banal oder so allgemein halten, dass sie für den Schulunterricht kaum eine Einsicht bringen, die erfahrene Pädagogen nicht schon längst von sich aus gemacht haben (Stern 2004; Becker 2005). Die Neurowissenschaften sind beispielsweise noch weit davon entfernt, die individuelle Vielfalt bestimmter Funktionen bei Kindern zuverlässig darstellen zu können. So vermögen sie nicht zu bestimmen, ob ein normal entwickeltes Kind sehr gut oder fast gar nicht lesen kann oder ob es motorisch mehr oder weniger geschickt ist. Bei einem Kind mit Legasthenie oder motorischer Ungeschicklichkeit sind für mich die Beobachtungen einer erfahrenen Lehrerin noch immer weit informativer als jede noch so aufwendige neurobiologische Untersuchung.
Neurowissenschaftler wie Manfred Spitzer oder Lutz Jäncke weisen in ihren Arbeiten regelmäßig darauf hin, dass das Gehirn das „Protokoll seiner Benutzung“ ist und quasi umso leistungsfähiger wird, je intensiver man es trainiert (Jäncke 2008, Spitzer 2002). Ist folglich die Entwicklungsfähigkeit des Gehirns nach oben hin offen?
Ich bin wie bereits erläutert nicht dieser Meinung. Mich stört diese Argumentation insbesondere, wenn sie suggeriert, dass alles möglich ist, wenn man es nur richtig anstellt und lange genug übt. In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff „Plastizität“ bemüht. Er besagt, dass nicht alles in der Hirnentwicklung von vornherein festgelegt ist, sondern durch Erfahrungen mitbestimmt wird, was ja auch richtig ist. Manche Fachleute und Therapeuten neigen jedoch dazu, solche Äußerungen kritiklos zu übernehmen und bei den Eltern Hoffnungen zu wecken, die sich nie erfüllen werden. Ich werde von meiner skeptischen Haltung erst abrücken, wenn gut kontrollierte Studien überzeugend nachgewiesen haben, dass man Kinder tatsächlich über ihr Entwicklungspotenzial hinaus fördern kann.
Manche Erziehungsoptimisten beharren jedoch darauf, dass jedes Kind beliebig gefördert werden kann und sein Entwicklungsstand nur eine Frage der Umweltanreize oder Ressourcen ist, die in ein Kind investiert werden.
Dieser Optimismus rührt von den Erfahrungen her, die mit vernachlässigten Kindern gemacht worden sind, beispielsweise mit Waisenkindern in den 1990-er Jahren nach dem Sturz des Ceaus¸escu-Regimes in Rumänien (Rutter 2002). Ein Teil dieser Kinder, obwohl schwer vernachlässigt und körperlich stark geschwächt, hat mit emotionaler Zuwendung, entwicklungsgerechter Anregung und ausreichender Ernährung seinen schweren Entwicklungs- und Wachstumsrückstand in erstaunlichem Ausmaß aufgeholt. Unterernährte Kinder können ihre Wachstumsverzögerung kompensieren, wenn sie ausreichend ernährt werden. So verhält es sich auch mit der Entwicklung. Werden dem Kind Erfahrungen vorenthalten, dann entwickelt es sich entsprechend langsamer. Ermöglicht man ihm die notwendigen Erfahrungen, kann es aufholen. Die Grenzen der Entwicklung setzt das eigene Entwicklungspotenzial. Je weiter das Kind von seinem eigenen Potenzial entfernt ist, umso mehr kann es an Entwicklung aufholen, immer vorausgesetzt, dass seine Entwicklung nicht allzu fortgeschritten und sein Gehirn nicht bleibend geschädigt worden ist (siehe Kapitel Anlage und Umwelt).
Gerade für Kleinkinder existiert mittlerweile ein gigantisches Förderangebot. Es gibt DVD-Lernprogramme mit bezeichnenden Titeln wie „Baby-Einstein“ und „Baby-Van Gogh“. In den USA versuchen Eltern mit sogenannten „Hothousing“-Programmen (Treibhauseffekt), ihre Kinder möglichst früh und intensiv zu fördern, um ihnen maximale schulische Chancen zu sichern. Ist das einfach nur kostspielige Betriebsamkeit, oder haben diese Programme nicht doch einen stimulierenden Effekt auf die Kinder?
Es gibt ein wunderbares afrikanisches Sprichwort, das alles auf den Punkt bringt: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ein Kind lässt sich nicht „machen“. Es lässt sich nicht je nach Bedarf von den Eltern in eine bestimmte Form kneten. Der Glaube, ein Kind entwickle sich umso erfolgreicher, je früher man es mit Förderprogrammen füttert, basiert auf einem verhaltensbiologischen Irrtum. Das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus, solange sein körperliches und psychisches Wohlbefinden gewährleistet ist und es die notwendigen entwicklungsspezifischen Erfahrungen machen kann. Wie ich schon sagte: In diesem Prozess ist das Kind nicht nur aktiv, sondern auch selektiv. Das heißt, es sucht sich die Erfahrungen selber aus, die an sein Verständnis anknüpfen und es vergrößern.
Muss man bei dieser Förderwut im Grunde von einer Irreführung der Eltern und einem Missbrauch der Kinder sprechen?
In den USA boomen Kurse für Schwangere, in denen das Kind mit klassischer Musik beschallt wird, vorzugsweise mit Mozart, um dann besser für die Schule gerüstet zu sein. Oder es werden Spielsachen verkauft, die Form-, Farb- und Größenwahrnehmung der Kinder fördern sollen. Hier werden einzig elterliche Ängste für kommerzielle Zwecke ausgebeutet. Die Kinder werden dadurch nicht klüger. Der Mozart-Effekt wurde mit einem Artikel in der renommierten Zeitschrift Nature widerlegt, der den sinnigen Titel trug: „Mozart doesn’t make you clever.“ (Abbott 2007). Es gibt keine Studie, welche die Wirksamkeit von „Hothousing“ belegen würde. Vielmehr muss man sich fragen, ob derartige Programme nicht mehr schaden als nützen, denn im schlechtesten Fall zerstören sie die natürliche Lernmotivation und das Selbstwertgefühl des Kindes. Viele Erwachsene haben insgeheim die Befürchtung, das Kind werde nichts lernen ohne ihr maßgebliches Zutun. Doch dem ist nicht so. Das Kind entwickelt sich aus sich heraus. Und so wird oft trotz der gut gemeinten, aber nicht kindgerechten Bemühungen der Erwachsenen dennoch etwas Gutes aus dem Kind. Eltern und Lehrer sollten in dieser Hinsicht ruhig etwas mehr Vertrauen in ihre Kinder haben.
Warum die Orientierung an Defiziten falsch ist
Es ist ja gerade auch die Schule, die namentlich die teilleistungsschwachen Schüler mit verschiedensten Maßnahmen zu fördern versucht. Klingt es da nicht zynisch für Lehrer, Eltern und die betroffenen Kinder, wenn man mehr Vertrauen in die Selbstentwicklungskräfte der Kinder verlangt?
Im Gegenteil. Das Problem ist die ausgeprägte Defizitorientiertheit unserer Gesellschaft. Defizite sollen möglichst früh erfasst und therapiert werden, mit dem Anspruch, dass sie auch behoben werden. Eine Legasthenie lässt sich aber nicht wegtherapieren. Es gibt nicht wenige Erwachsene mit Legasthenie, die während der Schulzeit durch Unterricht und Therapie so traumatisiert wurden, dass sie ein Leben lang darunter leiden. Defizite wie eine Lese- oder Rechenschwäche können nicht einfach ausradiert werden. Eine falsch verstandene Therapie kann das Defektbewusstsein sogar verstärken. Was das Kind vielmehr braucht, ist eine Unterstützung, die ihm hilft, mit der Teilleistungsschwäche umzugehen und seine beschränkten Kompetenzen möglichst gut zu nutzen. Und es soll lernen, seine Leseschwäche zu akzeptieren. Dazu muss aber auch sein soziales Umfeld bereit sein, damit das Kind nicht zusätzlich verunsichert und sein Selbstwertgefühl möglichst wenig beeinträchtigt wird. Diese Argumentation sollte nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass jegliche Form von Hilfeleistung zu unterlassen sei. Das Kind braucht – wie oben ausgeführt – Unterstützung, aber keine Therapie, die den Anspruch hat, ein Defizit zu beheben und das Kind zu „normalisieren“.
Woher rührt diese Defizitorientiertheit?
Diese Einstellung mag einerseits ein Überbleibsel der autoritären Erziehungshaltung sein, die sich der Aufgabe verschrieben hatte, alles Böse und Schwache auszumerzen. Sie ist aber vor allem Ausdruck einer sehr leistungs- und wettbewerbsorientierten Lebenshaltung. Unser ganzes Schulsystem ist noch immer sehr defizitorientiert. Lernschwächen stellen für den Lehrer die Lernziele und gegebenenfalls ihn selbst infrage und für die Eltern gar die Zukunft ihrer Kinder. So bestimmen nicht die guten Noten die Schulkarriere eines Kindes, sondern die schlechten. Warum eigentlich? Wir Erwachsenen verstecken unsere Schwächen und sind erfolgreich mit unseren Stärken. Doch bei unseren Kindern lassen wir das nicht zu. Es wäre doch viel sinnvoller, ihre Stärken zu fördern, anstatt auf ihren Schwächen herumzureiten. Die Stärken bestimmen ihre Zukunft.
Das Wichtigste für die Schule
1. Formen des Lernens:
• Soziales Lernen. Das Kind eignet sich Verhalten durch Nachahmung an. Dazu braucht es Vorbilder.
• Lernen durch Erfahrung mit der gegenständlichen Umwelt. Die gegenständliche Umwelt lernt das Kind mit seiner Motorik und seinen Sinnen kennen und verstehen, indem es sich selbstständig mit ihr auseinandersetzt.
• Lernen durch Unterweisung. Die Unterweisung dient dazu, das Lernangebot in Form und Inhalt den entwicklungsspezifischen Interessen des Kindes anzupassen und das Kind in seinem Lernverhalten zu unterstützen.
2. Das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus, wenn sein körperliches und psychisches Wohlbefinden gewährleistet ist und es die notwendigen entwicklungsspezifischen Erfahrungen machen kann.
3. Die Spannung zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes und dem Bedürfnis nach neuen Erfahrungen nehmen wir als Neugierde wahr.
4. Echtes Lernen setzt voraus, dass Erfahrungen mit bestehendem Wissen und bereits vorhandenen Fähigkeiten vernetzt werden können.
5. Lernen durch aktives Handeln und Erleben ist in der Kindheit vorherrschend. Dieses Lernen läuft weitgehend unbewusst ab und wird nicht durch rationale Überlegungen geleitet.
6. Idealerweise werden dem Kind Erfahrungsmöglichkeiten angeboten, die seinem Entwicklungsstand entsprechen und die es selbstständig nutzen kann.
7. Über- und Unterforderung sollen möglichst vermieden werden, damit Lernmotivation und Selbstwertgefühl des Kindes erhalten bleiben.
8. Das Kind wird nicht umso klüger, je intensiver man mit ihm übt. Ein Kind lässt sich nicht „machen“. Es lässt sich nicht wie ein Gefäß beliebig mit Inhalt füllen.
9. Durch Üben können Bewegungsabläufe beschleunigt und Verhaltensweisen angepasst werden. Mit Üben und Auswendiglernen kann man dem Kind – im Sinne von Begreifen – aber nichts beibringen, wozu es nicht selber bereit ist. Üben und Auswendiglernen führen nicht zum Verstehen.
10. Der Glaube, ein Kind entwickle sich umso erfolgreicher, je früher man es mit Förderprogrammen füttert, basiert auf einem verhaltensbiologischen Irrtum.
Lernmotivation
Wie gute Lernmotivation entsteht
Ein Schweizer Sekundarlehrer beschrieb bei seiner Pensionierung nach 40 Jahren Schuldienst seine Auffassung von Unterricht folgendermaßen: „In erster Linie muss Schule Arbeit sein. Wissen muss erarbeitet werden. Auch mit Üben. Eine gute Schule ist anstrengend und darf auch einmal langweilig sein. Die Schule sollte selektiver werden und wieder höhere Anforderungen stellen und sich nicht mehr damit abfinden, dass ein Schüler in einem bestimmten Fach nicht über eine ungenügende Note hinauskommt. Wir brauchen einen insistierenden Unterricht. Schüler sitzen nach und lösen die Aufgaben unter Aufsicht noch einmal, bis ihre Leistung den Anforderungen genügt oder bis eine zumutbare Anstrengung erbracht ist.“ (Müller 2006) In der Öffentlichkeit stieß dieser Lehrer damit auf breite Zustimmung.
Ein solcher Lehrstil war lange Zeit weit verbreitet und wird auch heute noch praktiziert. Für mich ist das jedoch keine kindgerechte Pädagogik, weil sie sich nicht an den emotionalen Bedürfnissen der Kinder orientiert. Goethe sagte vor 250 Jahren: „Das Kind lernt nur von denjenigen, die es liebt.“ Ich halte diese Auffassung für brandaktuell, weil das Kind ein zutiefst soziales Wesen ist. Sich geborgen und angenommen zu fühlen ist in jedem Alter die Grundvoraussetzung zum Lernen (siehe Teil II Bindungsverhalten). Damit sich Kinder unterweisen lassen und lernen wollen, muss eine vertrauensvolle Beziehung zum Lehrer bestehen. Gelingt es dem Lehrer, eine solche Beziehung zu den Schülern herzustellen, dann sind diese auch bereit, auf sein Lernangebot einzugehen und sich auf ihn auszurichten. So fühlt sich auch der Lehrer von Schülern und Eltern als Person und mit seiner Art des Unterrichtens akzeptiert.
Es gibt immer wieder Eltern und Lehrer, die davor warnen, zu viel zu loben. Das Kind würde davon träge und strenge sich nicht mehr an.
In unserer Kultur sind wir überaus zurückhaltend mit dem Loben – im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern. Natürlich soll man nicht grundlos und überschwänglich loben, doch jedes Kind erwartet Lob und Anerkennung für seine Leistung. Lob wird leider häufig zweckentfremdet, indem mit Lob sichergestellt werden soll, dass die Leistung erhalten bleibt und das Kind zu noch mehr Leistung angespornt wird. Ehrliches Lob sollte weniger der Leistung an sich gelten als vielmehr der Anstrengung, die das Kind erbracht hat. Damit es sich wirklich angenommen und geborgen fühlt, braucht das Kind jedoch viel mehr als nur Lob. Sich geborgen und angenommen fühlen meint – im Sinne Goethes – nicht die Leistung, sondern die Person. Wenn das Kind spürt: Der Lehrer mag mich, unabhängig von meiner Leistung, dann kann es auch gut lernen.
Bezüglich Lernmotivation haben Sie Ihre eigenen Vorstellungen, die sich deutlich von der klassischen Lernpsychologie unterscheiden, welche diesem „inneren Drang zum Lernen“ weit weniger Gewicht beimisst. Worauf gründen Ihre Vorstellungen?
Meine Vorstellungen über die Lernmotivation weichen tatsächlich etwas von denjenigen der klassischen Lernpsychologie ab. Dabei beruhen meine Erfahrungen vor allem auf Untersuchungen in den ersten Lebensjahren (Largo 2007). Bei kleinen Kindern ist es methodisch wesentlich einfacher, das Lernverhalten zu untersuchen, als bei Kindern im Schulalter, bei denen die Lernbereitschaft oft bereits von negativen Erfahrungen überlagert oder sogar verschüttet worden ist. Die Vorstellungen, die ich vertrete, sind meines Erachtens jedoch nicht nur für das Vorschulalter gültig, sondern für die ganze Kindheit. Ich gehe von den folgenden inneren und äußeren Motivationsquellen aus:
• Emotionale Sicherheit. Das Kind muss sich geborgen und angenommen fühlen, damit es lernen kann.
• Genuines Lernen. Jedes Kind will Erfahrungen machen, weil es diese braucht, um sich überhaupt entwickeln zu können. Diese Lernbereitschaft ist der eigentliche Motor der Entwicklung und damit weitaus die wichtigste Motivation. Ohne sie würde das Kind weder laufen noch sprechen oder schreiben lernen. Diese innere Motivation zum Lernen, erkennbar als Neugierde, wird von der individuellen Anlage und dem Verhältnis zwischen Entwicklungsstand und Erfahrungsmöglichkeiten bestimmt (Teil I Lernverhalten).
• Lernen durch Verstärkung. Das Kind wird durch Lob und Zuwendung in seinem Lernen bestärkt beziehungsweise durch Kritik und Androhung negativer Folgen wie Strafe von bestimmten Verhaltensweisen abgehalten. Diese Motivationsform wurde in den vergangenen Jahren wieder vermehrt angepriesen. Sie ist ein zentrales Element des Behaviorismus und verschiedenster Lerntheorien, die sich darauf beziehen (Watson 1930).
• Lernen durch sozialen Wettbewerb. Das Kind steht im Wettbewerb mit den anderen Kindern. Diese Form des Lernens ist in der Schule häufig. Dabei spielt die Art der Beziehungen unter den Kindern eine bedeutsame Rolle.
Die genuine Bereitschaft zum Lernen scheint mir von allen Motivationsformen die wichtigste zu sein. Die anderen Motivationsformen reichen bei Weitem nicht aus, um die immense Lernbereitschaft von Kindern zu erklären. Dies gilt ganz besonders für das Vorschul- und das frühe Schulalter. Deshalb ist es auch so wichtig, auf den individuellen Entwicklungsstand eines Kindes einzugehen.
Warum selbstbestimmtes Lernen sinnvoll ist
Sie sagen, dass das Kind selbstbestimmt lernen soll, damit es aktiv und selektiv in seinem Lernverhalten sein kann. Selbstbestimmung setzt aber voraus, dass es Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Ab wann ist ein Kind dazu in der Lage? Droht ihm nicht eine Überforderung, wenn es über sich selber bestimmen soll?
Hinter dieser Frage steckt ein Misstrauen dem Kind gegenüber. Man traut ihm nicht zu, dass es kompetent sein kann. Dabei ist bereits ein Säugling in manchen Bereichen kompetent, zum Beispiel was die Nahrungsaufnahme betrifft. Deswegen sollten die Eltern nicht über das Kind bestimmen und ihm eine bestimmte Nahrungsmenge aufzwingen. In vielen anderen Bereichen ist der Säugling nicht kompetent, da müssen die Eltern die Verantwortung übernehmen. In den folgenden Jahren wachsen die Kompetenzen des Kindes. Überall dort, wo sie noch zu gering sind, müssen die Eltern und Lehrer für das Kind entscheiden. Seien wir doch ehrlich: In den ersten 5 Lebensjahren wird dem Kind das wenigste von uns Erwachsenen beigebracht. Das meiste eignet es sich selber an. Wir sprechen wohl mit dem Kind; dass es verstehen und sprechen lernt, ist aber seine eigene Leistung. Selbstbestimmtes Lernen heißt, dass die notwendigen Lernerfahrungen dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst sind und dass das Kind sich aktiv damit auseinandersetzen kann. Nur so kann das Kind das frisch Gelernte mit seinem bestehenden Wissen vernetzen. Mit dem selbstbestimmten Lernen entwickelt das Kind auch seine eigenen Lernstrategien. Versucht ein 18-monatiges Kind zum Beispiel, Bauklötze zu einem Turm aufzuschichten, benötigt es vielleicht 10 Versuche. Das sollten ihm die Eltern auch keinesfalls abnehmen in dem irrigen Glauben, sie würden ihm damit einen Gefallen tun, oder es anleiten, wie das zu bewerkstelligen sei. Beim 11. Versuch hat es das Kind von alleine geschafft und damit einen Weg gefunden, um das Problem zu lösen. Dabei hat es auch gelernt, welche Vorgehensweisen zum Ziel führen und welche nicht. Am Ende hat es ein Erfolgserlebnis, ein gutes Selbstwertgefühl und auch die Motivation, das nächste Problem mit gutem Selbstvertrauen und neuen Lernstrategien anzugehen. „Alles, was wir dem Kind beibringen, kann es selber nicht mehr lernen.“ Der Satz von Jean Piaget hat immer noch seine Gültigkeit.
Doch lässt sich das Lernen bei einem Kleinkind so ohne Weiteres auf das schulische Lernen übertragen? Ist seine Lernmotivation nicht völlig anders als diejenige eines 8- oder 12-jährigen Schülers?
Die Prinzipien des erfolgreichen Lernens sind altersunabhängig. Das Kind hat in jedem Alter eine angeborene Neugier, es will von sich aus lernen und Fortschritte machen. Ich habe noch kein Kind gesehen, das nicht lernen will, sofern – und das ist vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen die Grundvoraussetzung zum Lernen – die Anforderungen seinem Entwicklungsstand angepasst sind.
Die meisten Kinder treten freudig und motiviert in die erste Schulklasse ein. Nach ein paar Jahren sind viele frustriert, demotiviert und passiv geworden. Warum?
Weil sie fremdbestimmt lernen müssen. Es wird ihnen vorgeschrieben, was und wie sie zu lernen haben. Fremdbestimmung lähmt die Eigeninitiative und birgt das Risiko der Unter- und vor allem der Überforderung eines Kindes. Die Lernmotivation wird zerstört, wenn ein Kind in der Schule jahrelang die Erfahrung macht, dass es den eigenen Ansprüchen und jenen des Lehrers nicht genügen kann. Es wird zunehmend desinteressiert, frustriert und verweigert schließlich seine Teilnahme am Unterricht. Die Leistung bleibt aus und das Selbstwertgefühl verschlechtert sich, was wiederum die Lernmotivation beeinträchtigt – ein Teufelskreis.
Was macht Sie so sicher, dass ein Kind ausgerechnet lesen, schreiben und rechnen und nicht etwas ganz anderes lernen will, wenn es selbst darüber bestimmen kann, was es lernen will? Was machen Sie mit einem Kind, das überhaupt nicht lernen, sondern sich lieber mit Fußball oder Computerspielen beschäftigen will?
Diese Frage suggeriert, das Kind sei ein vergnügungssüchtiges Wesen, das sich nur am Lustprinzip orientiert. Doch jedes Kind will lesen und rechnen lernen – wenn es so weit ist. In der Grundstufe gibt es Kinder, die bereits mit 5 bis 6 Jahren lesen und rechnen wollen, andere sind noch nicht so weit und ziehen Zeichnen oder Fußballspielen vor. Die pädagogische Herausforderung für Eltern und Lehrer besteht darin, jenes Niveau an Anforderung zu eruieren, auf dem das Kind „anbeißt“. Häufig haben wir Erwachsenen zu hohe Erwartungen. Dann gilt es, das Niveau so weit zu senken, bis das Kind Interesse zeigt. Es gibt kein Alter und kein Niveau, auf dem dieses Prinzip nicht anwendbar ist. Die meisten Erwachsenen wären zum Beispiel in einer Physik-Vorlesung für Fortgeschrittene hoffnungslos überfordert und innerhalb kurzer Zeit so demotiviert, dass sie nicht mehr weiter zuhören würden. Wenn sich der Referent aber auf den Wissens- und Verständnisstand der Zuhörer einstellt, werden diese interessiert bleiben. Gut gemachte wissenschaftliche TV-Sendungen sind aus genau diesen Gründen bei den Zuschauern beliebt. Jeder Mensch hat ein individuelles Verständnisniveau, wo man ihn abholen und für eine Sache interessieren kann.
Trifft dies auch für ältere Schüler zu, die doch häufig wenig Interesse am Unterricht zeigen?
Auch auf solche Schüler ist das Prinzip anwendbar. So hat zum Beispiel ein Gymnasium in der Kleinstadt Wetzikon, das ursprünglich aus finanziellen Gründen gezwungen war, neue pädagogische Wege zu beschreiten (Wetzikon) und Personalkosten einzusparen, ein sogenanntes „Selbstlernsemester“ eingeführt. Die 17-jährigen Gymnasiasten müssen sich dabei ein halbes Jahr lang Deutsch, Mathematik, Chemie, Biologie, Sport und 2 Sprachen gemäß Lehrplan weitgehend selber beibringen. Nur gerade ein Mal pro Woche dürfen sie pro Fach beim zuständigen Lehrer Fragen stellen. Hier wird also weitgehend eine Schule ohne Lehrer praktiziert. Und was ist das Resultat? Es bricht keineswegs das Chaos aus, wie es anfangs vor allem viele Eltern der beteiligten Schüler befürchteten. Die Leistungen der Schüler bleiben zumindest gleich, während ihre Selbstlernfähigkeiten markant steigen. Die Schüler helfen sich überdies gegenseitig in Tutoraten. Offensichtlich sind sie auch ohne ständige Anwesenheit des Lehrers gut in der Lage, sich zu motivieren und etwas zu leisten. Dieser Versuch, der mittlerweile zum festen Programm der Schule gehört, zeigt: Selbstbestimmtes Lernen funktioniert auch in der Oberstufe. Nun möchte auch der Kanton Zürich das „selbst organisierte Lernen“ unter den Gymnasiasten fördern, weil sich gezeigt hat, dass viele Abiturienten überfordert sind, wenn sie sich auf den Universitätsbetrieb umstellen müssen (Oelkers 2008). Angestrebt werden nun sogenannte überfachliche Kompetenzen: Lernziele planen und umsetzen, sich organisieren, sich Wissen selbstständig aneignen, sich selber motivieren und mit Belastungen umgehen. Es ist schon merkwürdig: Da kommen die Kinder höchst motiviert und aktiv in die Schule, werden zur Passivität erzogen und müssen, bevor sie die Schule verlassen, wieder motiviert und aktiviert werden.
Gymnasien sind Spezialfälle, weil die Jugendlichen dort grundsätzlich lernbereiter und die Klassen vergleichsweise sozial homogener sind. In einer Berliner Hauptschulklasse mit 25 Schülern aus einem oftmals schwierigen familiären oder sozialen Umfeld dürfte so etwas kaum Erfolg haben.
Diese Lehrer und Schüler müssen etwas ausbaden, was aus verschiedenen Gründen leider seit vielen Jahren falsch gelaufen ist. Häufig waren diese Schüler bereits im Vorschulalter in ihrer Entwicklung benachteiligt, insbesondere bezüglich Sozialisierung und Sprache. In der Schule kommen sie deshalb oft nie richtig an. Sie fühlen sich nicht akzeptiert, erbringen nicht die ihnen mögliche Leistung, werden von ihrer Familie nicht unterstützt und dann auch noch von den Gleichaltrigen ausgegrenzt (siehe Teil III Bildungspolitik).
Das Wichtigste für die Schule
1. Damit das Kind lernen kann, muss es eine vertrauensvolle Beziehung zum Lehrer oder zur Lehrerin haben. Sich geborgen und angenommen fühlen ist eine Grundvoraussetzung für das Lernen.
2. Die Anforderungen sollten dem Entwicklungsstand angepasst sein. Kinder spüren sehr genau, wo ihre Stärken und Schwächen liegen.
3. Das Kind hat in jedem Alter eine angeborene Neugier. Es will von sich aus lernen und Fortschritte machen.
4. Selbstbestimmtes Lernen heißt, dass das Kind aktiv und selektiv Lernerfahrungen machen kann. Nur so kann es das frisch Gelernte mit seinem bestehenden Wissen vernetzen.
5. Lernstrategien werden nur durch selbstbestimmtes Lernen erworben.
6. Erfolgreiches Lernen führt zu einem guten Selbstwertgefühl und zu der Motivation, die Herausforderungen mit Selbstvertrauen anzugehen.
7. Das Kind will lernen, wenn es:
• sich geborgen und angenommen fühlt;
• sein genuines Bedürfnis befriedigen kann, Erfahrungen zu machen, die es für seine Entwicklung benötigt;
• durch Lob und Zuwendung im Lernen bestärkt wird;
• im Wettbewerb mit den anderen Kindern bestehen kann.
8. Gründe, weshalb einem Kind die Lernmotivation abhandenkommt:
• Das Kind fühlt sich in der Schule und/oder auch zu Hause emotional vernachlässigt und nicht akzeptiert.
• Das Kind wird durch die Erwartungen und Anforderungen der Schule und Familie überfordert oder unterfordert.
• Das Kind fühlt sich fremdbestimmt und erlahmt in seiner Neugierde.
• Dem Kind fehlt die Wertschätzung für seine Person und Leistung.
9. Die Lernmotivation bleibt dann erhalten und das Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn die Anforderungen den entwicklungsspezifischen und individuellen Bedürfnissen des Schülers entsprechen und er in seinen Lernbemühungen zumeist erfolgreich ist.

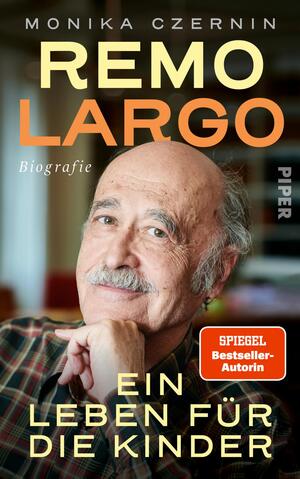
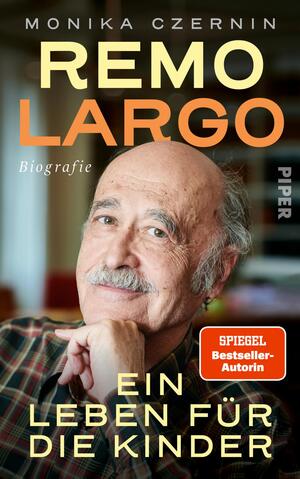























Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.