EINLEITUNG
Mit diesem Buch habe ich zu Beginn der Covid-19-Pandemie angefangen.[1] Studien mögen zeigen, dass die Menschen während des ersten Lockdowns mehr gelesen haben, ich für meinen Teil hatte über mehrere Wochen große Probleme damit. Ich konnte auch keine Filme mehr anschauen, oder jedenfalls nicht bis zum Schluss, oder aber ich schaute sie, ohne sie eigentlich zu sehen … Sicher, mein über den Haufen geworfener Alltag, die Verunsicherung, der Wunsch, minütlich die pandemischen Entwicklungen zu verfolgen, das Erlernen neuer Verhaltensweisen und der Entzug der eigenen Bewegungsfreiheit hätten als Erklärung meiner abdriftenden, gar mangelnden Aufmerksamkeit völlig ausgereicht, aber ich meinte, in dieser so außergewöhnlichen Zeit auch zu bemerken, dass etwas in meinem Verhältnis zu den Geschichten in die Brüche gegangen war – etwas, das die Jahre zuvor bereits bröcklig und spröde gemacht hatten, unterhöhlt von gewissen Fragen. Ich war nicht mehr sicher, ob ich noch etwas von ihnen wissen wollte, was sie mir zu bieten hatten, womit ich mich noch identifizieren konnte.
Hin- und hergeworfen fand ich mich plötzlich in einer Zeit wieder, die zerstückelt wurde von Bekanntmachungen des Präsidenten und der Regierung, von der Veröffentlichung wissenschaftlicher Studien, die nahezu täglich etwas über das neue Virus herausfanden, von Sechzig-Minuten-Einheiten, in denen es gestattet war, das Haus zu verlassen. Die Zeit war zerhackt, sie sprang wie das Bild alter Fernsehapparate und fing wieder bei null an, die Tage spielten sich alle vor der gleichen Kulisse ab, und die Zukunft schien zurückgedrängt oder per Erlass vertagt worden zu sein.
Die sich sorgfältig abspulende Chronologie, die mir von den meisten Geschichten angeboten wurde (A, dann B, dann C, dann die Auflösung), war mir mit einem Mal fremd geworden, da ich auch mir selbst mein Dasein nicht mehr erzählen konnte, nicht mehr die Einbildungskraft und Identifikation mit anderem aufbrachte, mir nicht länger zu sagen vermochte, „in zwei Wochen passiert das“.
Ich musste in jenem Frühjahr 2020 viel an meine Kindheit denken – an eine Zeit, als ich noch nicht über mich selbst bestimmen konnte, hin- und hergeworfen und zugleich in der Schwebe, an Lippen hängend, die ankündigten, was als Nächstes kommen würde, von hier nach dort verfrachtet, oftmals der Langeweile ausgeliefert.
Als Kind habe ich daher in Romanen begierig nach Geschichten gesucht, die eine Antithese meiner eigenen Erfahrung waren. Ich las Erzählungen von Helden und Erlösern, las von Abenteuern, Jagden, Eroberungen, Schatzsuchen, las Reiseberichte. Ich las vom absatzweise dargereichten Anderswo und fand es so stärkend wie einen Müsliriegel, und ich las verdichtete Handlung, bis all der Handlungsdruck einen Saft herauspresste, der mich schwindeln machte. Das war das genaue Gegenteil der Stunden, die ich in meinem farbenfrohen Kinderzimmer oder auf meinem Platz in der Schule zubrachte, im Musikunterricht oder im städtischen Schwimmbad, wo ich Bahn an Bahn reihte und die notwendigen Bewegungen zählte, um die fünfundzwanzig Meter von Beckenrand zu Beckenrand zu durchmessen.
In den Geschichten, die ich damals las, war alles nett und angenehm, weil auf gewisse Weise alles einfach war, selbst wenn tausend hinterhältige Feinde für Verwicklungen sorgten: Gab es ein Problem, dann handelten die Helden, seien es nun Musketiere, Ganoven, Polizisten, Piraten, Seemänner oder Hobbydetektive. Sie mussten nicht, wie ich, auf die Erlaubnis der Erwachsenen warten, und auch nicht auf ihre Volljährigkeit, ihre finanzielle Unabhängigkeit oder auf den Führerschein. Und wenn das Buch endete, war alles geregelt, ein paar waren tot, andere lebten, das Vorhaben war gescheitert oder geglückt, aber das ein für alle Mal.
Auch im Erwachsenenalter habe ich diese Genugtuung in vielen Geschichten wiedergefunden. Die Ermittlungen von Sherlock Holmes und die Folgen von Dr. House arbeiten mit genau demselben Versprechen, nach demselben Schema: Der Held macht sich auf, (unter-)sucht, tastet sich vor (es gibt unvorhergesehene Wendungen), er handelt sich unterwegs garantiert ein paar Schwierigkeiten ein (noch mehr unvorhergesehene Wendungen), doch am Ende findet er eine Lösung. Vielleicht ist es schon zu spät, dass alle unbeschadet aus der Sache herauskommen. Zu spät, um den Schuldigen festzunehmen oder den Patienten zu heilen. Aber irgendetwas wurde endgültig gelöst.
Im Frühjahr 2020 wusste ich nicht mehr, was ich mit diesen Geschichten anfangen sollte. Widerstreitende Wünsche hatten mich fest im Griff. Wie früher, wie in der Kindheit, war da der Wunsch, dem Helden auf seinen Abenteuern, in die er sich energisch stürzte, zu folgen, mich Figuren anzuschließen, die weder warten noch gehorchen mussten. Mit anderen Worten hegte ich den Wunsch, dass sich die Welt der Geschichten grundlegend von der Wirklichkeit unterscheiden sollte und dass man in dieser Welt wüsste, wie die Zukunft der Dinge oder Wesen aussähe („in zwei Wochen passiert das“) und dass ich daraus Trost ziehen, mich den Zwängen entziehen könnte.
Doch zugleich regte sich in mir der gegenläufige Wunsch, Geschichten zu finden, die meinem machtlosen, schwebenden Zustand entsprachen, meinem Unverständnis angesichts der Ereignisse, der Zersplitterung aller Ursachen und Zusammenhänge, meiner/unserer Unfähigkeit, die Folgen vorherzusehen, und somit der Unfähigkeit, zu einem Ende, einer Lösung zu kommen … Geschichten zu finden, die mir nicht länger vorgaukeln würden, eine Handvoll Männer könne das Schicksal aller zum Guten oder Schlechten wenden.
Schon seit Jahren, ob lesend oder schreibend, hatte ich jene Geschichten nicht mehr mit derselben Leichtigkeit behandelt, derselben Freude, ich hatte einen Argwohn gegen sie entwickelt, der stetig wuchs. Der Frühling 2020 bewies mir nun, dass sie mir überholte Modelle anboten: Ich konnte nichts damit anfangen, ich konnte sie nicht mehr auf die Welt anwenden. Für sie wollte ich meine „Ungläubigkeit“ nicht länger „aussetzen“ (um den Ausdruck von Coleridge zu verwenden), denn am Ende würde ich mit leeren Händen dastehen.
Der Frühling ging zu Ende. Der erste Lockdown ebenso. Die Fragen aber, mit ihrem sauren Beigeschmack, sind geblieben. Einerseits will ich, dass die Fiktion mich der realen Welt entreißt, andererseits soll sie mir aber auch etwas über die Welt beibringen. Sind diese zwei Wünsche unvereinbar? Das ist, im Wesentlichen, das Thema dieses Buches.[2]
Nun, da ich ihm ein Geburtsdatum gegeben und die Gründe seiner Existenz umrissen habe, werde ich kurz über seine Existenzform sprechen, oder über seine Vorgehensweise. Über sein Benehmen als Buch vielleicht, denn es gibt wohlerzogene, artige Bücher ebenso wie ungehobelte, miese und punkige.
Dieses Buch ist das Buch einer Schriftstellerin, aber zweifellos und zuallererst das Buch einer Leserin. Es dreht sich ebenso um weit zurückliegende Lektüreerfahrungen wie um Bücher, die ich erst kürzlich aufgeschlagen und auf meinen Nachttisch gelegt habe. Der innere Zusammenhang der von mir behandelten Werke ergibt sich aus dem Umstand, dass ich sie gelesen habe und dass Fetzen, Schatten einzelner Sätze und Figuren sowie bruchstückhafte, ewig wiederkehrende Absätze daraus in mir nachwirken. Ich bin es, die diese so unterschiedlichen zitierten Bücher zu einer Einheit macht.
Betrachtet man das vorliegende Buch als Essay, wird es sich nicht besonders gut benehmen. Es wird sich hier und da widersetzen. Wird der ihm auferlegten Ernsthaftigkeit nicht gerecht werden. Betrachtet man es als Träumerei zur Literatur, wird seine Ernsthaftigkeit hingegen an manchen Stellen übertrieben wirken. Sagen wir also einfach, es ist ein Buch, und lassen es dabei bewenden.
EINE HÄLFTE DER WELT
Im Jahr 2010 war ich mit einem Engländer zusammen und las, so wie er, den Guardian – was mir unheimlich schick vorkam, zumal ich herausgefunden hatte, dass man das „u“ nicht ausspricht, ein Detail, das mir unverhältnismäßige Befriedigung verschaffte. Aus dieser Zeitung erfuhr ich vom Bechdel-Test, und zwar aus einem Artikel über die Filmstarts am Thanksgiving-Wochenende – ein entscheidender Moment für neue Produktionen, da er den Anfang der fünf Wochen markiert, in denen viele Filme die weltweit höchsten Zuschauerzahlen verzeichnen. Allerdings, so informierte mich der Guardian, bestanden die meisten großen Hollywoodfilme diesen Test nicht, den ich bis dahin nicht gekannt hatte.
Vielleicht gilt das für Sie heute nicht mehr, aber ich werde ihn trotzdem kurz erläutern: Durch den Bechdel-Test (auch Bechdel-Wallace-Test genannt), der in den 1980er-Jahren in Alison Bechdels Comic The Essential Dykes to Watch Out For erschien, kann man sich das Fehlen beziehungsweise die mangelnde Repräsentation von Frauen im Reich der Geschichten vor Augen führen. Mit seinen nur drei Kriterien ist er erschreckend einfach anzuwenden:
1. In einem Werk müssen mindestens zwei Frauen vorkommen, die einen Namen tragen.
2. Diese Frauen reden miteinander.
3. Sie reden über etwas anderes als über einen Mann.
In den letzten Jahren wurde der Bechdel-Test vielfach abgewandelt, und eine seiner Varianten mag ich besonders, vorgebracht von der amerikanischen Drehbuchautorin Kelly Sue DeConnick: den sexy lamp test. Noch simpler als der Bechdel-Test stellt DeConnicks Version bloß eine einzige Frage: „Könnte man die weibliche Figur durch eine Lampe ersetzen, ohne dass es die Geschichte verändert?“ Die Formulierung bringt mich sehr zum Lachen; die Tatsache, dass die Antwort bei so mancher zeitgenössischer Produktion „Ja“ lautet, deutlich weniger.
Der Bechdel-Test (und einige seiner Abwandlungen) wird immer häufiger in Film- und Serienrezensionen angewendet, sehr viel seltener hingegen in der Literaturkritik, zumindest der französischen. Dabei könnte er ein krasses Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Figuren beim sogenannten literarischen Kanon aufdecken, also in den Büchern, die uns so häufig von Eltern, Lehrkräften, kultivierten Bekannten und Listen mit unbedingt lesenswerten Romanen aus einschlägigen Zeitschriften ans Herz gelegt werden – kurzum, eine Art gemeinsames kulturelles Fundament, das wertgeschätzt und von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Nach der Schule habe ich mich, wie so viele Studienanfänger, über mehrere Jahre auf das Aufnahmeverfahren der Elitehochschulen vorbereitet und mich daher lange Zeit innerhalb dieses Kanons bewegt.[1] Und anschließend beschäftigte ich mich zwei Jahre als Masterstudentin und drei Jahre als Doktorandin mit dem Theater, wodurch ich fünf Jahre lang nur wenig Romane las – sodass ich erst spät Gelegenheit hatte, mich ein wenig aus dem Joch dieses Kanons zu lösen, der einen beträchtlichen Teil meines Lebens als Leserin geprägt hat.
In Gesprächen und auf Tagungen wurde ich schon mehrmals gefragt, mit welcher berühmten weiblichen Figur der Literaturgeschichte ich mich identifiziere oder welche ich besonders mag. Das bringt mich jedes Mal ins Stottern. Denn wenn ich auf über zwanzig Jahre als Leserin zurückblicke, kommt mir nicht etwa ein Reigen liebenswerter Frauenfiguren in den Sinn, beeindruckend oder stark, aus denen ich wählen könnte.
Im Gegenteil, meine Erinnerung spult eine lange Reihe von Nebenfiguren ab, Objekte der Begierde männlicher Helden, oft passive Versatzstücke der Geschichte, die man entführen, einsperren, vergiften kann (manchmal alles hintereinander), eine Unzahl matter Gestalten, mit vor unerwiderter Liebe fahlem Teint, die sich die Nasen an Fensterscheiben platt drücken, hier und da ein paar weggesperrte Irre, Corneilles Prinzessinnen, die schlagartig an heftigstem Liebeskummer sterben, Racines Prinzessinnen, die sich umbringen, um der Schande eines skandalösen Begehrens zu entgehen, reife Frauen oder kleine Mädchen, die missbraucht und geschändet werden, und, wie sollte es anders sein, eine Fülle oftmals verlassener Ehefrauen, zwangsläufig ans Haus gebunden und auf traurige Weise untreu. Wie könnte ich behaupten, dass ich mich mit ihnen identifiziere? Oder dass ich diese Entführte jener Erhängten vorziehe?
Mit meiner Liste passiver Frauenfiguren will ich natürlich nicht die verantwortlichen Autoren für ihre Einfallslosigkeit tadeln. Sie, ebenso wie ihre Werke, sind Kinder ihrer Zeit, und sie können wenig dafür, dass Frauen – historisch gesehen auf die häusliche Sphäre beschränkt – ganz mehrheitlich ein Leben geführt haben, das „nonstoried“ war, um den schwer übersetzbaren Begriff der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Kathryn Rabuzzi zu verwenden, also ein Leben, das nicht erzählt wurde und das darüber hinaus auch nicht leicht zu erzählen ist, das sich nicht in Form einer Geschichte anbietet.
Oder vielleicht betrachten wir, anders ausgedrückt, bloß das als Geschichte (als gute Geschichte), was überwiegend keine weiblichen Lebensweisen enthält, Leben, die in den vergangenen Jahrhunderten durch ihre mangelnde oder wenig ausgeprägte Handlungsfähigkeit gekennzeichnet waren – ein Begriff, den ich hier sowohl im Sinne von Handlungsmacht als auch als die Fähigkeit verstehe, sich selbst als Akteurin oder treibende Kraft im eigenen Ausschnitt der Welt zu begreifen.
So überlegt sich etwa die Erzählerin in Sans alcool, einer Kurzgeschichte der Schweizer Autorin Alice Rivaz aus den 1960er-Jahren, dass sie gern ein „großes Leben“ gehabt hätte, doch als alte Jungfer, deren Eltern beide seit Kurzem verstorben sind, verfolgt sie kein anderes Ziel, als alle vegetarischen, keinen Alkohol ausschenkenden Restaurants ihrer Stadt auszuprobieren – die einzig schicklichen Orte, die eine alleinstehende Frau besuchen kann. Besorgt fragt sie sich, mit über vierzig Jahren, ob es Leben gibt, die „wie Vorlagen sind, Leben, die noch zu leben sind, sobald die letzte Seite umgeblättert ist. Und ich wäre nur ein Beispiel unter vielen?“ Dieses nicht gelebte Leben, von dem sie jedoch fürchtet, es gelebt zu haben, vergleicht sie mit weißen Seiten, „und mit weiß meine ich: leer“. Hier gibt es keine Geschichten, nichts, aus dem man zusammengenommen ein Buch machen könnte.
Wie Susan S. Lanser am Anfang ihres Aufsatzes „Toward a Feminist Narratology“ aus den Achtzigerjahren schreibt: „Die offensichtlichste Frage, die der Feminismus an die Narratologie stellen kann, lautet schlicht: Auf welchem Textkorpus, auf welchem Verständnis von Erzählung und Referenzrahmen gründen die Erkenntnisse der Narratologie?“ Ihre Antwort ist klar: Narratologische Bemühungen haben bei der Erstellung eines Kanons oder beim Festlegen von Werkzeugen für die Textanalyse niemals die Geschlechterfrage berücksichtigt; „die Erzählungen, auf denen die Narratologie gründet, wurden entweder von Männern geschrieben oder so behandelt, als stammten sie von Männern“.
In der Tat erweist sich so manches Konzept als sehr beschränkt, um nicht zu sagen unbrauchbar, sobald man es auf einen breiteren Textkorpus anwendet, insbesondere die Idee des „Plots“. Dieser beruht auf einer Abfolge von Handlungen, die von den Protagonisten vorsätzlich ausgeführt werden und „somit eine Macht, ein Vermögen voraussetzen, die möglicherweise weit von dem entfernt sind, was Frauen in der Geschichte und in Texten erlebt haben, und vielleicht sogar fern von den Wünschen dieser Frauen“. Literaturkritiken, sogar feministische, sehen sich häufig gezwungen, Texte von Frauen mit dem Begriff „plotless“ (also ohne Handlung) zu beschreiben und sich diesen Werken durch Verneinung zu nähern, sie durch das zu definieren, was sie nicht haben, nicht sind, ehe man sagen kann, was sie sind. Das ist sicher nicht der beste Weg, um Lust auf ihre Lektüre zu wecken …
Aber kehren wir zu der Frage zurück, die mich immer wieder in Verlegenheit bringt: Mit wem habe ich mich beim Lesen identifiziert? Bevor ich erwachsen wurde, stets mit männlichen Figuren: Ich war Bastian Balthasar Bux, nicht die Kindliche Kaiserin, ich war d’Artagnan, nicht Constance Bonacieux, ich war Jean Valjean und nicht Cosette – aus dem guten und einfachen Grund, dass die Kindliche Kaiserin in ihrem Elfenbeinturm gefangen ist, dass Constance Bonacieux ihre Zeit damit verbringt, sich entführen zu lassen, und dass Cosette die Misshandlungen der Thénardiers gegen die Aufsicht der Klosterschwestern tauscht, alles Konstellationen, die (in überspitzter Form) meine eigene kindliche Machtlosigkeit spiegelten, der ich durchs Lesen doch gerade zu entkommen versuchte.
Ich las gefangen in einem Zimmer, aus dem ich aufgrund meiner Kleinheit und Minderjährigkeit nicht herauskam, zumindest nicht sonderlich weit, und die Frauenfiguren, denen ich bei meinen Lektüren begegnete, waren selbst Gefangene, Einsiedlerinnen oder Spielbälle der Starken.[2] Zwangsläufig identifizierte ich mich mit dem anderen, dem handelnden Geschlecht, gegen das die vier Wände eines Zimmers oder einer Zelle scheinbar nichts ausrichten konnten.
Fast mein ganzes Leserinnenleben bin ich ein Mann gewesen. Zunächst mit großem Vergnügen und dann, vermutlich aus Überdruss, mit einer gewissen Genervtheit. Ich war daher sehr erfreut, als ich aus Der Lauf der Dinge von Simone de Beauvoirs Wut erfuhr, die sie bei der Lektüre von Wem die Stunde schlägt empfand. Obwohl ich den Roman sehr mag, verstand ich sofort ihren Abscheu angesichts des Einverständnisses, „das Hemingway an jedem Wendepunkt seiner Erzählungen für gegeben hält“ und das voraussetzt, „dass wir das Gefühl haben, genauso wie er arischer Herkunft, männlichen Geschlechts, reich an Geld und Zeit zu sein, und dass wir unseren Körper nie anders als unter dem Aspekt der Sexualität und des Todes auf die Probe gestellt haben“. Und dieses Einverständnis zeigt nur zu deutlich, an wen er sich in seinem Schreiben wendet, welche Leserschaft er sich wünscht. „Ein großer Herr wendet sich an große Herren. Die Schlichtheit des Stils kann täuschen, aber es ist kein Zufall, dass die Rechte ihn über den Klee gelobt hat, denn er hat die Welt der Privilegierten geschildert und verherrlicht“, schreibt Beauvoir.
Heute frage ich mich, ob die Jungen, die mit mir groß geworden sind, ähnliche Erfahrungen machen durften: Konnten sie sich dank einer Geschichte, wenigstens ein einziges Mal, mit einem Mädchen oder einer Frau identifizieren? Da bin ich skeptisch (und würde mit Begeisterung von Kindheitserfahrungen hören, die mich widerlegen), ganz einfach, weil sie es nicht nötig hatten; ihnen stand ein riesiger Textfundus zur Verfügung, der es ihnen erlaubte, sich an männlichen Figuren zu orientieren.
Ein irischer Freund, der als Kind eine reine Jungenschule besuchte, erzählte mir vor einigen Jahren, wie fassungslos seine Klasse reagiert hatte, als ihr Lehrer von ihnen verlangte, Jane Austens Stolz und Vorurteil zu lesen. Das musste ein Witz sein oder aber der Wunsch, sie zu demütigen, denn warum sollte man sie sonst zwingen, sich mit solchem Mädchenkram zu beschäftigen?
In „Sortir les lesbiennes du placard“, einer Radiodokumentation von Clémence Allezard, erklärt die Regisseurin Céline Sciamma, Männer absichtlich außen vor, im Off zu lassen, weil das den männlichen Zuschauern die Möglichkeit gebe, sich mit den dargestellten Frauenfiguren zu identifizieren. Was auf den ersten Blick ausgrenzend wirken könne, sei in Wahrheit der einzige Weg, Männer miteinzubeziehen. Da sie es kaum gewohnt seien, in einem fiktionalen Werk von einem Geschlecht ins andere zu wechseln, würden sie sich unwillkürlich in die männlichen Figuren hineinversetzen, und man müsse diese verschwinden lassen, damit Zuschauer erleben könnten, was Zuschauerinnen und Leserinnen schon immer praktizierten: eine vom Geschlecht losgelöste Identifizierung.
Doch manchmal, wenn ich in meinen Schubladen mit Frauenfiguren krame, kommt mir Denise Baudu aus Zolas Das Paradies der Damen unter, und ich spreche über sie, über ihr nächtelanges Nähen nach den zehrenden Arbeitstagen, um ihrer Verkäuferinnenuniform ein schmeichelnderes, eleganteres Aussehen zu geben und so dem Spott ihrer Pariser Kolleginnen zu entgehen, die in ihr bloß einen hässlichen, ungehobelten Bauerntrampel sehen. Mit ihrem beschwerlichen Start in der Hauptstadt und den vielen zusätzlichen Arbeitsstunden zur Aneignung gewisser Codes, die alle anderen bereits mühelos zu beherrschen scheinen, kann ich mich identifizieren.
Doch all die von Denise erlittenen Demütigungen und all ihr Leid werden am Ende des Buches einfach weggewischt, da ihr letztlich die Liebe ihres Dienstherren zuteilwird und sie an dem für Zola sehr untypischen glücklichen Schluss ausruft, indem sie ihrem Vorgesetzten um den Hals fällt: „O Herr Mouret, Sie sind es doch, den ich liebe!“ Und ebenjene Liebe wird es ihr erlauben, „allmächtig“ zu werden, wie es die letzte Romanzeile ankündigt, und trotz allem anderen, was das Buch außerdem erzählt – die Bezwingung und brutale Zerstörung der kleinen Geschäfte durch das von Mouret begründete Modehaus –, ist dies die offenbar glückliche Erzählung einer armen jungen Frau (eines Aschenputtels), die durch die Liebe eines reichen Mannes (eines Prinzen) aus ihrer Lage befreit wird. Kann ich also aufrichtig behaupten, mich mit Denise Baudu zu identifizieren? Ihre Figur zu mögen?
Angesichts meines verlegenen Gestammels überkommt mein Gegenüber häufig der Wunsch, mir zu helfen, und er oder sie sucht mit mir nach großen literarischen Frauengestalten. Zwei Namen des klassischen Kanons drängen sich rasch auf: Madame Bovary und Lady Chatterley.[3] Interessant.
Auf der einen Seite haben wir einen französischen Roman, der von einer Ehebrecherin handelt und dem man im Jahr 1857 vorwarf, „gegen öffentliche Moral, Religion und gute Sitten zu verstoßen“, all das im Umfeld einer durch das Zweite Kaiserreich auferlegten moralischen Ordnung (Flaubert wird letztendlich freigesprochen, doch die Urteilsbegründung der Richter hebt hervor, dass „das vor Gericht gebrachte Werk strengen Tadel verdient“).
Auf der anderen Seite steht ein englischer Roman, der von … einer Ehebrecherin handelt; im Jahr 1928 vom Autor auf eigene Kosten herausgegeben, von schockierten Buchhändlern zurückgewiesen, die ihn nicht verkaufen wollten, und in Großbritannien selbst erst 1960 veröffentlicht, was (dreißig Jahre nach seiner Niederschrift und einige Jahre nach dem Tod von D. H. Lawrence) zu einem Prozess gegen den Verlag, Penguin Books, führte.
Deutlicher gesagt: Es fallen uns zwei Figuren ein (zwei!), mit denen ich mich ebenfalls nicht identifiziere und deren emotionale oder sexuelle Bedrängnisse ihren jeweiligen Autoren ein Strafverfahren eingebracht haben. Gewiss ist die literarische Form, denen Emma Bovary und Constance Chatterley entstammen, von großer Schönheit, gewiss liebe ich diese beiden Romane wie wahnsinnig, aber das tue ich wegen ihrer formvollendeten Sätze und nicht, weil der durch die Heldinnen begangene Ehebruch – infolge einer geradezu erzwungenen Heirat – eine erstrebenswerte Perspektive wäre.
Angesichts dieser Zensurgeschichten – die uns fern erscheinen mögen – will ich gern klarstellen, dass in einem weiteren großen Figurenkosmos, nämlich dem des amerikanischen Kinos, zwischen 1934 und 1966 der Hays-Code galt, der es Filmen vorschrieb, „das heilige Wesen von Ehe und Familie zu verteidigen“. Wie soll man da weibliche Figuren erschaffen, die sich einem Leben als Hausfrau entziehen …? Dennoch habe ich dank des Talents einiger Regisseure und Schauspielerinnen, dann und wann, Frauen entdeckt, die ich toll fand, denen ich mich zugehörig fühlte.
Die Rollen von Claudette Colbert in Frank Capras Es geschah in einer Nacht und in Ernst Lubitschs Blaubarts achte Frau sind für mich raffinierte Kostbarkeiten, da sie ein klein wenig freiere Frauengestalten zeigen, die das heilige Wesen von Ehe und Familie dennoch nicht verspotten. Ich finde es äußerst faszinierend, dass beide Filme eine räumliche Trennung zwischen Mann und Frau vornehmen; abgesondert durch eine aufgespannte Decke in den kleinen Motels bei Capra und durch einen langen Korridor bei Lubitsch, der die zwei eigenständigen Teile einer Wohnung miteinander verbindet – sodass die Frau trotz ihrer Bevormundung in beiden Fällen über ein eigenes Zimmer verfügt.
In Lubitschs Film gibt es zudem eine erstaunliche Szene – aus einer Zeit, in der das Kino ständig und ungerührt geohrfeigte Frauen zeigte: Gary Cooper, voller Zorn über seine sich ihm verweigernde Ehefrau, beschließt, sie mit der Methode aus Der Widerspenstigen Zähmung von Shakespeare zu „bändigen“. Selbstsicher und beschwingt durchquert er den erwähnten Korridor, um zu ihren Räumen zu gelangen, und ohrfeigt sie ohne jede Vorwarnung. Ebenso schwungvoll erwidert sie die Geste, absolut ungebändigt, und er macht sich kläglich davon – nicht etwa beschämt von seiner Gewalttätigkeit, sondern völlig aus der Fassung, dass sie ihm nicht die geringste Vormacht zugestanden hat.[4]
Und da ich schon dabei bin, den Frauenfiguren aus Lubitsch-Filmen meine Liebe zu erklären, nähme ich es mir übel, Jennifer Jones’ Part aus Cluny Brown auf Freiersfüßen unerwähnt zu lassen (auf Französisch unter dem recht blamablen Titel La Folle ingénue, also etwa Die naive Irre, bekannt). Jones spielt eine junge Frau, die sich fürs Klempnern begeistert, und diese Liebe zur Mechanik und zu Abflussrohren (die Metapher erklärt sich wohl von selbst) schockiert die feine Gesellschaft um sie her und besonders den reichen Dorfdrogisten, den sie heiraten soll und der noch öder ist als Flauberts Homais und zudem eine Mutter im Schlepptau hat, die sich ausschließlich hüstelnd mitteilt. Gerade als Cluny sich anschickt, klein beizugeben und sich den Vorstellungen von Drogisten und Mutter zu beugen, gesteht Professor Belinski ihr seine Liebe – und der hat glücklicherweise überhaupt kein Problem damit, dass Cluny gern Abflüsse repariert. Sie kann, auf dem schmalen Grat dessen tanzend, was der Hays-Code erlaubt, ihr Leben also wie gewohnt fortsetzen, frei und verheiratet zugleich.
Natürlich besteht keiner der soeben genannten Filme den Bechdel-Test, doch sie alle haben Frauenfiguren hervorgebracht, die man eindeutig nicht durch eine Lampe ersetzen kann.
Noch einmal: Weder Flaubert oder Lawrence noch Zola, Dumas oder Hugo noch die amerikanischen Filmemacher der Vierzigerjahre wollten weibliche Vorbilder für die Leserin oder Zuschauerin des 20. oder 21. Jahrhunderts erschaffen, wie ich eine bin.
Mir geht es nicht darum, ihnen ihre Figuren vorzuwerfen oder in irgendeiner Weise die Zuneigung zu schmälern, die ich für ihre Werke empfinde. Doch nachdem ich das nun wiederholt klargestellt habe, bitte ich Sie, auch Ihrerseits anzuerkennen, dass ich umgeben von diesen Frauen aufgewachsen bin, auf sie gestützt, mit ihnen verwoben und zugleich entsetzt, was sie mir als Daseinshorizont anzubieten schienen, entsetzt von der Vorstellung, dass ich und mein Lebenshunger abnorm sein könnten … oder ich so fehl am Platz in meinem Geschlecht sei, dass ich seit der Grundschule erwog, mich als Junge auszugeben – indem ich mir meinen ersten Kurzhaarschnitt zulegte – und mich fortan Nicolas nennen zu lassen.[5]
Ich denke auch an die klare, unverblümte und traurige Stelle aus Die Argonauten, in der Maggie Nelson erzählt, dass die ersten Darstellungen von Sexualität, denen sie als Jugendliche lesend begegnete, Erzählungen von Vergewaltigungen und Grapschereien waren: „die eigene Sexualität [formt sich] um diese Tatsache herum. Es gibt keine Kontrollgruppe. Ich möchte nicht einmal über ›weibliche Sexualität‹ sprechen, solange es keine Kontrollgruppe gibt. Und es wird nie eine geben.“ Ich werde nie wissen, was für eine Frau ich hätte sein können, wenn ich mit anderen Lektüren aufgewachsen wäre, das ist unmöglich. Und doch treibt der Wunsch, es zu wissen, mich ständig um. Die anderen Ichs, die ich mir für mich ausmale, fehlen mir manchmal sogar, als hätte ich sie schon einmal getroffen und sie wären wieder verschwunden. Ich spüre, wie ich allein bleibe.
[1]Ich erinnere mich noch an meine Literaturprofessorin im zweiten Jahr der Vorbereitungsklassen, die uns empfahl, in unseren Arbeiten niemals zeitgenössische Werke zu zitieren. Denn die Zeit, so sagte sie, habe noch nicht als Filter wirken können, um die guten Romane „offiziell“ von den schlechten zu trennen, sodass wir Gefahr liefen, unsere Korrektoren in ihrem Geschmack zu brüskieren. Damit setze man den eigenen Erfolg aufs Spiel. „Im äußersten Fall“, so gestand sie uns zu, „können Sie es mit Schweinerei von Marie Darrieussecq probieren, aber wagen Sie sich nicht weiter vor.“ In einem Gespräch für Laure Murats Essayband Relire schildert Julia Deck ein ähnliches Erlebnis aus ihrer Studienzeit an der Sorbonne: „Die Literatur endete bei Sartres Der Ekel.“
[2]Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd über den Kopf stemmen kann, war da natürlich eine willkommene Ausnahme. Ebenso Georgina von den Fünf Freunden, auch wenn all ihre Handlungsfähigkeit darauf zu beruhen schien, dass sie sich wie ein Junge verhielt und sich, bei unzähligen Gelegenheiten, auch als solcher ausgab.
[3]Um ganz ehrlich zu sein, müsste ich auch noch Anna Karenina anführen, aber ich erlaube mir, sie aus einem rein persönlichen Grund außer Acht zu lassen: Ich mag Tolstois Romane nicht. Mal gräme ich mich deswegen, und mal freue ich mich. Sicherlich entgeht mir etwas, ein wenig von der Schönheit des literarischen Universums entzieht sich mir oder bleibt mir verschlossen (Gram); aber dafür muss ich, in einem Leben, das sich dem Bemühen widmet, ausreichend Zeit zum Lesen und Wiederlesen zu finden, Tolstois Romane nicht noch einmal lesen (Freude).
[4]Ätsch, habe ich mir bei dieser Szene jedes Mal gedacht.
[5]Diese Taktik, die dem zwanghaften Konsum des Fernsehfilms Meggies Geheimnis entsprang, fußte ganz und gar auf der Überzeugung, dass man mich mit meinen kurzen Haaren unmöglich als Mädchen erkennen würde. Und sie verpuffte schon in den ersten Minuten nach Betreten der Schule.
[1]Zunächst stand an dieser Stelle schlicht „zu Beginn der Pandemie“, erst danach verspürte ich das Bedürfnis, sie genauer zu benennen, denn ich dachte, dass mein Buch – vielleicht – zur Zeit einer anderen Pandemie erscheinen oder gelesen werden würde. Immerhin hätte ich im Mai 2020 niemals gedacht, dass ich eines Tages vom „ersten Lockdown“ würde sprechen müssen, um die damals gerade vergangenen zwei Monate zu bezeichnen. Also lieber auf Nummer sicher gehen.
[2]Ich schreibe ganz bewusst „im Wesentlichen“. Andernfalls würden gewisse Absätze eindeutig wirken, als hätten sie das Thema verfehlt.






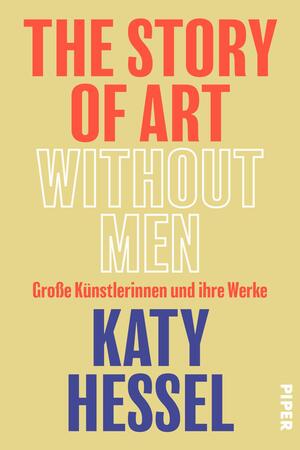















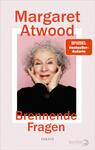


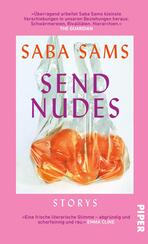










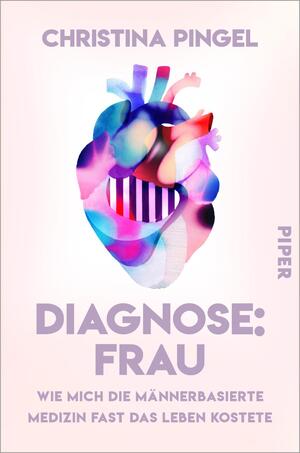
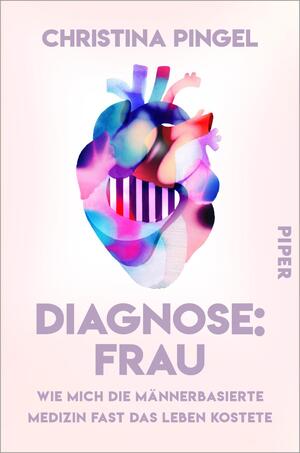




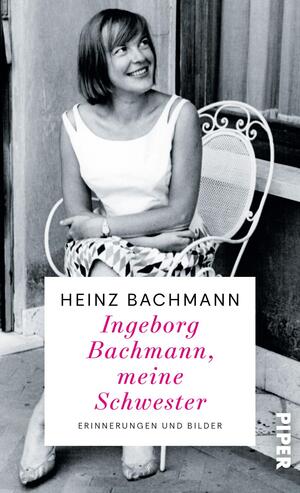







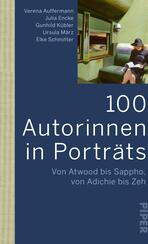









sehr viele interessante und auch kontroverse themen.gefällt mir.