Kapitel 1
November 1961
Damals, im Jahr 1961, als Frauen Hemdblusenkleider trugen und Gartenvereinen beitraten und zahllose Kinder bedenkenlos in Autos ohne Sicherheitsgurte herumkutschierten; damals, bevor überhaupt jemand ahnte, dass es eine 68er-Bewegung geben würde, und erst recht nicht eine, von der ihre Teilnehmer die folgenden sechzig Jahre erzählen würden; damals, als die großen Kriege vorbei waren und die geheimen Kriege gerade begonnen hatten und die Menschen allmählich anfingen, neu zu denken und zu glauben, alles wäre möglich, stand die dreißigjährige Mutter von Madeline Zott jeden Morgen vor Tagesanbruch auf und war sich nur einer Sache ganz sicher: Ihr Leben war vorbei.
Trotz dieser Gewissheit begab sie sich ins Labor, um den Lunch für ihre Tochter einzupacken.
Kraftstoff fürs Gehirn schrieb Elizabeth Zott auf einen kleinen Zettel, den sie in die Lunchbox ihrer Tochter steckte. Dann hielt sie inne, den Stift in der Luft, als würde sie neu überlegen. Treib in der Pause Sport, aber lass die Jungs nicht automatisch gewinnen, schrieb sie auf einen anderen Zettel. Dann hielt sie erneut inne, klopfte nachdenklich mit dem Stift auf den Tisch. Du bildest dir das nicht nur ein, schrieb sie auf einen dritten. Die meisten Menschen sind einfach scheußlich. Die letzten beiden legte sie obenauf.
Die meisten kleinen Kinder können nicht lesen, und falls doch, sind es meist Wörter wie „Hund“ und „Maus“. Aber Madeline las bereits, seit sie drei war, und jetzt, als Fünfjährige, hatte sie schon fast den gesamten Dickens durch.
Madeline gehörte zu der Sorte Kind, die ein Bach-Konzert summen, aber sich nicht selbst die Schuhe zubinden konnte, die die Drehung der Erde erklären konnte, aber bei Tic-Tac-Toe versagte. Und das war das Problem. Denn während musikalische Wunderkinder stets bejubelt werden, ist das bei frühen Lesern nicht der Fall. Weil frühe Leser nämlich bloß in etwas gut sind, in dem andere irgendwann auch gut sein werden. Deshalb ist es nichts Besonderes, darin die Erste zu sein – es ist bloß nervig.
Madeline war sich dessen bewusst. Deshalb nahm sie unweigerlich jeden Morgen – wenn ihre Mutter das Haus verlassen hatte und ihre Nachbarsbabysitterin, Harriet, abgelenkt war – die Zettel aus der Lunchbox, las sie und legte sie dann zu all den anderen Zetteln, die sie in einem Schuhkarton ganz hinten in ihrem Schrank aufbewahrte. Sobald sie in der Schule war, tat sie so, als wäre sie wie alle anderen Kinder: praktisch des Lesens unkundig. Für Madeline war Dazugehören wichtiger als alles andere. Und ihr Beweis war unwiderlegbar: Ihre Mutter hatte nie irgendwo dazugehört, und schau, wie es ihr ergangen war.
So lag sie in der südkalifornischen Kleinstadt Commons, wo das Wetter meistens warm war, aber nicht zu warm, und der Himmel meistens blau, aber nicht zu blau, und die Luft sauber, weil die Luft das damals einfach war, in ihrem Bett, die Augen geschlossen, und wartete. Sie wusste, bald würde ihr ein sanfter Kuss auf die Stirn gedrückt, die Bettdecke fürsorglich über die Schultern hochgezogen, „Nutze den Tag“ ins Ohr gemurmelt. Kurz darauf würde sie einen Automotor anspringen hören, das Knirschen von Reifen, wenn der Plymouth rückwärts aus der Einfahrt setzte, ein geräuschvolles Umschalten vom Rückwärtsgang in den ersten. Und dann würde ihre dauerhaft depressive Mutter zu dem Fernsehstudio fahren, wo sie sich eine Schürze umbinden und ihr Set betreten würde.
Die Sendung hieß Essen um sechs, und Elizabeth Zott war ihr unangefochtener Star.
Kapitel 2
Pine
Die ehemalige Forschungschemikerin Elizabeth Zott war eine Frau mit makelloser Haut und dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich war und es nie sein würde.
Sie war, wie alle guten Stars, entdeckt worden. Obwohl in Elizabeths Fall kein Eiscafé eine Rolle spielte, keine Parkbank, auf der sie zufällig gesichtet wurde, keine glückliche Fügung. Stattdessen führte Diebstahl – genauer gesagt Mundraub – zu ihrer Entdeckung.
Die Geschichte war einfach: Ein Mädchen namens Amanda Pine, die das Essen auf eine Weise genoss, die manche Therapeuten für bedenklich halten, aß Madelines Lunch. Und zwar, weil Madelines Lunch ungewöhnlich war. Während die anderen Kinder ihre Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade mümmelten, öffnete Madeline ihre Lunchbox und fand darin eine dicke Scheibe Lasagne vom Vortag, eine Beilage aus butterigen Zucchini, eine exotische, in Viertel geschnittene Kiwi, fünf glänzende runde Kirschtomaten, einen winzigen Morton-Salzstreuer, zwei noch warme Kekse mit Schokostückchen und eine rot karierte Thermosflasche mit eiskalter Milch.
Dieser Inhalt war der Grund, warum alle es auf Madelines Lunch abgesehen hatten, Madeline eingeschlossen. Aber Madeline bot ihn Amanda an, weil Freundschaft Opfer erfordert, aber auch, weil Amanda die Einzige in der ganzen Schule war, die sich nicht über das seltsame Kind lustig machte, das Madeline war, wie sie selbst bereits wusste.
Erst als Elizabeth bemerkte, dass Madelines Kleidung anfing, an ihrem knochigen Körper herabzuhängen wie schlechte Vorhänge, wurde sie misstrauisch. Ihren Berechnungen nach entsprach Madelines tägliche Nahrungsaufnahme genau dem, was ihre Tochter für eine optimale Entwicklung benötigte, somit war Gewichtsverlust wissenschaftlich unerklärlich. Dann vielleicht ein Wachstumsschub? Nein. Wachstum hatte sie in ihre Berechnungen einkalkuliert. Frühzeitiges Auftreten einer Essstörung? Unwahrscheinlich. Beim Abendessen futterte Madeline wie ein Scheunendrescher. Leukämie? Bestimmt nicht. Elizabeth war keine Schwarzseherin – sie war nicht der Typ Mutter, der nachts wach lag und sich ausmalte, ihre Tochter litte an einer unheilbaren Krankheit. Als Wissenschaftlerin suchte sie stets nach einer vernünftigen Erklärung, und in dem Moment, als sie Amanda Pines tomatensoßenrot verfärbte Lippen sah, wusste sie, dass sie die Erklärung gefunden hatte.
„Mr Pine“, sagte Elizabeth, als sie an einem Mittwochnachmittag in das örtliche Fernsehstudio und an einer Sekretärin vorbeirauschte, „ich versuche seit drei Tagen, Sie telefonisch zu erreichen, und Sie bringen nicht mal die Höflichkeit auf, mich zurückzurufen. Mein Name ist Elizabeth Zott. Ich bin Madeline Zotts Mutter – unsere Kinder gehen gemeinsam auf die Woody Elementary –, und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Tochter meiner Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Freundschaft vorgaukelt.“ Und weil er verwirrt wirkte, schob sie nach: „Ihre Tochter isst den Lunch meiner Tochter.“
„L…Lunch?“, brachte Walter Pine heraus, während er die Frau betrachtete, die eindrucksvoll vor ihm stand und deren weißer Laborkittel eine Aura überirdischen Lichts verbreitete, bis auf eine Kleinigkeit: die aufgestickten roten Initialen „E. Z.“ direkt über der Tasche.
„Ihre Tochter Amanda“, klagte Elizabeth erneut an, „isst den Lunch meiner Tochter. Anscheinend geht das schon seit Monaten so.“
Walter konnte sie nur anstarren. Groß und schlank, die Haare in der Farbe von leicht angebranntem gebutterten Toast nach hinten gestrichen und mit einem Bleistift festgesteckt, stand sie da, Hände in den Hüften, der Mund selbstbewusst rot, die Haut leuchtend, die Nase gerade. Sie blickte zu ihm herab wie ein Sanitäter auf einem Schlachtfeld, als würde sie abschätzen, ob es sich lohnte, ihn zu retten.
„Und die Tatsache, dass sie vorgibt, Madelines Freundin zu sein, um an ihren Lunch zu kommen“, fuhr sie fort, „ist absolut verwerflich.“
„W…Wer sind Sie noch mal?“, stammelte Walter.
„Elizabeth Zott!“, blaffte sie zurück. „Madeline Zotts Mutter!“
Walter nickte, versuchte mitzukommen. Als langjähriger Produzent nachmittäglicher Fernsehsendungen war er vertraut mit dramatischen Szenen. Aber das hier? Er starrte sie weiter an. Sie war hinreißend. Er war tatsächlich hingerissen von ihr. Wollte sie für irgendwas vorsprechen?
„Tut mir leid“, sagte er schließlich. „Aber die Krankenschwesterrollen sind schon alle vergeben.“
„Wie bitte?“, fauchte sie.
Es entstand eine lange Pause.
„Amanda Pine“, wiederholte sie.
Er blinzelte. „Meine Tochter? Oh“, sagte er plötzlich nervös. „Was ist mit ihr? Sind Sie Ärztin? Sind Sie von Ihrer Schule?“ Er sprang auf.
„Du liebe Güte, nein“, antwortete Elizabeth. „Ich bin Chemikerin. Ich bin in meiner Mittagspause den ganzen Weg vom Hastings hergekommen, weil Sie mich nicht zurückgerufen haben.“ Und als er sie weiter ratlos ansah, stellte sie klar. „Forschungsinstitut Hastings? Wo sich bahnbrechende Forschung Bahn bricht?“ Der geistlose Slogan ließ sie einmal tief ausatmen. „Es geht darum, dass ich sehr viel Sorgfalt darauf verwende, Madeline einen nahrhaften Lunch zuzubereiten, etwas, worum Sie sich doch gewiss auch für Ihr Kind bemühen.“ Und als er sie weiter nur verständnislos anstarrte, schob sie nach: „Weil Ihnen Amandas kognitive und körperliche Entwicklung am Herzen liegt. Weil Sie wissen, dass diese Entwicklung davon abhängt, ihr ein ausgewogenes Gleichgewicht von Vitaminen und Mineralstoffen zu bieten.“
„Das Problem ist, dass Mrs Pine …“
„Ja, ich weiß. Sie steht nicht zur Verfügung. Ich habe versucht, sie zu erreichen, und man sagte mir, dass sie jetzt in New York lebt.“
„Wir sind geschieden.“
„Tut mir leid, das zu hören, aber Scheidung hat wenig mit Lunch zu tun.“
„Das könnte man meinen, aber …“
„Ein Mann kann seinem Kind Lunch machen, Mr Pine. Das ist keine biologische Unmöglichkeit.“
„Völlig richtig“, pflichtete er bei und schob einen Stuhl zurecht. „Bitte, Mrs Zott, bitte, nehmen Sie Platz.“
„Ich hab was im Zyklotron“, sagte sie gereizt mit Blick auf ihre Uhr. „Sind wir uns einig oder nicht?“
„Zyklo…“
„Subatomarer Teilchenbeschleuniger.“
Elizabeth ließ den Blick über die Wände gleiten. Sie waren mit gerahmten Plakaten tapeziert, die Werbung für melodramatische Seifenopern und reißerische Spielshows machten.
„Meine Arbeit“, sagte Walter, der sich plötzlich für die Geschmacklosigkeiten schämte. „Vielleicht haben Sie schon mal eine davon gesehen?“
Sie wandte sich wieder ihm zu. „Mr Pine“, sagte sie in versöhnlicherem Ton. „Ich bedauere, dass ich weder die Zeit noch die Mittel habe, für Ihre Tochter Lunch zu machen. Wir wissen beide, dass Nahrung der Katalysator ist, der unser Gehirn in Gang setzt, unsere Familien zusammenhält und unsere Zukunft bestimmt. Und dennoch …“ Sie verstummte, und ihre Augen verengten sich, als sie das Plakat für eine Seifenoper bemerkte, auf dem eine Krankenschwester einem Patienten eine ziemlich ungewöhnliche Pflege angedeihen ließ. „Wer hat denn schon die Zeit, der ganzen Nation beizubringen, wie man Mahlzeiten zubereitet, die wirklich Gehalt haben? Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich habe sie nicht. Sie etwa?“
Als sie sich zur Tür wandte, sagte Pine, der sie nicht gehen lassen wollte und selbst nicht recht verstand, was da gerade in ihm vorging: „Warten Sie, bitte, Moment … bitte. Was … was haben Sie da gerade gesagt? Von wegen: der ganzen Nation beibringen, wie man Mahlzeiten zubereitet, die … die wirklich Gehalt haben?“
Essen um sechs ging vier Wochen später auf Sendung. Und obwohl Elizabeth die Idee nicht unbedingt begeisternd fand – sie war schließlich Forschungschemikerin –, nahm sie den Job aus den üblichen Gründen an: Er war besser bezahlt, und sie hatte ein Kind zu versorgen.
Vom ersten Tag an, als Elizabeth sich eine Schürze umband und das Set betrat, war offensichtlich, dass sie „es“ hatte, wobei „es“ diese schwer fassbare Qualität war, sehenswert zu sein. Aber sie war auch ein Mensch mit Substanz, so direkt, so nüchtern, dass die Menschen nicht wussten, was sie von ihr halten sollten. Während in anderen Kochsendungen gut gelaunte Köche fröhlich ihren Sherry in sich hineinkippten, war Elizabeth Zott ernst. Sie lächelte nie. Sie scherzte nie. Und ihre Gerichte waren ebenso ehrlich und bodenständig wie sie selbst.
Nach nur sechs Monaten war Elizabeths Sendung ein immer größerer Hit. Nach einem Jahr eine Institution. Und nach zwei Jahren war klar, dass sie die verblüffende Wirkung hatte, nicht nur Eltern mit ihren Kindern zu vereinen, sondern Bürger mit ihrem Land. Man kann ohne Übertreibung feststellen, dass die gesamte Nation am Esstisch Platz nahm, wenn Elizabeth Zott mit dem Kochen fertig war.
Selbst Vizepräsident Johnson verfolgte ihre Sendung. „Sie wollen wissen, was ich denke?“, sagte er, als er einen hartnäckigen Reporter loswerden wollte. „Ich denke, Sie sollten weniger schreiben und mehr fernsehen. Fangen Sie mit Essen um sechs an – diese Zott, das ist eine patente Frau.“
Und das stimmte. Niemals hätte Elizabeth Zott erklärt, wie man winzige Gurkensandwiches oder fluffige Soufflés machte. Ihre Rezepte waren herzhaft: Eintöpfe, Aufläufe, Gerichte, die in großen Metallpfannen zubereitet wurden. Sie legte Wert auf die vier Lebensmittelgruppen. Sie glaubte an anständige Portionen. Und sie betonte, dass jedes Gericht, das die Mühe wert war, weniger als eine Stunde Mühe erfordern sollte. Sie beendete jede Sendung mit ihrem Standardspruch: „Kinder, deckt den Tisch. Eure Mutter braucht einen Moment für sich.“
Doch dann schrieb ein prominenter Reporter einen Artikel mit dem Titel: „Warum wir alles essen, was sie uns auftischt“, und bezeichnete sie beiläufig als „Leckere Lizzie“, ein Spitzname, der sowohl zutreffend als auch alliterativ war und deshalb ebenso schnell an ihr haften blieb wie an dem Papier, auf dem er gedruckt war. Von diesem Tag an nannten Fremde sie Leckere Lizzie, aber ihre Tochter Madeline nannte sie Mom, und obwohl Madeline noch ein Kind war, begriff sie, dass der Spitzname die Fähigkeiten ihrer Mutter schmälerte. Sie war Chemikerin, keine Fernsehköchin. Und Elizabeth, ihrem einzigen Kind gegenüber befangen, schämte sich.
Manchmal lag Elizabeth nachts im Bett und dachte darüber nach, wie ihr Leben diesen Verlauf hatte nehmen können. Doch das Nachdenken währte nie lange, denn in Wahrheit wusste sie es.
Sein Name war Calvin Evans.
Kapitel 3
Forschungsinstitut Hastings
Zehn Jahre zuvor, Januar 1952
Calvin Evans war ebenfalls am Forschungsinstitut Hastings angestellt, doch im Unterschied zu Elizabeth, die in beengten Verhältnissen arbeitete, hatte er ein großes Labor ganz für sich allein.
Aufgrund seiner Erfolgsbilanz stand ihm das vielleicht auch zu. Mit neunzehn hatte er bereits bedeutsame Forschungsarbeit geleistet, die dazu beitrug, dass der berühmte britische Chemiker Frederick Sanger den Nobelpreis bekam. Mit zweiundzwanzig entdeckte er ein schnelleres Verfahren, um einfache Proteine zu synthetisieren. Mit vierundzwanzig brachte ihn sein Durchbruch in Sachen Reaktivität von Dibenzoselenophen auf das Titelblatt von Chemistry Today. Außerdem hatte er sechzehn wissenschaftliche Aufsätze verfasst, Einladungen zu zehn internationalen Tagungen erhalten und eine Professur in Harvard angeboten bekommen. Die er ablehnte. Zweimal. Zum einen, weil Harvard Jahre zuvor seinen Antrag auf einen Studienplatz abschlägig beschieden hatte, und zum anderen, weil – tja, eigentlich gab es keinen anderen Grund. Calvin war ein Genie, aber wenn er einen Fehler hatte, dann war das seine Neigung, nachtragend zu sein.
Obendrein war er berüchtigt für seine Ungeduld. Wie so viele geniale Menschen konnte Calvin einfach nicht begreifen, warum niemand sonst es kapierte. Er war außerdem introvertiert, was durchaus kein Fehler ist, sich aber häufig als Unnahbarkeit manifestiert. Erschwerend hinzu kam, dass er Ruderer war.
Wie viele Nicht-Ruderer Ihnen versichern werden, sind Ruderer nicht besonders lustig. Das liegt daran, dass Ruderer immer nur übers Rudern reden wollen. Sobald zwei oder mehr Ruderer im selben Raum sind, schweift das Gespräch unweigerlich von so herkömmlichen Themen wie Arbeit oder Wetter ab und kreist nur noch um Boote, Blasen, Riemen, Griffe, Ergos, Blattabdrehen, Training, Setzen, Ausheben, Freilauf, Splits, Sitze, Schläge, Rollschienen, Starts, Schlagzahlen, Sprints und ob das Wasser wirklich „glatt“ war oder nicht. Dann geht es meistens damit weiter, was bei der letzten Fahrt falschgelaufen ist und was bei der nächsten falschlaufen könnte und wer daran Schuld hatte beziehungsweise haben wird. Irgendwann strecken die Ruderer ihre Hände aus und machen einen Schwielenvergleich. Und wenn man so richtig Pech hat, schließen sich etliche Minuten andächtiger Ehrfurcht an, in denen einer von ihnen das perfekte Rudererlebnis schildert, bei dem sich alles leicht anfühlte.
Neben der Chemie war Rudern das Einzige, wofür Calvin echte Leidenschaft empfand. Ja, Rudern war der Grund, warum sich Calvin in Harvard überhaupt beworben hatte: Für Harvard rudern hieß 1945, für die Besten rudern. Oder eigentlich die Zweitbesten. Die University of Washington war die beste, aber die University of Washington lag in Seattle, und Seattle war für seinen Regen berüchtigt. Calvin hasste Regen. Deshalb richtete er seinen Blick in die Ferne – auf das andere Cambridge, das in England – und widerlegte damit einen der größten Mythen über Wissenschaftler: dass sie gut recherchieren können.
Als Calvin das erste Mal auf dem Cam ruderte, regnete es. Am zweiten Tag regnete es. Am dritten Tag ebenso. „Regnet’s hier andauernd so?“, maulte Calvin, als er und seine Teamkameraden sich das schwere Holzboot auf die Schultern hievten und hinaus zum Steg schleppten. „Nein, nein, praktisch nie“, beruhigten sie ihn. „Cambridge ist normalerweise ziemlich sonnig.“ Und dann sahen sie einander an, als wollten sie sich gegenseitig etwas bestätigen, was sie schon lange vermutet hatten: Amerikaner waren dämlich.
Leider erstreckte sich Calvins Dämlichkeit auch auf seine Kontakte zur Damenwelt – ein großes Problem, weil er sich sehr gern verlieben wollte. In den ganzen sechs einsamen Jahren, die er in Cambridge verbrachte, schaffte er es, sich mit fünf Frauen zu verabreden, von diesen fünf war nur eine zu einem zweiten Rendezvous bereit, und das auch nur, weil sie jemand anders erwartet hatte, als sie ans Telefon ging. Das Hauptproblem war seine Unerfahrenheit. Er war wie ein Hund, der nach jahrelangen vergeblichen Versuchen endlich ein Eichhörnchen erwischt und dann keine Ahnung hat, was er damit anstellen soll.
„Hallo … äh“, hatte er gesagt, mit klopfendem Herzen und feuchten Händen und einem schlagartig leeren Kopf, als die junge Frau die Tür öffnete. „Debbie?“
„Ich heiße Deirdre“, seufzte sie und warf einen ersten Blick auf ihre Uhr, dem noch viele folgen sollten.
Beim Abendessen zog sich die Unterhaltung vom molekularen Abbau aromatischer Säuren (Calvin) hin zu den neusten Filmen (Deirdre), zu der Synthese nicht reaktiver Proteine (Calvin), zu der Frage, ob er gern tanzte oder nicht (Deirdre), zu einem Blick auf die Uhr, es war schon halb neun, und er musste am Morgen rudern, deshalb würde er sie gleich nach Hause bringen (Calvin).
Es versteht sich von selbst, dass es nach diesen Rendezvous zu sehr wenig Sex kam. Genauer gesagt, zu gar keinem.
„Ich versteh gar nicht, dass du da Schwierigkeiten hast“, sagten seine Kameraden im Ruderteam öfter zu ihm. „Mädchen lieben Ruderer.“ Was nicht stimmte. „Und du bist zwar Amerikaner, aber du siehst nicht schlecht aus.“ Was ebenfalls nicht stimmte.
Ein Teil des Problems war Calvins Körperhaltung. Er war gut einen Meter neunzig groß, schlaksig und hager, und er ließ sich etwas nach rechts hängen – wahrscheinlich, weil er immer auf der Backbordseite ruderte. Aber noch problematischer war sein Gesicht. Er hatte einen verlorenen Ausdruck an sich, wie ein Kind, das sich allein durchschlagen musste, mit großen grauen Augen und zotteligem blonden Haar und leicht violetten Lippen, die fast immer geschwollen waren, weil er die Neigung hatte, auf ihnen zu kauen. Es war die Art von Gesicht, die manche als leicht zu vergessen beschreiben würden, eine unterdurchschnittliche Komposition, die nichts von der dahinterliegenden Sehnsucht oder Intelligenz erahnen ließ, bis auf ein entscheidendes Kriterium – seine Zähne, die gerade und weiß waren und seine gesamte Gesichtslandschaft rehabilitierten, sobald er lächelte. Zum Glück und vor allem, nachdem er sich in Elizabeth Zott verliebt hatte, lächelte Calvin ständig.
Sie begegneten sich – oder besser gesagt, wechselten die ersten Worte – an einem Dienstagmorgen im Forschungsinstitut Hastings, dem privaten Forschungslabor im sonnigen Südkalifornien, in dem Calvin, nachdem er in Cambridge in Rekordzeit promoviert und dreiundvierzig Stellenangebote abgewogen hatte, eine Position teils wegen des guten Rufs, aber hauptsächlich wegen des Niederschlags annahm. In Commons regnete es selten. Elizabeth dagegen nahm das Angebot vom Hastings an, weil sie keine anderen bekommen hatte.
Als sie vor Calvin Evans’ Labor stand, bemerkte sie einige große Warnschilder:
NICHT EINTRETEN
LAUFENDES EXPERIMENT
KEIN EINLASS
DRAUSSEN BLEIBEN
Dann öffnete sie die Tür.
„Hallo“, rief sie über Frank Sinatra hinweg, der aus einer Stereoanlage dröhnte, die seltsamerweise mitten im Raum stand. „Ich muss mit jemandem sprechen, der hier die Verantwortung hat.“
Calvin, überrascht, eine Stimme zu hören, reckte den Kopf über eine große Zentrifuge.
„Entschuldigen Sie, Miss“, sagte er laut und gereizt, auf der Nase eine große Schutzbrille, die seine Augen vor etwas schützten, das rechts von ihm brodelte, „aber Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Haben Sie die Hinweisschilder nicht gesehen?“
„Doch“, rief sie zurück, ohne auf seinen Ton zu achten, während sie durch das Labor marschierte, um die Musik auszumachen. „So. Jetzt können wir uns gegenseitig besser hören.“
Calvin kaute auf seinen Lippen und zeigte zur Tür. „Sie dürfen nicht hier sein“, sagte er. „Die Hinweisschilder.“
„Also, mir wurde gesagt, Sie haben in Ihrem Labor einen Überschuss an Bechergläsern, und wir haben unten zu wenig. Steht alles hier drauf“, sagte sie und hielt ihm ein Blatt Papier hin. „Ist von der Materialverwaltung genehmigt.“
„Darüber bin ich nicht informiert worden“, sagte Calvin, der das Blatt überflog. „Aber es tut mir leid, nein. Ich brauche jedes Becherglas. Vielleicht sollte ich lieber mit einem Chemiker unten sprechen. Sagen Sie Ihrem Chef, er soll mich anrufen.“ Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu und schaltete im Vorbeigehen die Stereoanlage an.
Elizabeth rührte sich nicht. „Sie wollen mit einem Chemiker sprechen? Mit jemand anderem als MIR?“, rief sie über Frank hinweg.
„Ja“, antwortete er. Und dann wurde er etwas freundlicher. „Hören Sie, ich weiß, es ist nicht Ihre Schuld, aber die sollten keine Sekretärin hier raufschicken, um ihnen die lästige Arbeit abzunehmen. Also, ich weiß, das ist für Sie vielleicht schwer zu verstehen, aber ich bin gerade mit etwas Wichtigem beschäftigt. Bitte. Sagen Sie Ihrem Chef einfach, er soll mich anrufen.“
Elizabeths Augen verengten sich. Sie konnte Leute nicht ausstehen, die aufgrund von ihrer Meinung nach längst überholten optischen Eindrücken voreilige Schlüsse zogen, und selbst wenn sie eine Sekretärin gewesen wäre, so konnte sie ebenso wenig Männer ausstehen, die glaubten, dass eine Sekretärin nicht in der Lage war, Wörter zu verstehen, die über „Tippen Sie das in dreifacher Ausfertigung“ hinausgingen.
„So ein Zufall“, schrie sie, steuerte geradewegs auf ein Regal zu und nahm sich einen großen Karton Bechergläser. „Ich bin auch beschäftigt.“ Dann marschierte sie hinaus.
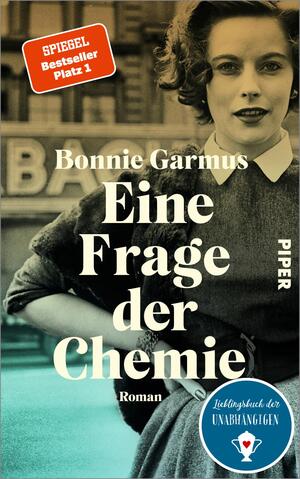

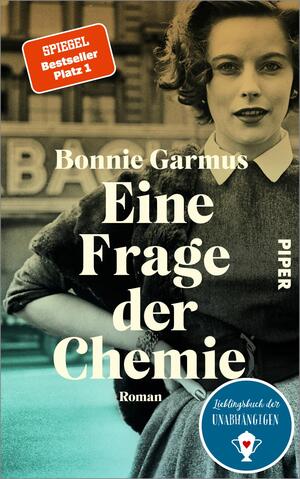
















Ich hab nur eine Vorstellung des Buches und doch eine verbindende Neugier- Frauen bereichern die Welt, haben Verantwortung und Verändern- wozu die Männer uns zurück halten wollen- weil Frauen Rebellen sind nur in einem höheren Widerstand und Sie wirken oft Tiefgreifend. Ich freu mich drauf. Danke
Ich wünschte mehr Frauen würden in den MINT-Wissenschaften arbeiten. Für Frauen ist alles möglich, wenn sie sich einer Sache annehmen.
Ich freue mich auf das Buch und halte es mit Marie Curie: "Leicht ist das Leben für keinen von uns. Doch was nützt das, man muß Ausdauer haben und vor allem Zutrauen zu sich selbst. Man muß daran glauben, für eine bestimmte Sache begabt zu sein, und diese Sache muß man erreichen, koste es, was es wolle.“ — Marie Curie