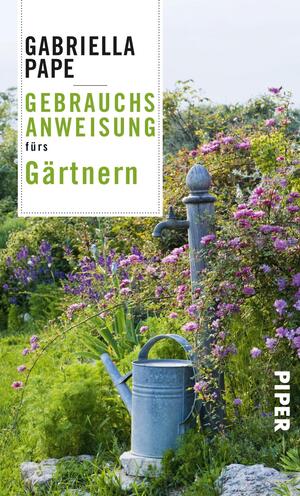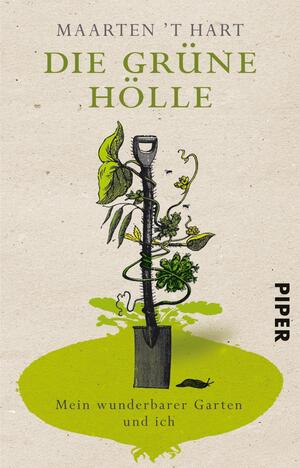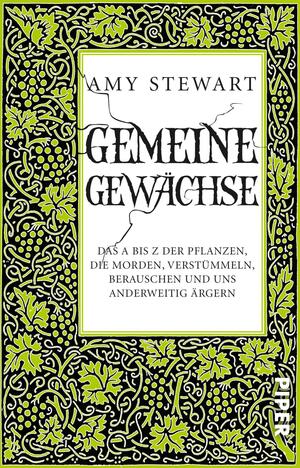Bücher für Gartenliebhaber
Besondere Gartenbücher zum Selberlesen und Verschenken. Entdecken Sie unsere Empfehlungen.
Im Garten Zufriedenheit und neue Kraft finden
Von „Deutschlands bester Gärtnerin“ (Die Welt)
Natur sehen, riechen, hören und berühren – der Schlüssel für ein langes, gesundes und glückliches Leben
Wie geht es den Bäumen in unseren Städten?
Unkraut vergeht nicht
Von grünen Daumen und Lieblingsplätzen - im Garten mit den Stars
Das etwas andere Gartenbuch
Wie Orchideen und Lilien nach Europa kamen
„Ein sinnliches und poetisches Buch voller Lust und Leidenschaft." - Mitteldeutscher Rundfunk


19. Januar 2020
Das Waldbuch von Deutschlands berühmtesten Förster
Peter Wohlleben - Autor und passionierter Förster - nimmt uns in seinem Buch „Gebrauchsanweisung für den Wald“ mit auf eine handfeste wie stimmungsvolle Entdeckungstour und gibt praktische Tipps und Anregungen für einen Waldspaziergang.


09. August 2021
Mit Andreas Kieling auf Entdeckungsreise
Andreas Kieling - Autor, Tierfilmer, Abenteuerer - begeistert sich schon sein Leben lang für die Natur. Begeben Sie sich mit ihm auf Entdeckungsreise durch heimische Natur.