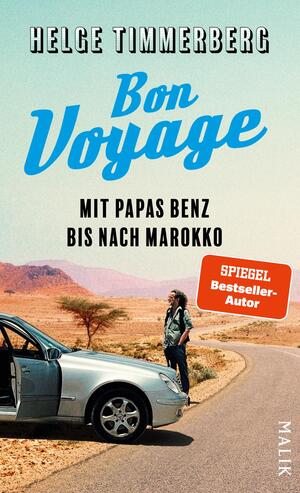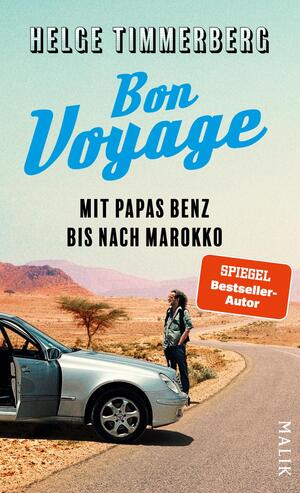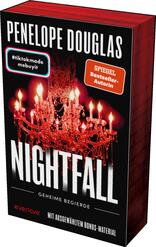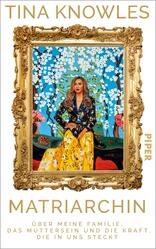Vorwort
Es begann, wie immer in den guten alten Tagen, mit den Sternen. Ihr Licht glänzte wie ein Feenmantel auf dem Benz meines Vaters, der nun meiner war. Der Wagen stand vor seiner Garage in Ostfriesland, aber mir kam es vor wie in einem Märchen. Er hatte mir 100 000 Euro und einen alten Mercedes E 220 CDI Elegance vererbt, und seine letzten Worte waren „Bon Voyage“.
1. Kapitel: Erster Tag
St. Gallen, Mercedes-Niederlassung.
Wer zu spät kommt, den bestraft die Straße. Ich hätte schon vor zehn Jahren losfahren sollen oder alternativ vor zwei Stunden. Wer beginnt eine Fahrt von St. Gallen nach Marrakesch um 17 Uhr und ein paar Zerquetschte? Ich mache vormittags nie etwas und will das auch unterwegs nicht krampfhaft ändern. Immer schön locker bleiben, wie der Nachbar sagt, aber 14 Uhr wäre schon o. k. gewesen. Wenigstens hat Mercedes noch auf.
Ich will den Stern.
Er wurde abgebrochen, was denn sonst. Selbst meine Tochter durchlief Entwicklungsphasen, in denen abgebrochene Mercedessterne als Trophäen der Nacht begehrt waren. Sie hat’s mir neulich mal gestanden. Natürlich entweihte sie nicht den Benz ihres Vaters, das waren andere Schweine. Zwei- oder dreimal sah ich das nicht ein und ließ einen neuen dranschrauben, aber irgendwann gab ich auf und akzeptierte, dass eine Mercedes-E-220-CDI-Elegance-Limousine ohne Stern nicht nur nach nichts mehr aussieht, sondern auch die Markenbotschaft verliert. Der gute Stern muss wieder drauf, für all die Straßen, die nun vor mir liegen, und das hat durchaus auch eine esoterische Komponente. Ich weiß, dass ich den Stern lenke, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es auch umgekehrt laufen könnte. Außerdem brauche ich einen zweiten Schlüssel. Ich habe nur noch einen. Und sollte ich den da draußen zwischen Okzident und Orient verlieren, verlegen oder vergessen, werde ich blöd dastehen.
Der Stern kostet 50 Franken, der Zweitschlüssel 500, sagt man mir, und das sehe ich ein. Das geht halt nicht anders, wenn man zum einen mit Mercedes und zum anderen mit der Schweiz zwei Hochpreisgaranten ausgeliefert ist. Glücklicherweise haben sie den Schlüssel für ein 21 Jahre altes Modell nicht am Lager.
„Der müsste bestellt werden, und das dauert bis morgen“, sagt der Verkäufer.
„Aber ich habe keine Zeit für einen Zweitschlüssel. Ich will die Fête des Gitans in Saintes-Maries-de-la-Mer nicht verpassen.“ Und was will ich da? Als Antwort höre ich eine Liedzeile von Eric Clapton in mir.
„Won’t you please read my science, be a gypsy.
Tell me what I hope to find deep within me.“
Wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt, hat das durchaus auch Vorteile. Einer davon liegt in der Überraschung, der positiven, klar. Negative Überraschungen bieten natürlich keinerlei Zugewinn. Aber das unerwartete Glück macht glücklicher als das geplante. Und das war, grob gesagt, mein Konflikt. Sollte ich 3500 Kilometer vorbuchen? Oder sollte ich die Feste feiern, wie sie auf die Straße fallen? Die schlampige Vorbereitung erschien mir irgendwie spiritueller und damit auch professioneller für die Jagd mit dem Mercedes nach dem Reiseglück. Trotzdem plante ich drei Stationen auf der Route fest ein, weil sie mir zwingend erschienen. Zwei davon versprachen Menschen, Tiere, Sensationen, wie die Fête des Gitans in Südfrankreich und der Besuch eines Stierkampfs irgendwo in Spanien, während das dritte Travel-Must-have als eine biografische Meditation angedacht war. Das ist Papas Benz, und der Brennerpass war Papas Lieblings-Weltenscheide und wurde auch meine, auf meiner ersten Reise in den Süden. Am Brenner fing alles an. Aber der Stern ist erst gegen 18 Uhr dran. Und irgendwann wird es ja auch mal dunkel.
Es gibt Regeln. Ich habe sie mir selbst auferlegt, denn ich weiß, wie es geht, und mit dieser Kompetenz wurde festgestellt: Südeuropa ist nicht Südamerika, und Marrakesch ist nicht Lagos. Das wird kein Abenteuertrip. Und Rekorde brechen brauche ich auch nicht. Ich muss nicht nach drei Tagen in der Medina parken und nach vier in der Oase Mhamid. Die Tour ist als Genussreise angelegt, und das sind die Regeln:
1. Fahre nie länger als vier Stunden pro Tag.
2. Meide die Dunkelheit.
Ein Mercedes ohne Stern ist wie ein König ohne Krone. Jetzt hat er sie wieder. Seinetwegen können wir los. Doch gemach, mein Guter. Ich bin noch nicht so weit. Ich stehe noch immer neben mir, wie eigentlich schon den ganzen Tag. Und wer neben sich steht, der steht auch neben dem Zauber, der jedem Anfang innewohnt. Der startet, ohne zu starten, fährt, ohne zu fahren, kommt an, ohne anzukommen. Aber das ist das Tolle an unserem Team. Es hängt immer nur einer durch. Und der Benz ist das nie.
On the road again.
Again and again and again, sollte ich sagen. Die Strecke nach Innsbruck bin ich viel zu oft gefahren, um noch auf die Ausschüttung von Glückshormonen zu spekulieren. Links hohe Berge, rechts hohe Berge, und die Abfahrten zu mythischen Kultplätzen wie St. Moritz und Ischl sind für mich mittlerweile so normal wie eine Fahrt mit der Straßenbahn. Wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, hat mit der Abnutzung der Reiseeindrücke kein Problem. Aber die Musik wird eins. Mein Vater hatte vor 20 Jahren noch die Wahl zwischen Kassette und CD und entschied sich gegen das neumodische Zeug. Der Chefredakteur eines Automobilmagazins erfuhr davon und schenkte mir aus seinem Retro-Tonträgerschatz sechs oder sieben Kassetten. Er beschriftete sie mit Jahrzehnten. White Sixties, Black Seventies, Mixed Eighties. Von Bee Gees bis Prince alles dabei. Und Arthur Conley gefiel mir am besten.
„Do you like good music, yeah, yeah,
Huh, that sweet soul music, yeah, yeah,
Just as long as it’s swinging, yeah, yeah,
Oh yeah, oh yeah.“
Wer da nicht mitsingt, hat keine Stimmbänder, aber wer Kassette sagt, muss auch Bandsalat sagen. Einige leierten aus, und wieder andere wurden einfach immer leiser. Ich weiß natürlich, was mein Smartphone alles kann. Es kann sich, zum Beispiel, per Bluetooth direkt mit meinen Hörgeräten verbinden und good music, yeah, yeah, rüberschicken, aber wenn die Lautsprecher quasi an den Trommelfellen kleben, hört man sonst nichts mehr, und das ist beim Autofahren nicht ratsam. Mir bleibt tatsächlich nur das gute alte Autoradio, und da hört der Spaß wirklich auf. Alle 100 Kilometer ein gutes Stück. Und dazwischen wird man zugeschissen. Natürlich kann man die Sender wechseln, aber das ist auch nicht anders als von Scheißhaufen zu Scheißhaufen zu springen, da höre ich doch lieber dem Techno-Mantra des Motors zu. Vierzylinder, 130 PS, Heckantrieb. Papas Benz ist kein Sprinter, er ist ein Langstreckenbomber, und genauso brummt er dahin.
Paddy ruft an.
„Hallo, Helge, wollte nur mal fragen, ob du gut losgekommen bist.“
„Na klar, aber erst vor einer Stunde.“
„So spät? Wo bist du jetzt?“
„Hundert Kilometer vor Innsbruck.“
„Du trittst also die Hälfte deiner Regeln schon am ersten Tag in die Tonne? Du schaffst es nicht mehr zum Brenner, bevor die Sonne untergeht.“
„Na ja, vielleicht schaffe ich es ja doch.“
„Helge! Es gibt bei Regeln kein ›vielleicht‹. Regeln werden eingehalten. Dafür sind sie da.“
„Ich liebe euch Schweizer.“
„Wir lieben dich auch.“
Paddy behält recht. Kurz hinter dem Ötztal verglüht die Sonne an einer Bergspitze, und ich sehe dem Naturschauspiel eher resigniert als fasziniert zu. Noch vor dem Abzweig zum Brennerpass beginnt die blaue Stunde. Und was von alldem ist bitte das Problem? Warum fürchte ich die Dunkelheit? Weil entweder meine Augen schwächer werden oder meine Scheinwerfer. Außerdem sind sie falsch eingestellt. Sie schielen, genau wie ich. Das wäre was für Stephen King. Auto und Mensch werden gleichzeitig blind. Und kriegen gleichzeitig Hunger, und sollte einer von ihnen mal des Hungertods sterben, verhungert der andere sofort mit. Wie gruselig ist das denn? Hört man nicht immer wieder von Autos, denen plötzlich der Sprit ausging?
Ein Hotel habe ich auch noch nicht. Ich wollte eines auf der letzten Raststätte im Internet suchen und buchen, aber alles, was mir Booking.com präsentierte, war entweder zu teuer oder aus anderen Gründen nicht mein Ding. Lass doch die Straße eins suchen, sagte ich mir. Und jetzt sage ich mir: Wie bekloppt ist das denn?
Mühlbachl am Brenner, „Hotel Stolz“.
Der Parkplatz gefällt mir. Groß, leer, von Bergen gerahmt. Mit einer soliden Kette davor. Auch scheint das Hotel noch geöffnet zu haben, denn es ist im Gegensatz zu denen, die ich bereits in der Dunkelheit passiert habe, noch beleuchtet. Und ich muss pissen. Gründe genug, um am Ende des Tages einzuknicken und jedes Hotel zu akzeptieren, das Toiletten hat. Mit einer jüngeren Blase hätte ich an der Rezeption auf dem Absatz kehrtgemacht. Ich kann dieses Hellholz nur schwer ertragen. Gott strafe die Schweden, meinetwegen mit chronischem Schluckauf. Als ich mit Papa in dieser Gegend war, gab’s Ikea noch nicht. Im Zimmer wird’s noch schlimmer. Das Bettgestell, die Wandverkleidungen, der Schreibtisch, der Stuhl, die Bilderrahmen, selbst die Bretter, die verhindern, dass man vom Balkon fällt, waren mal ’ne Fichte. Die wachsen am schnellsten. Fichten sind billige Bäume, und weil diese Billigkeit nach Bier schreit, das im Zimmer nicht zu finden ist, bin ich schon wieder unten. Aber in der Lobby gibt’s auch keins, und das Hotelrestaurant ist geschlossen.
„In Tirol wird nur beim Après-Ski durchgesoffen“, sagt der Rezeptionist. „Im Sommer sind wir brav.“
„Und was ist mit Essen?“
„Um diese Zeit? Das können Sie vergessen.“
Ich erinnere ihn an das Motto des Hauses. Es ist auf dem Hotelprospekt zu lesen, der zwischen ihm und mir auf der Hellholztheke liegt. „Sterne haben viele, aber Herz nur wenige“, rezitiere ich.
Er scheint einzuknicken.
„Nun, es gibt zehn Kilometer weiter unten noch ein, äh …“
„Ein Äh …?“
„Na ja, ein, äh, Etablissement, aber Speisen bieten die, glaube ich, auch nicht an.“
Ich glaube ihm sein „glaube ich“ nicht. Ich glaube, er weiß es.
On the road again, und es ist fast Mitternacht. „Das Gute schläft, das Böse wacht.“ Ich liebe Reime, selbst meine, aber der ist von Goethe. Auch der Dichterfürst überquerte die Alpen auf der alten Brennerpassstraße, die in Wahrheit uralt zu nennen ist, denn sie wurde von den alten Römern angelegt, vor mittlerweile 1700 Jahren. Ab dem Mittelalter avancierte sie zum meist genutzten Übergang der Ostalpen, und nachdem sie 1777 auf Geheiß der Kaiserin Maria Theresia zu einer Straße ausgebaut worden war, die auch im Winter befahrbar war, dauerte es nur noch schlappe zehn weitere Jahre, bis auch Johann Wolfgang von Goethe sich blicken ließ.
Meine Fresse, die Straße wirkt im Licht der schielenden Scheinwerferkegel und hier und da auch im Nebel (oder sind das schon Wolken?) noch immer etwas prähistorisch. Da freut man sich über jede rote Laterne in der Ferne. Das ist keine Ampel, das ist der Alpenpuff. Nichts Großes, kein mehrstöckiger Sündenpfuhl, kein Laufhaus, wie man das in Österreich nennt. Klein, aber unfein klebt der Club am Berghang.
Und jetzt?
Will ich Essen oder biografische Meditationen? Papa hätte angehalten. Papa wäre reingegangen. Papa hätte gefragt, wer von den Huren am besten kochen kann. Aber ich lass es sein. Ich fahre langsamer, aber leite nicht den Bremsvorgang ein. Weil ich nicht Manns genug bin? Kann sein. Weil ich ein Moraltrompeter bin? Nein. Weil ich normal bin? Ja. Und kein normaler Mensch will was über den Sex seiner Eltern wissen.
Weiter geht’s deshalb durch Nacht und Nebel auf der alten Brennerstraße bis zum nächsten Licht in der Ferne, einem, das blau ist und eine Tanke verspricht, die noch geöffnet hat. Blaue Lichter halten, was sie versprechen, und ich betrete die Nachttankstelle wie ein Gourmetrestaurant.
Zurück auf 990 Meter Höhe im Hellholz vom „Hotel Stolz“ verleihen zwei Dosen Bier, zwei Schokoladenriegel, Butterkekse, Studentenfutter und, ach ja, Zigaretten und Zigarettenpapier dem Zimmer etwas Wohnlichkeit. Ich schaue mir dazu alte Schwarz-Weiß-Fotos an, denn dafür habe ich sie mitgebracht. Papa war ein Hobbyfotograf.
Ich sehe einen sieben- oder achtjährigen blonden Jungen in kurzer Lederhose auf einem Felsen. Hinter ihm schneebedeckte Gipfel. Er steht da breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt. Die klassische Angeberpose. Ich kann nur hoffen, der Fotograf hat sie verlangt. So stand Papa auch gerne. Das nächste Foto zeigt mich wieder in kurzer Lederhose, aber in deutlich schüchternerer Pose vor dem „Haus Renate“. Eine Pension, nehme ich an. Oben die Gästezimmer, unten das „Flößerstüberl“. Keine Ahnung, ob’s das heute noch gibt, und auch keine Ahnung, was diese Bildschau eigentlich bringen soll. Bei aller Romantik, die vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos garantieren, baue ich zu meinem rund 63 oder 64 Jahre jüngeren Ich keine Beziehung auf. Ich weiß, dass ich das bin, oder besser war, aber ich fühle es nicht. Geht das der Baumkrone auch so, wenn sie zu ihren ersten Jahresringen runterblickt?
Bei Papas Karre dagegen klappt der Sprung in die Fünfzigerjahre tadellos. Er fuhr damals nicht den König, sondern den Käfer der deutschen Automobilindustrie. Das Standardmodell, dank Papas Autowaschzwang wie aus dem Ei gepellt, musste man einfach lieb haben. Alles rund, halbrund, oval, nur fließende Formen, keine rechteckigen Winkel, außer am Nummernschild gab es keine geraden Linien an der Karosserie. Nur Nummernschilder unterliegen dem Design der Bürokratie.
Erst im Innenraum des VW Käfers begann der Ernst des Lebens. Für Papa. Nicht für mich. Als Knabe erfreute ich mich großzügiger Beinfreiheit auf dem Beifahrersitz, und auf der Rückbank konnte ich fast ausgestreckt schlafen oder dösen oder durch das ovale Fensterlein in die Sterne über den Brenner schauen. Der Motor brummte, der Fahrwind summte, die Reifen seufzten. Das Wiegenlied der Nomaden. Ich lag für mein Leben gern auf der Rückbank, aber ich musste den Käfer ja auch nicht fahren. Servolenkung war damals Science-Fiction, und einen Käfermotor, der in den Serpentinen nicht überkocht, hatte auch noch niemand gesehen.
Mein Vater konnte gut mit Maschinen, aber dass er nach all dem Rumkurven, Zwischenkuppeln und Kühlwassernachfüllen im „Haus Renate“ übernachten wollte, ich aber meiner Mutter davon nichts erzählen sollte, kann ich heute gut verstehen. Oder auch nicht. Er hat’s ja fotografiert und ihr das Foto gezeigt, als wir von unserer Vater-Sohn-Reise zurückkamen. Wahrscheinlich war es ’ne andere Renate oder Beate der Alpen, von der sie nichts wissen durfte. Egal. „Das darfst du aber nicht deiner Mutter erzählen, hörst du?“, ist einer der wenigen Papasätze meiner Kindheit, die ich nie vergaß. Und die wenigen glücklichen Erinnerungen an mein Leben mit ihm spielten alle in Motorfahrzeugen.
Ich leg die Fotos weg und verpiss mich auf den Balkon, von dem man tagsüber auf Berge und Sommerwiesen blickt, nachts blickt man ebenfalls ins herrliche Wipptal hinein, aber sieht nichts davon. Ab morgen halte ich die Regeln ein und werde noch bei Tageslicht ankommen, egal wo. Dann lässt sich auch die dritte Regel leichter einhalten. Ja, es gibt eine dritte, ich hatte sie nur vergessen. Oder zur unverbindlichen Empfehlung runtergestuft. „Gehe am Ende jeder Etappe 10 000 Schritte“, lautet die dritte Regel für Genussreisen, denn darüber freut sich nicht nur der Körper, auch den Reiseeindrücken bringt es viel. Be- und Entschleunigen, Fahren und Spazierengehen, der Fluss und die Details.
2. Kapitel: Benz und Blase
Steffi ist nicht Siri. Die weibliche Stimme meines Billig-Navi klingt nach bedauerlich wenig Östrogenen. Aber das hat auch Vorteile. Ich kann sie besser beschimpfen, verfluchen und schlimme Wörter benutzen. Das schlimmste kommt mir glücklicherweise nie über die Lippen, aber „blöde Kuh“ ist immer drin, wenn Steffi wieder mal den schnellsten Weg mit dem kürzesten verwechselt, auch wenn’s ein Ziegenpfad ist. Sie schaltet sich auch gern ohne Vorwarnung ab. Dann schalte ich sie wieder ein, was mir einiges abverlangt. Dies und das Akzeptieren und Warten, bis sich das System aufgebaut hat, um dann das Ziel ein zweites Mal einzugeben. Oder ein drittes Mal. Aber heute ist Steffi brav. Und die brave Steffi sagt, dass ich von Mühlbachl nach Saintes-Maries-de-la-Mer rund zwölf Stunden reine Fahrzeit einplanen muss. Teile ich das durch drei und fahre pro Tag nicht mehr als vier Stunden, halte ich die Vier-Stunden-Regel ein und werde trotzdem rechtzeitig zur jährlichen Wallfahrt der Gitans ankommen. Ein Stopp in Italien, einer an der Côte d’Azur, und als grobe Richtung für heute gebe ich Genua in das Navi ein. Aber Steffi sagt, bis Genua sind’s fünfeinhalb Stunden reine Fahrzeit.
„Blöde Kuh.“
Reine Fahrzeit ist das eine, die Pausen sind das andere, und dann gibt es ja auch noch das Wetter. Semibiblische Regenfälle suchten vor einer Woche Norditalien heim, die Flüsse traten über ihre Ufer und rissen alles mit, was auf den Straßen war. Autos schwammen, Menschen starben, Häuser brachen, Orte wurden evakuiert, Milliardenschaden. Mittlerweile regnet es dort wieder weniger, heute soll sogar hier und da auf der Route nach Genua die Sonne scheinen.
Auf der österreichischen Seite der Alpen tut sie das grad nicht. Es nieselt, aber klar, das Sprichwort stimmt. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Autos. Ich fahr ein gutes, aber auch ein gutes Auto ist nur so gut wie das Auto vor ihm, was das Vorwärtskommen angeht. Steffis fünfeinhalb Stunden reine Fahrzeit bis Genua beachtet also auch nicht den Wandel der Zeiten auf der alten Brennerpassstraße. Der Verkehr hat hier seit den Fünfzigerjahren deutlich zugenommen. Stop and Go in den Kurven, Stop and Go in den Geraden, Stop and Go in den Ortschaften, da könnte ich auch zu Fuß gehen, wenn der Nieselregen nicht wäre.
Nach Steinach habe ich die Faxen dicke und verlasse die Traumstraße meiner Kindheit, um auf der Brennerautobahn mein Glück zu versuchen. Ab sofort stehe ich im Stop ohne Go. Die Österreicher bemühen sich, durch quasi schikanöse Polizeikontrollen an der alten Passstraße die Lkws auf die Autobahn zu zwingen, was offensichtlich prima klappt. Stop ohne Go ist Stau, und „wer gleich sich bleibt bei Freud und Leid, der reift für die Unendlichkeit“, sagt die Bhagavad Gita. Ich dagegen sage, es gibt keine Freud ohne Leid und umgekehrt. Stockt der Fluss, beginnt der Genuss der Details.
Auf dem Lastwagen vor mir steht in großen blauen Lettern „Spedition Walter“. Und Walter heißt nicht nur eines der größten Fuhrunternehmen Österreichs, sondern auch ein Freund, der mich auf der Reise als Beifahrer hatte begleiten wollen, aber nach einer kleinen Proberunde in meinem Raucherauto wollte er es dann doch nicht mehr. Und das ist vielleicht auch gut so. Denn die Frage, ob es besser ist, allein oder in Begleitung zu fahren, beantwortet sich leider immer erst, wenn es zu spät ist. Egal, wie groß das Auto ist, es wird furchtbar klein, wenn die Stimmung kippt oder gar offener Streit ausbricht. Und auch das gegenteilige Missgeschick, das peinliche Schweigen und die eiskalte Erkenntnis, dass man sich über Tausende von Kilometern nichts zu sagen hat, macht jede Reise platt.
Mit Walter wäre das nicht passiert. Wir kennen und schätzen uns seit über 30 Jahren. Wir arbeiteten seit über 30 Jahren zusammen. Wir teilten seit über 30 Jahren dieselbe Leidenschaft. Wir waren Journalisten. Er mein Chefredakteur, ich sein Reporter. Mittlerweile gehen wir es langsamer an, aber es steckt natürlich noch in uns drin. Wenn das Jagdhorn bläst, beginnt die Hatz auf Geschichten. Oder zumindest die Lust darauf. Das Durchspielen des Ernstfalls. Was ließe sich aus einem Stau auf der Brennerautobahn machen? Welche Geschichte versteckt sich hier? Weil ein Chefredakteur dabei eher an die Leser und ein Autor eher an sein Ego denkt, wären wir garantiert eine unterhaltsame Kombination gewesen. Wir hätten immer was zu reden gehabt. Es sei denn, er wäre erstickt.
Spedition Walter rückt vor. Es geht langsam weiter an Baustellen entlang, die den Verkehr nach und von Italien in zwei Fahrbahnen zwingen. Auch beginnt es kurz mal stärker zu regnen, aber der Wolkenhimmel weiter vorn lockert auf.
Lara ruft an. Sie will nur kurz wissen, was ihr Schatz gerade macht und wo er gerade ist, und als ich ihr alles wahrheitsgetreu berichtet habe, ist sie schon nicht mehr so traurig darüber, dass sie nicht mitfahren kann. Ich lerne viel daraus. Wer Frauen nicht auf den Gedanken bringen möchte, einer ungerechten Welt ausgeliefert zu sein, in der einer durch die Gegend gondeln darf und die andere arbeiten muss, der sollte ihnen, egal, was sonst noch passiert, nur von Staus im Regen erzählen.
Die Passhöhe ist genommen, wir sind in Italien, ab sofort haben die Städte schönere Namen, weil sie häufiger mit Vokalen statt mit Konsonanten enden. Bolzano, Trento, Milano … Ein „o“ wird im Geist mitgesungen, ein „a“ wie in Verona ebenso, natürlich auch wie in Genova, aber den Namen habe ich auf den Richtungsweisern der Autobahn noch nicht gesehen. Sie wird breiter, schneller, heller, die Sonne kommt durch, der Verkehr beginnt zu fließen, ich stell das Radio an. Italienischer Sender. Ich hatte es geahnt. Die Musik wird besser, aber sobald die Moderation dazwischenfunkt, ist Schluss. Sie reden zu gern, zu schnell, zu endlos. Koffeingepeitschte Temperamentsbolzen in Plauderstimmung begleiten mich die Berge runter, auch Steffi meldet sich mit ihrer blöden Stimme immer wieder, und wenn dann vor Gabelungen oder gar Kreuzungen zwei Frauen gleichzeitig loslegen, noch dazu eine auf Italienisch, freut man sich, dass man beide abstellen kann.
Glückshormone sind Glückshormone. Ich nehme sie, wo ich sie kriegen kann. Wenn die Schönheit der Po-Ebene sie mir nicht bietet, weil sie aus meinem Sichtfeld ist und auf der Autobahn zu viele Autos fahren, um sich alternativ dem Geschwindigkeitsrausch hinzugeben, muss das Glück genügen, das die Freiheit schenkt: a) die Freiheit der Straße, b) die Freiheit des Alleinreisenden.
Es gibt Menschen, die wollen Liebe. Es gibt Menschen, die wollen Geld. Es gibt Menschen, die wollen Freiheit, und es gibt Menschen, die wollen Auto fahren. Janis Joplin war so eine. „Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz.“ Ach, was gäbe ich dafür, wenn die „White Sixties“-Kassette noch in Ordnung wäre. Und der Verkehr wie damals. Nur ein Käfer muss es nicht mehr sein. Der Benz ist voll o. k. Baujahr 2002. Also immerhin schon eine Millenniumkarre. Kein Oldtimer, kein Neuwagen. Das hat nur Vorteile. Dem einen ist er an Technik überlegen, dem anderen an Eleganz.
Nein, würden sie bei Mercedes sagen, unsere brandneuen Modelle sind noch eleganter als unsere eleganten älteren Baureihen. Aber ich bleibe dabei. Das Design der zeitgenössischen Modelle ist zu technisch, zu futuristisch, zu kalt. Ihnen fehlt die Gemütlichkeit der klassischen Limousine. Papas Benz ist eine elegante Brücke zwischen der alten und der neuen Zeit. Ein bildschönes fahrendes Wohnzimmer mit guter Hydraulik. Fleißige Stoßdämpfer, verlässlicher Motor, entspannende Automatik, ich sag’s ja: Ich nehme mir die Glückshormone, wie sie kommen. Ist das schon weise? So weit will ich nicht gehen. Ich denke, es ist erwachsenes Reisen, wenn man von einer Fahrt über geschäftige italienische Autobahnen nicht mehr verlangt, als sie zu geben bereit sind.
Das beste Ciabatta meines Lebens zum Beispiel. Nicht das wahrscheinlich beste und nicht eines der besten, sondern das beste. Ich beiße rein und sehe dann die Frau hinter dem Büfett der kleinen Stazione autostradale mit einem Blick an, der ihr Gefallen findet. Diesen Blick wollen sie von uns. Diese Dankbarkeit. Dann wird auch der Kaffee mit Liebe gereicht. Ein Hoch auf die Italienerinnen.
„Mille grazie, Bella“, sage ich und habe anscheinend den richtigen Ton getroffen. Mit einem Sophia-Loren-Lächeln belohnt sie meinen Respekt vor ihrer Weiblichkeit. Wenn die Loren lächelte, dann lächelten dich die Geliebte und die Mutter gleichzeitig an, auch die Hure, auch die Kellnerin ist in diesem Lächeln mit drin, aber nie die Heilige.
„French?“
„No, German.“
„Where do you go?“
„To Marrakesch“.
„Oh …“
Wer das Interesse von Frauen wecken will, muss nicht viel mehr sagen. Dem Zauber, der diesem Wort innewohnt, kann sich keine entziehen. Sobald sie Marrakesch hören, träumen sie sich in ein Märchen.
Sie träumen nicht von Marokko; das sind zwei Welten, sobald man näher hinsieht. Aber wer will das schon?
„You fly from Genova?“
„No, I go by car.“
„What car?“
„Mercedes.“
„Oh.“
Und schon ist alles klar. Früher kamen Prinzen auf weißen Pferden vorbeigeritten, heute fahren sie Mercedes-Benz. Ein Roadtrip durch Tausendundeine Nacht gefällig? Im Märchen hätte ich sie das gefragt, und sie hätte Ja gesagt. In unserer Welt frage ich, ob sie WLAN haben, und sie sagt Nein. Normalerweise schon, aber seit gestern gibt’s ein Problem.
Im Übrigen habe ich bereits alle Regeln für die Genussreise über Bord geworfen. Seit dem Start in Mühlbachl sind sechs Stunden vergangen, dunkel ist es auch schon seit Langem, und Genua ist nicht mehr das grobe, sondern das definitive Ziel des Tages. Was heißt hier Tag? Wer gegen 14 Uhr aus Mühlbachl startet, ist gegen 20 Uhr knapp 30 Kilometer vor Genova, wenn er nicht wie die Eingeborenen fährt, sondern so brav wie ich. Aber ich hatte es versucht. Ich wollte früher Schluss machen. In der Region Piemont, die für ihre weißen Trüffel und sanft gewellten Weinberge berühmt ist, versuchte ich eine Ausfahrt, aber sie führte mich in eine finstere Industriegegend mit kleinen Tunneln, Schrottplätzen und anderem Wachhundareal. Kein Mensch zu sehen. Auch kein Hotel. Ich konnte auch keins im Internet suchen, weil der Akku meines Handys leer war. Das ist er immer noch. Das Ladekabel habe ich im „Hotel Stolz“ liegen gelassen. Es ist wie ein Fluch. Irgendwas lasse ich immer liegen. Die Prinzessin aus der Autobahnstation hatte zwar eins, aber nicht für Apple. Also Genova. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Ein bisschen heißt, ich kenne ein Parkhaus am alten Hafen und ein Hotel daneben. Gegen 21 Uhr müsste ich da sein. Das ist eine zivile Ankunftszeit.
Es regnet wieder. So geht’s seit Stunden. Regen, Sonne, Regen, und jetzt sogar stark, und weil sich dazu die Berge gesellen, kommt’s mir so vor, als ob nun die anspruchsvolle Phase der Etappe beginnt. Der Apennin rahmt die Bucht von Genua wie ein Schutzwall ein. Nur durch ein Nadelöhr kommt man rein; kleine, gemeine Serpentinen, die durch kleine, gemeine Baustellen zu einem Slalomparcours werden. Ich muss höllisch aufpassen. Aber noch nicht höllisch pissen. Es kommt und geht noch. Gibt’s eigentlich Lieder über so was? Hat Bob Dylan über die Feindschaft zwischen Auto und Blase geschrieben? Oder muss das niemand wissen? Und will das niemand wissen? Ist denn die Wahrheit scheißegal? Meine Ausdrucksweise deutet auf meine Stimmung hin. Ich komme mir wie ein Lkw-Fahrer auf seinen letzten Kilometern vor. Das ist Arbeit. Das ist Maloche. Und wofür? Für den Genuss? Denk nicht solche Sachen. Sonst musst du lachen. Und Lachen findet deine Blase überhaupt nicht witzig.
Nach zwei Tunneln regnet es nicht mehr, aber Steffi beginnt Unsinn zu quatschen. Sie will zum Zentrum der Stadt, ich zum Hafen, und zum Port Genova geht’s nach rechts weiter und nicht geradeaus. Aber sie hört nicht auf, als ich rechts abbiege, sie hört einfach nicht auf, sie will mich zurück in ihre Richtung zwingen, und dass ich sie dabei aufs Übelste beschimpfe, ist wirklich nicht persönlich gemeint. Ich weiß, dass sie nichts dafürkann. Wenn ich ihr nur eine Stadt eingebe, keine Straße, keine Hausnummer, dann schickt sie mich immer ins Zentrum. Ich habe das nicht vergessen, ich sehe vielmehr in Steffis Penetranz eine gute Chance, etwas Druck abzulassen.
Als es mir wieder ein bisschen besser geht, schalte ich sie aus. Sie ist nutzlos geworden. Ich folge den Schildern Richtung Port Genova noch eine Weile auf der Stadtautobahn, bis ich endlich im abendlichen Verkehr einer 500 000 Einwohner zählenden italienischen Hafenstadt feststecke und keinen Schimmer hab, wo ich bin. Hier ist der Hafen, aber nicht der Hafen, zu dem ich will. Der Port ist der Hafen für die Containerriesen, nicht der historische mit den Kolumbus-Kanonenbarken. Der ist vor der Altstadt. Und die ist im Zentrum. Steffi hatte recht.
Ich stell sie wieder an. Und wieder dauert es, bis sich das Navi hocharbeitet, und wieder muss ich das akzeptieren, während ich mich gleichzeitig auf den genuesischen Straßenverkehr konzentriere. Zwischen 21 und 22 Uhr ist der beträchtlich. Und schnell. Und gnadenlos zu einem Verkehrshindernis mit Schweizer Kennzeichen. Einerseits freue ich mich nun über jede rote Ampel, weil alle halten müssen, andererseits verkürzen sie das Zeitfenster, das ich noch bis zum GAU in der Hose habe. Wie gesagt, es kommt und geht, aber irgendwann geht nichts mehr, dann kommt’s nur noch, das ist gewiss. Anhalten, rausspringen, eine Toilette, einen Baum, eine Wand suchen wäre vielleicht eine gute Idee. Und dann Steffi in Ruhe programmieren. Aber finde in diesem Trubel mal einen Parkplatz oder irgendein anderes ruhiges Plätzchen ohne strengstes Halteverbot.
Mir bleiben nur die roten Ampeln, um von Autofenster zu Autofenster Mitmenschen nach dem Weg zum Historic Harbour zu fragen, und jedes Mal ist es dasselbe: Sie geben sich redlich Mühe, sie werfen ihre Hände aus dem Fenster heraus und zeigen geradeaus, dann gabeln sich die Hände, ich muss links, aber dann gleich wieder rechts, aber nicht wirklich rechts, wenn ich die Hände richtig verstehe, sondern nur so halb, und so gestikuliert sich die Route in Rage, bis die Ampel auf Grün umspringt.
Sie sind sehr hilfsbereit, aber sobald der zwischenmenschliche Kontakt abreißt, endet die Fremdenfreundlichkeit oder gar die Freundlichkeit ganz allgemein zwischen den Autofahrern von Genua. Wenn es keine Gesichter mehr gibt, keine Stimme, keinen Charme, kein Charisma, keine Persönlichkeit, ja, nicht einmal mehr einen Hilfe heischenden Blick, sondern nur noch aufgemotztes Blech von den anderen zu sehen ist, wird jede Karre, in der man nicht selbst sitzt, zum Feind, der überholt, abgedrängt, geschnitten, nicht vorbeigelassen oder angehupt gehört. Noch einmal. Das ist nicht persönlich gemeint. Das ist nicht Mensch gegen Mensch, das ist Auto gegen Auto, und man könnte sogar sagen, das ist kein Individualverkehr mehr, sondern wieder so ein Stephen-King-Ding. Eine Verkehrsmonsterkrake mit unzähligen Fangarmen greift in Genova nach mir.
Endlich, Steffi meldet sich zurück und übernimmt. Und was macht die blöde Kuh? Sie führt mich in eine Straße, die grad gesperrt ist. Wahrscheinlich noch nicht lange, seit gestern oder so, denn aktuelle Veränderungen on the road kriegt Steffi manchmal mit und manchmal nicht. Ich weiß auch nicht warum. Nur die Straßenbahn, Busse und Taxis dürfen hier durch. Sieht Papas Benz wie ein Taxi aus? Ja, aber ohne Schild obendrauf. Ich drehe um und langsam auch durch, weil ich weiß, dass das Herumirren nun an sein Ende kommt und der totale Kontrollverlust beginnt. Ich fahre quasi blind. Und brauche noch dazu dringend eine kleine, ruhige Straße, auf der ich mal kurz anhalten kann, weil auch die Rotation der Körpersäfte erneut in Schwung gerät. Eine kleine Seitengasse tut sich zu diesem Zwecke rechts auf, aber kaum bin ich drin, folgt mir ein Fangarm der Monsterkrake und hupt wie bekloppt, als ich stoppen will. Erst am Ende der Gasse kann ich anhalten. Ein Taxistand. Drei freie Plätze, einer besetzt.
Ich steige aus und schau mich um, sehe aber nichts, wo ich mal kurz unbemerkt grob peinlich werden kann. Außerdem lässt der Druck gerade wieder nach. Stattdessen kommt mir eine Idee. Ich geh zu dem Taxi, und ein freundlicher kleiner Engel vom Dienst lächelt mich an. Jeder Tag hat so einen, wenn man genau hinschaut. Mit der Blindfahrerei ist es nun vorbei. Er fliegt voraus zu einem Parkhaus am Hauptbahnhof.
Es liegt nicht um die Ecke, wir machen Strecke, ich folge ihm nur, so gut ich kann. „Ich bin der Herr im Haus“, schreie ich meine Blase an, denn der Druck kommt zurück.
Noch hört sie auf mich, aber als wir das Parkhaus erreichen, ist Schluss damit, und sie gibt ihre devote Haltung auf. Sie beschleunigt die Rhythmen der Druck- und Pausephasen ganz erheblich, und als ich die Einfahrt hinunterrolle, gibt sie die Pausen gänzlich auf und macht nur noch Druck. Die Abfahrt windet sich dazu in engen Kurven, ein hässliches Geräusch erklingt, was mir ein paar Schrammen mehr an der Karosserie einbringt, aber was solls, ich habe andere Prioritäten. Da ist das Parkdeck, es ist fast leer, ich nehme den freien Platz vor der Treppe zum Ausgang. Raus aus der Karre, die Treppe hoch, bis zu der Tür, hinter der wieder eine Treppe ist zur nächsten Tür und zur nächsten Treppe, aber dann bin ich doch noch rechtzeitig draußen und sehe in unmittelbarer Nähe vor mir das ersehnte bisschen Grün, gleichzeitig sehe ich nur etwa 20 Meter rechts von mir eine blonde Frau in Uniform stehen. Ich pisse der Polizei von Genova quasi vor die Füße, aber ich denke, das ist noch immer vernünftiger, als mit einer eingesauten Hose in Hotellobbys nachzufragen, ob sie ein Zimmer frei haben.
„B & B Hotel Genua“. Ein Riesenschuppen am Bahnhofsplatz. Von außen sieht es billig aus, von innen auch. Aber es gibt keine billigen Zimmer für Gäste wie mich. Meine Nerven, meine Knochen, mein Rücken, mein ganzheitlicher Erschöpfungszustand, körperlich, psychisch, seelisch, wecken den Killerinstinkt in jedem Rezeptionisten. Er wittert das Opfertier der Nachtschicht. Das Ritual beginnt.
Ich frage nach einem freien Zimmer, er legt das Gesicht in Sorgenfalten und checkt die Lage in seinem Computer. Das dauert, was niemanden wundert, denn je länger er checkt, desto höher wird der Preis für das letzte freie Zimmer. Ein Fünfbettsaal für 280 Euro. Für WIE VIEL? Er sieht sich um, als müsste er sichergehen, dass wir unbeobachtet sind. Na ja, sagt er leise, er kann es mir auch für 240 geben. Aber wirklich nur für diese eine Nacht. Ich drehe mich um und schaue zum Ausgang, ohne dass ich damit etwas bezwecken will. Es ist einfach nur ein Fluchtinstinkt. O. k., er macht’s für 180, wenn ich keine Rechnung will.
Fuck, ich bin wehrlos. Die Neun-Stunden-Etappe hat alle Kraft abgesaugt. 100 Euro pro Nacht hatte ich im Durchschnitt für die Hotels veranschlagt. Gestern lag ich 33 Euro darunter, heute wird’s italienischer. Ist das ihre ewige Rache für die Frechheiten der Kimbern und Teutonen, oder sind das nur darwinistische Ambitionen? Die Schwachen gehören plattgemacht. Natürlich ist das demütigend. Ich schäme mich, als ich den Preis akzeptiere, ich schäme mich, während ich bezahle, ich schäme mich auf dem Weg zum Fahrstuhl. Ich bin sicher, er schickt mir ein Grinsen hinterher. Hyänen grinsen so wie er. Und im Zimmer schäme ich mich noch mehr.
Die Geschmäcker sind verschieden, aber für mich sollte ein Hotelzimmer weder zu klein noch zu groß sein. Je größer es ist, desto mehr fühle ich mich allein. Und wenn es dann noch mit viermal so vielen Betten, wie ich brauche, zugestellt ist, dreht sich die Medaille auf ihre dunkle Seite, und aus dem Alleinsein wird Einsamkeit. Die gute Nachricht ist die schiere Höhe. Die Stuckdecke des Zimmers befindet sich fünf, sechs, vielleicht auch sechseinhalb Meter über den Betten. Hohe Räume erinnern mich an den Weltraum.
Brauche ich meinen Koffer? Jein. Brauche ich Bier? Unbedingt. Und komme ich an dem Rezeptionisten vorbei, ohne mich wieder dafür zu schämen? Ja, er ist nicht mehr da. Wahrscheinlich verkokst er grad meine Spesen.
Draußen ist nicht mehr viel los. Es ist Sonntag und kurz vor Mitternacht. Nur ein Kiosk am Bahnhofsvorplatz ist noch belebt. Im Parkhaus dann der nächste Glücksmoment. Dem Benz geht’s gut. Er steht im Trockenen, von Videokameras bewacht, der Stern ist noch dran. Ich sehe ihn an wie ein Cowboy, der sein Pferd gut untergebracht hat. Morgen gibt’s leckeren Diesel zum Frühstück, mein Guter, und auf mich wartet jetzt das hochverdiente Feierabendbier am Bahnhofsvorplatz.
Nicht die Crème der Nacht erwartet mich da am Kiosk. Ich akzeptiere das. Hier gehöre ich hin. An den Hangout der Penner von Genua statt an einen wohlgedeckten Gartentisch im Reich der weißen Trüffel, wie ursprünglich mal angedacht. Das ist kein Scheißpech. Das ist Reisekarma. Jeder Regelbruch seit dem Start hat dich genau hierhergebracht. Cheers. Ich bade meine Nerven in dem mildtätigen Alkohol. Und freue mich auf die Gitans.