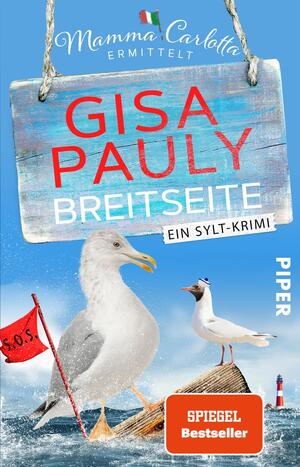1
Carlotta Capella war immer als Erste auf den Beinen. Das war in ihrem Heimatdorf so und auf Sylt nicht anders. In Umbrien sorgte sie dafür, dass ihre Enkel mit viel Großmutterliebe auf den Weg zur Schule geschickt wurden und dass ihre erwachsenen Kinder und Schwiegerkinder sich außer dem obligatorischen Espresso auch mindestens ein paar Kekse gönnten. Auf Sylt versuchte sie, die Rolle ihrer verstorbenen Tochter einzunehmen, also darauf zu achten, dass ihr Schwiegersohn Erik rechtzeitig aufstand, die Kinder pünktlich aus dem Bett kamen und alle ein ausgiebiges Frühstück zu sich nahmen, wie es in Deutschland üblich war. In Italien reichten zwei, drei Zwiebäcke, aber Lucia hatte, nachdem sie Erik an die kalte Nordsee gefolgt war, schnell gelernt, dass hier ein Frühstück anders auszusehen hatte. Wenn sie später mit den Kindern nach Italien zu Besuch gekommen war, wollte sie mit einem Mal auch Käse und Mortadella zum Frühstück essen und manchmal sogar Haferflocken und frisches Obst.
Mamma Carlotta klapperte besonders laut mit dem Geschirr, damit Erik in der ersten Etage hören konnte, dass es Zeit wurde, zum Dienst aufzubrechen, und auch Carolin aus den Federn kam. Seit sie beim Inselblatt arbeitete, stand sie erst spät auf, weil ihr Chefredakteur angeblich auch nie vor zehn in der Redaktion erschien. Und Felix hatte sein Abitur bestanden und begann seinen Tag zurzeit immer erst gegen Mittag. Da konnte sie noch so laut mit Tellern und Tassen scheppern. Allerdings, das musste seine Nonna zugeben, arbeitete er bis in den späten Abend hinein in der neuen Pizzeria, da musste man ihm wohl zubilligen, dass er morgens länger schlief als alle anderen. Das einzige Lebewesen, das Carlotta mit ihrem Lärm aufgeschreckt hatte, war Kükeltje, die schwarze Katze der Wolfs, die verschlafen in der Küche erschien und sich ausgiebig dehnte, bevor sie sich daranmachte, die Frühstücksvorbereitungen zu inspizieren. Sie wusste, dass am Morgen Schinken fürs Rührei gewürfelt wurde und immer ein bisschen für sie abfiel.
Nachdem sie den Tisch gedeckt hatte, legte Carlotta die Brötchen in den Backofen, damit sie später warm und knusprig auf den Tisch kamen, und holte Butter, Marmelade und Käse aus dem Kühlschrank, dazu die Eier, aus denen sie ein Rührei zaubern würde. Ihr selbst drehte sich ja der Magen um, wenn sie der Völlerei am frühen Morgen zusah, aber Lucias Familie war nun einmal daran gewöhnt, also musste alles so bleiben, wenn die Nonna die Mutter ersetzte.
Sie öffnete noch einmal die Kühlschranktür, weil sie den Schinken vergessen hatte, woran Kükeltje sie mit einem kläglichen Maunzen erinnerte. „D’accordo!“
Lächelnd schnitt sie einen Streifen für die Katze ab, ließ ihn über ihrer Schnauze baumeln und lachte, als Kükeltje ihn sich holte und so schnell verspeiste, als hätte sie Sorge, man könne ihr die Beute wieder streitig machen.
Von draußen drang Gepolter herein. Eine Leiter war an die Hauswand gefallen, kurz darauf erschienen zwei Füße in derben Arbeitsschuhen vor dem Küchenfenster.
Mamma Carlotta lief zur Haustür und riss sie auf. „Signor Mattes! Schon so früh bei der Arbeit?“
Der Dachdecker sah von oben auf sie herab. „Acht Uhr ist Arbeitsbeginn. Völlig normal.“
„Naturalmente! Haben Sie denn schon gefrühstückt?“
Mamma Carlotta hatte gleich am ersten Tag eine längere Plauderei mit Peer Mattes begonnen, der das Dach des Hauses auf Vordermann bringen sollte, und alles erfahren, was sie wissen wollte. Das gehörte zu ihren besonderen Eigenschaften. Sie selbst nannte ihre Fähigkeit, andere dazu zu bringen, ihr Herz auszuschütten, freundliche Zuwendung, aber es gab durchaus Menschen, vor allem auf Sylt, die von Neugier redeten und sich nicht ausfragen lassen wollten. So war es in den ersten Stunden auch bei Peer Mattes gewesen, der sich im Ergebnis aber dann doch nicht hatte entziehen können und der Schwiegermutter seines Auftraggebers ausführlich erzählte, dass seine Frau krank und zurzeit in Kur sei. Natürlich hatte Mamma Carlotta auch erfahren, wie schwierig es für den Dachdecker war, neben seinem Beruf den Haushalt und seinen Sohn zu versorgen. Dieser Sohn war zwar schon achtzehn, ein Freund von Felix, der ebenfalls gerade das Abitur bestanden hatte, aber Mamma Carlotta sah ohne Weiteres ein, dass auch ein Kind im Erwachsenenalter noch liebevolle Betreuung gebrauchen konnte.
„Ja, ja“, brummte Peer Mattes zurück. „Ich habe schon was im Magen.“
Aber Carlotta hatte bereits am Tag zuvor aus ihm herausgefragt, wie das aussah. Im Stehen ein Kaffee und im Weggehen eine Scheibe Brot, manchmal auch beim nächsten Bäcker ein belegtes Brötchen. Ein unerträglicher Gedanke, dass die Familie Wolf im Haus ein gemütliches Frühstück einnahm, während jemand auf dem Dach einer schweren Arbeit nachging, ohne dass er vorher für die nötige Stärkung gesorgt hatte.
„No, no“, gab sie zurück. „Sie müssen erst etwas Richtiges zu sich nehmen. Ich habe schon für Sie gedeckt.“
Das stimmte nicht, ließ sich aber schnell nachholen, sodass aus der frommen Lüge im Nu Wahrheit geworden war. „Der Mitarbeiter meines Schwiegersohns wird auch gleich da sein.“
Das stimmte auf jeden Fall. Sören Kretschmer hatte sich längst angewöhnt, jede Mahlzeit im Hause seines Chefs einzunehmen, wenn dessen Schwiegermutter zu Besuch war. Gelegentlich fühlte er sich bewogen, diese Sitte infrage zu stellen, um dann zu hören zu bekommen, dass er selbstverständlich erwartet wurde und Mamma Carlotta tödlich beleidigt wäre, wenn er sein Frühstück woanders einnähme. Dann ließ er sich immer besonders zufrieden am Tisch nieder und genoss alles, was sie ihm vorsetzte. Bis zum nächsten Mal, wenn er erneut so tat, als wäre es ihm unangenehm, sich von der Schwiegermutter seines Chefs beköstigen zu lassen.
2
Erik wechselte gerade vom Bad ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen, als er hörte, dass die Haustür ging. Die tiefe, ruhige Stimme, die kurz darauf ertönte, gehörte nicht Sören, also hatte seine Schwiegermutter mal wieder den Dachdecker ins Haus geholt. Sie gab ja keine Ruhe, wenn sie von einem Menschen wusste, dem es an Zuwendung fehlte, vornehmlich von einem Mann, der ohne weibliche Betreuung auskommen musste. Sie machte es hier einfach genau wie in ihrer Heimat, wo es jedoch üblicher war als auf Sylt, dass ein Postbote einen Espresso bekam, wenn er besonders viele Briefe ablieferte, oder die Männer der Müllabfuhr auf ein kaltes Getränk an die Haustür gebeten wurden. Peer Mattes, der Dachdecker, würde sich vermutlich nicht entziehen können, denn er war überdies der Vater von Felix’ Freund, fiel damit in die Kategorie der guten Bekannten und hatte sich so gewissermaßen den Anspruch erworben, neben seiner Arbeit auch noch beköstigt zu werden. Dass Peer Mattes das ganz anders sah, wusste Erik genau, und dass dem Mann die Fürsorge seiner Schwiegermutter oft ganz schön lästig war, ebenfalls. Aber so viel sich Mamma Carlotta auch auf ihr Fingerspitzengefühl einbildete, es versagte vollkommen, wenn sich jemand ihrer Bemutterung entziehen wollte.
Erik kontrollierte im Spiegel sein Erscheinungsbild, strich sich den Schnauzer glatt, auf den er immer große Sorgfalt verwendete, und fuhr sich durch die Haare, ohne danach jedoch zufriedener zu sein. Er zog den Bauch ein, weil seine Jeans ihn drückte. Hatte er etwa schon wieder zugenommen? Himmel, er musste endlich Sport treiben! Wie lange nahm er sich das schon vor! Er betrachtete sein Profil und stellte erschrocken fest, dass sein Bauch sich über den Gürtel wölbte, den er durch den Bund der Jeans gezogen hatte. War das gestern auch schon so gewesen? Entschlossen öffnete er den Schrank erneut und holte einen seiner geliebten Pullunder heraus, einen, den noch Lucia für ihn gestrickt hatte, marineblau mit roten und weißen Querstreifen über der Brust. Noch war es ja kühl, Wolle auf Brust und Rücken konnte nicht schaden. Und der Pullunder verdeckte wunderbar die Stelle, an der sich sein Bauch zeigte.
Er ging die Treppe hinab und begrüßte den Dachdecker, der gerade aus seinen schmutzigen Schuhen stieg. „Moin, Herr Mattes. Wie geht’s?“
Ein unverständliches Brummen war die Antwort, völlig normal für einen Friesen, von dem Erik keine ausführliche Beschreibung seines Gemüts- und Gesundheitszustandes erwartet hätte.
Sören Kretschmer erschien wenige Minuten später. Die Melodieklingel der Familie Wolf, die seit ein paar Jahren jeden Besucher erfreute, kündigte ihn mit dem Marsch Alte Kameraden an. Eine Melodie, die Sören unbekannt war. In seiner Generation kamen Marschmusik und die Verherrlichung des Kameradentums nicht mehr vor.
Er war um einiges jünger als Erik, viel schlanker und viel sportlicher als er. Sören besaß aus Überzeugung kein Auto, fuhr jede Strecke mit seinem Rennrad, joggte regelmäßig und war so fit, wie Erik gern wäre. Seinem Mitarbeiter fühlte Erik sich nur in einer Sache überlegen: Sein drahtiger Haarschopf war noch so dicht wie eh und je. Sören dagegen hatte dünnes blondes Haar, das schon schütter wurde, mit Geheimratsecken und einer lichten Stelle auf dem Kopf. Wenn seine Haare vom Wind zerzaust waren, sahen sie aus wie Glaswolle.
Sören wunderte sich nicht, dass der Dachdecker wie am Tag zuvor auch an diesem Morgen am Tisch hockte. Er setzte sich zu ihm und strahlte Mamma Carlotta an. „Soll ich Ihnen beim Schinkenwürfeln helfen?“
Aber wie erwartet wehrte sie ab. Hilfe in der Küche war ihr meist nur lästig. Menschen mit vorgeblich helfenden Händen standen ihr im Weg, fragten zu viel und machten dann doch alles falsch.
An ihr Tempo kam sowieso niemand heran. Der Schinken wurde in Rekordzeit gewürfelt und brutzelte schon in der Pfanne, als Erik noch nicht von der Sorge befreit war, seine Schwiegermutter könnte sich einen Finger amputieren. Meistens sah er einfach nicht hin, wenn sie in mörderischem Tempo mit einem scharfen Messer hantierte. Erstaunlich, dass so selten etwas passierte. Trotzdem kontrollierte er jedes Mal, wenn Mamma Carlotta auf Sylt erwartet wurde, die Vollständigkeit seines Erste-Hilfe-Koffers. Sicher war sicher.
Peer Mattes war schnell mit dem Rührei fertig, bedankte sich und verkündete, dass es nun Zeit würde, an die Arbeit zu gehen. „Die macht sich schließlich nicht von allein.“
Er verließ das Haus in Kükeltjes Begleitung, die, seit Peer Mattes auf dem Dach des Hauses arbeitete, stundenlang am Fuß der Leiter stand und staunend nach oben blickte. So, als bewunderte sie den Dachdecker für seinen Mut, den sie selbst offenbar nicht aufbrachte.
Mamma Carlotta sah ihm mit gerunzelter Stirn nach. „Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Er wird doch nicht krank werden?“
Erik zuckte mit den Schultern. Ihm war nichts aufgefallen. Peer Mattes war so wortkarg wie immer gewesen, warum Mamma Carlotta also glaubte, dass sein Gesundheitszustand heute anders war als gestern, blieb Erik schleierhaft. Und wenn er ehrlich war, interessierte ihn daran auch nur, ob die Dachsanierung weitergehen konnte, wenn Peer Mattes sich mit Grippe ins Bett legte. Vor dem nächsten Winter sollte sein saniertes Dach eine optimale Dämmung erhalten haben, damit er Heiz- und Energiekosten sparen konnte.
Er besprach mit Sören die Arbeit, die an diesem Tag anstand, und freute sich mit ihm zusammen darüber, dass es zurzeit kein Kapitalverbrechen gab, das sie voll und ganz in Anspruch nahm. Ein bequemer Tag im Polizeirevier erwartete den Kriminalhauptkommissar und seinen Mitarbeiter. Sie konnten sich viel Zeit beim Frühstück lassen und würden zum Mittagessen wieder im Süder Wung erscheinen können.
In der ersten Etage klappte eine Tür, Carolin war aufgestanden. Dass sie ihre Hotellehre vor der Abschlussprüfung aufgegeben hatte, bedrückte Erik noch immer. Und dass sie sich ausgerechnet entschlossen hatte, ein Volontariat beim Inselblatt zu machen, war ihm ein echtes Ärgernis. Den Chefredakteur Menno Koopmann hatte er noch nie leiden können, aber nun würde er ihm wohl konziliant begegnen müssen, weil er der Chef seiner Tochter geworden war. Wirklich höchst unerfreulich!
Er stieß Sören an. „Komm, lass uns gehen. Wir könnten uns heute mal um die Ablage kümmern.“
Die Haustür war schon hinter ihnen ins Schloss gefallen, sie gingen auf Eriks Auto zu, als sein Handy klingelte und sich die Sache mit dem bequemen Arbeitstag kurz darauf erledigt hatte …
3
Carolins Haare waren noch feucht, als sie sich an den Frühstückstisch setzte, ihr Gesicht glänzte, die Wangen waren rosig. Sie sah frisch und unternehmungslustig aus.
Mamma Carlotta betrachtete ihre Enkelin zufrieden. „Macht dir die Arbeit fürs Inselblatt Spaß?“
Carolin biss in ihr Brötchen und kaute, während sie antwortete: „Mehr als die Arbeit im Hotel.“
„Und Menno Koopmann? Dein Vater kann ihn nicht leiden. Er sagt, der Chefredakteur ist ein unangenehmer Mensch.“
„Stimmt. Aber er lässt mich einfach machen, und das gefällt mir.“
„Du bist eine Volo … Volon … come si dice?“ Sie wartete Carolins Antwort nicht ab. „Ein Lehrling. Du musst erst lernen, wie eine Giornalista zu arbeiten hat.“
„Learning by doing.“ Erklärend fügte Carolin an: „Einfach machen, dann lernt man am schnellsten und besten. Das meint Koopmann jedenfalls.“
Mamma Carlotta saß kopfschüttelnd da. Einfach machen lassen? Das konnte sie sich nicht vorstellen. Ließ man einen Schneiderlehrling einen Saum nähen, wenn er es noch nicht gelernt hatte? Oder einen Schreinerlehrling mit dem Hobel umgehen, der nicht wusste, was man damit alles falsch machen konnte? No!
„Heute soll ich über das neue Speeddating berichten.“
Schon wieder ein englischer Begriff? Mamma Carlotta runzelte ärgerlich die Stirn. „Was soll das nun wieder heißen?“
„Speeddating für reife Singles!“ Carolin strahlte, als hätte sie damit irgendetwas erklärt. „Unter den Touristen auf Sylt gibt es viele Singles über fünfzig.“ Nun schien sie zu merken, dass ihre Großmutter ärgerlich wurde. „Nonna, das gibt es in Amerika schon lange. Speed heißt Schnelligkeit und Dating … da lernt man sich kennen, man trifft sich, verabredet sich. Du würdest vermutlich Rendezvous sagen. Oder Appuntamento.“
„Appuntamento veloce?“
Carolin wurde nun geschäftsmäßig. „Also, beim Speeddating kann man an einem einzigen Abend gleich mehrere Leute kennenlernen, mögliche Partner, verstehst du?“
Nein, Mamma Carlotta verstand kein Wort. „Cosa si può fare?“
„Ein Mann und eine Frau können sich sieben Minuten lang unterhalten, dann wird gewechselt. Ehrlich, Nonna, man merkt doch im Grunde schnell, schon in den ersten fünf Minuten, ob man sich in einen Typ verknallen könnte oder nicht. Aber bei einem normalen Date musst du noch den ganzen Abend mit dem Kerl in der Bar hocken und hinterher womöglich lange erklären, warum du ihn nicht noch einmal daten willst. Speeddating ist unverbindlich, und vor allem lernst du an einem Abend gleich ein Dutzend Männer kennen. Die, die dir nicht gefallen, hakst du ab, ohne Erklärungen abgeben zu müssen. Und wenn dir einer gefällt, kannst du dich noch einmal mit ihm verabreden.“ Carolin lachte in das konsternierte Gesicht ihrer Großmutter. „Wenn du dir einen neuen Fernseher kaufst, schaust du dir doch auch erst alle Modelle an, die infrage kommen, und vergleichst einen mit dem anderen. Was spricht dagegen, es mit einem möglichen Partner auch so zu machen?“
Nach Mamma Carlottas Meinung sprach eine Menge dagegen, aber sie ahnte, dass ihre Ansichten altmodisch genannt werden würden, und schluckte sie deshalb hinunter. „Und wie geht so was?“
„An sieben Tischen sitzen sieben Frauen. Sieben Männer setzen sich zu jeweils einer von ihnen, und dann haben die beiden sieben Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Danach wird gewechselt, die Männer rücken zur nächsten Frau vor. Am Ende kann sich jeder überlegen, ob er an einem der sieben möglichen Partner Interesse hat. Wenn einem jemand gefällt, kreuzt man denjenigen auf einem Fragebogen an. Matcht es …“
„Matsch?“ Mamma Carlotta war entgeistert. „Fango?“ Was sollte das nun wieder?
„Matchen heißt, dass es Übereinstimmungen gibt, dass auch der andere Interesse hat. Und dann organisieren die Veranstalter ein Folgedate. Ansonsten braucht man sich keine Gründe zu überlegen, warum man ein Date nicht fortsetzen will, warum man jemanden nicht wiedersehen will, warum man die eigene Telefonnummer nicht rausrücken will. Ist doch super!“
Mamma Carlotta nickte zwar, hätte aber lieber den Kopf geschüttelt. Wenn sie an ihre Jugend dachte, fand sie die Art und Weise, wie man sich damals kennenlernte und wie Beziehungen zustande kamen, wesentlich spannender.
„Vor allem für ältere Leute“, fuhr Carolin fort, „die keine Zeit mehr zu verlieren haben. Die wollen sich nicht mehr in einen Partner vergucken, der in Wirklichkeit gar keine feste Beziehung haben will. Die wollen jemanden kennenlernen, der die gleichen Vorstellungen hat. Alles andere wäre reine Zeitverschwendung. Total fair, das Ganze!“ Carolin schob sich ihren letzten Bissen in den Mund und stand auf. „Um zehn habe ich bei den Veranstaltern einen Termin. Ich hoffe, ich darf beim nächsten Speeddating dabei sein und sogar fotografieren. Oder ich finde jemanden, der bereit ist, mir später davon zu erzählen. Vielleicht sogar zwei Leute, die sich verliebt haben.“ Sie griff nach ihrer Umhängetasche und stülpte sich im Flur ihren Helm auf. Verschmitzt zwinkerte sie ihrer Großmutter zu. „Karla Kolumna, die rasende Reporterin! Tschüsselchen!“
Mamma Carlotta blieb in der offenen Tür stehen und sah zu, wie Carolin ihren Motorroller aufschloss, den sie sich von ihrem ersten Gehalt geleistet hatte, sich auf den Sattel schwang, den Motor startete und winkend den Süder Wung hinabknatterte. Ihre kleine Carolina! Bis zur Pubertät war sie schüchtern und unauffällig gewesen. Dann war eine Zeit gekommen, in der ihre Nonna ungern mit ihr zusammen einkaufen ging, weil sie sich für ihre Enkelin schämte, die damals Frisuren trug, die an ramponierte Vogelnester erinnerten, und ein Make-up im Totengräberlook. Mit der Ausbildung im Hotelgewerbe hatte sich dann ihr Erscheinungsbild erneut geändert. Mit einem Mal sah sie seriös aus und gab sich auch so. Dann folgte das unsägliche Intermezzo mit Maximilian Witt, dem Reporter, mit dem sie sogar eine Weile in Hamburg gelebt hatte. Und seitdem kleidete und schminkte Carolin sich wieder unauffällig, legte aber Wert darauf, unkonventionell auszusehen. Also auf keinen Fall klassische Röcke, wie der Hotelbesitzer es von ihr verlangt hatte, sondern lässige Jeans und Hoodies oder Shirts. Mamma Carlotta erinnerte sich, dass sie Carolin früher manchmal die Geschichten von Karla Kolumna und Bibi Blocksberg vorgelesen hatte. Auch während dieser Zeit war Carolin immer mit dem für Karla typischen „Hallöchen“ erschienen und hatte sich jedes Mal mit „Tschüsselchen“ verabschiedet.
Mamma Carlotta lächelte in sich hinein, als sie die Haustür schloss. Hatte Carolin nun wirklich den richtigen Beruf gefunden? Dass sie für einen Mann arbeitete, den Erik nicht leiden konnte, machte Carlotta zu schaffen. Hoffentlich ging das alles gut! Während sie die Küche aufräumte, die Teller zusammenstellte und das Geschirr in die Spülmaschine packte, gestand sie sich ein, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn Carolin die Ausbildung im Hotel Horizont beendet und anschließend als Hotelkauffrau gearbeitet hätte …