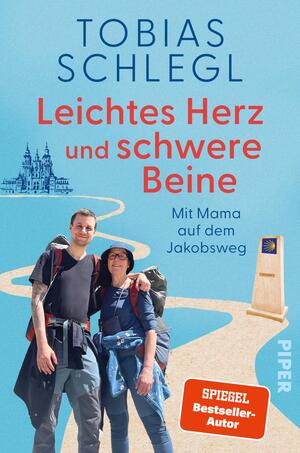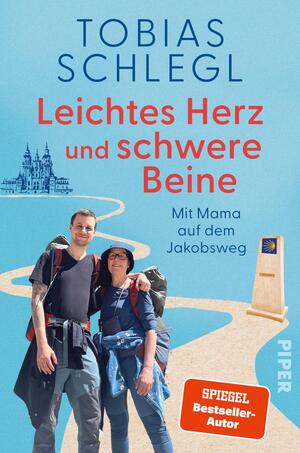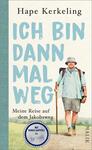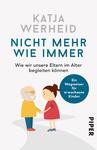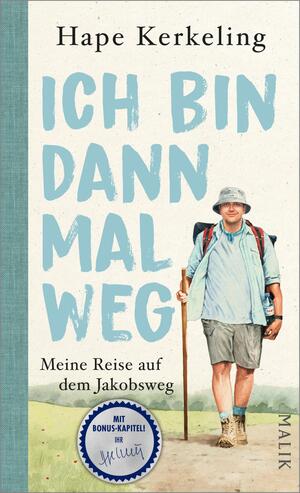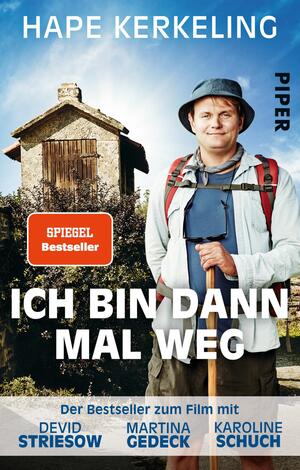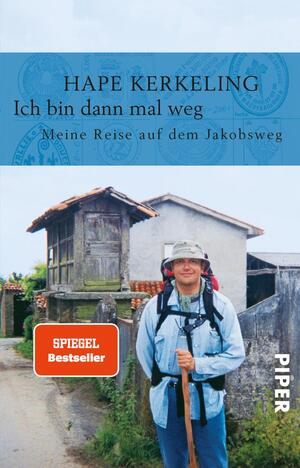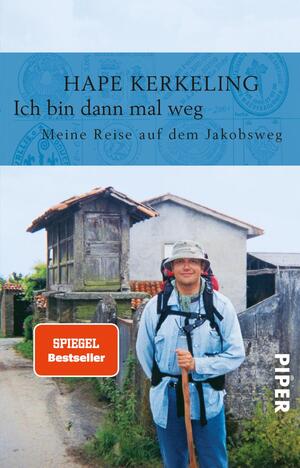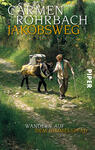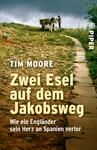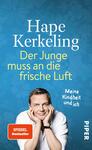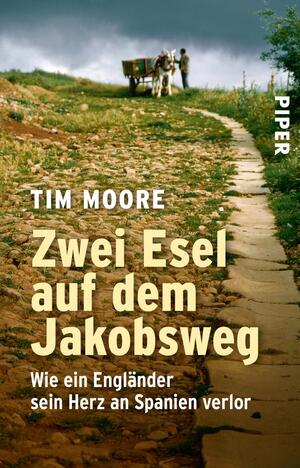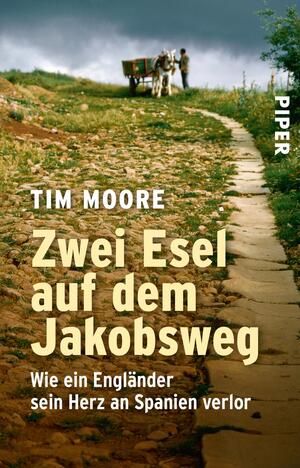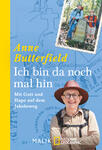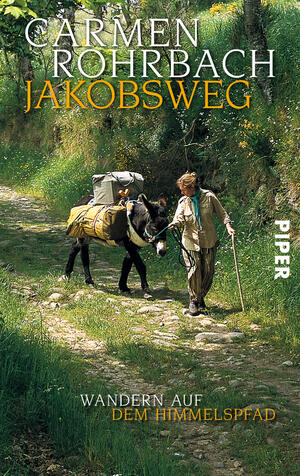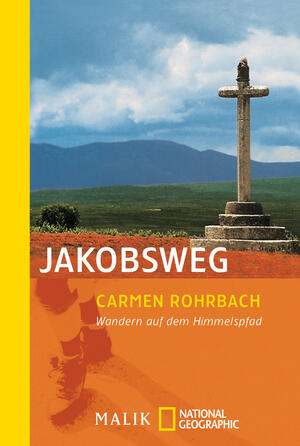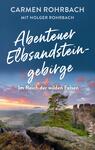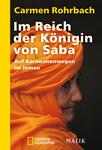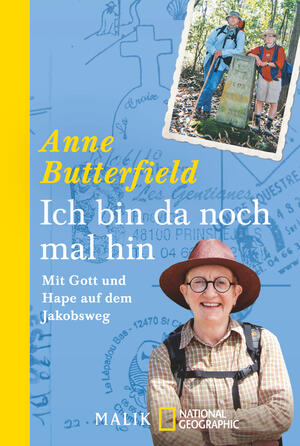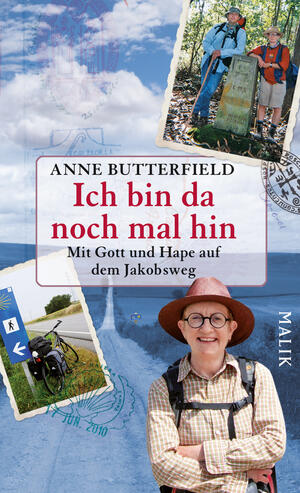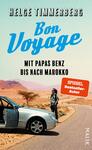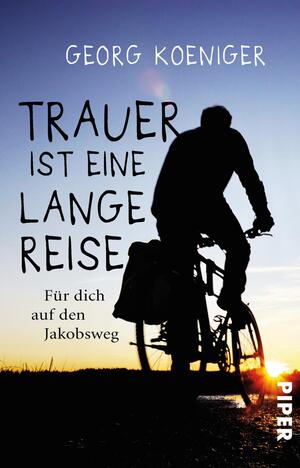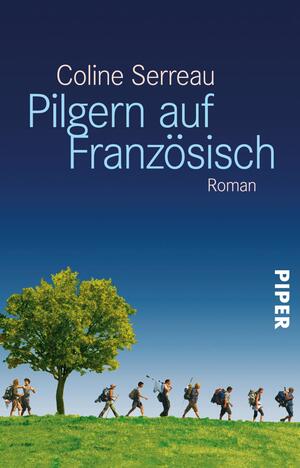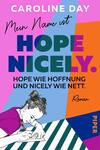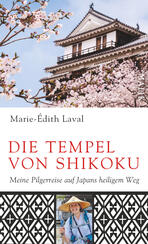Tag 1:
13. September
Pamplona (0 km)
Etagenbett an Etagenbett. Weiße Matratzen in schwarz lackierten Metallgestellen. Es quietscht, wenn ich mich auf die andere Seite drehe. An der Wand, neben der Steckdose, klebt eine Zahl: Die Schlafplätze sind durchnummeriert, von 1 bis 120. Wir haben die 65 und 66 ergattert.
Albergue Municipal de Peregrinos – Iglesia de Jesus y Maria: eine Herberge für 120 Menschen in einem riesigen Raum, der sich über zwei Etagen erstreckt. Einst war das hier das Schiff einer Kirche, viel Luft also, auch über uns im Gewölbe, und trotzdem schnürt es mir den Atem ab. Nicht wegen der Körperausdünstungen der anderen, nein, es riecht seltsamerweise klinisch, vor allem nach Insektenspray, vermischt mit Desinfektionsmittel.
Unsere Plätze liegen auf der oberen Ebene; stehen wir vom Bett auf, können wir über ein Geländer nach unten schauen. Ich hatte vor zu duschen, bin aber rückwärts wieder raus. Nach Geschlechtern getrennte Waschräume gibt es nicht. Als ich die Tür öffnete, hoben drei nahezu nackte Damen ihre Köpfe und schauten mich an, mit großen Bitte-bitte-Augen, wie der gestiefelte Kater in Shrek. Bitte, bitte, geh wieder. Ich habe ihnen den Wunsch umgehend erfüllt.
Gerede und Rufe hallen zu uns nach oben. Ich bin hundemüde, weiß aber nicht, wie ich bei dieser Lautstärke einschlafen soll. Auch Ohrstöpsel helfen nicht.
Die Anreise vom Flughafen Pamplona zur Herberge war chaotisch. Erst haben wir die Bushaltestelle nicht gefunden, dann standen wir auf der falschen Straßenseite und stiegen schließlich zu spät aus, sodass wir wieder zurückfahren mussten. Der Busfahrer hatte kein Erbarmen und ließ uns für zwei Stationen noch mal den vollen Preis zahlen. Obwohl meine Mutter tapfer auf ihn eingeredet hat – auf Deutsch. Er antwortete unbeirrt – auf Spanisch.
Ich frage mich, warum ich mir das antue – Wandern gehört wirklich nicht zu meinen Leidenschaften. Es gibt darauf nur eine Antwort: Ich tu’s für meine Mutter. Das hier ist ihr Traum, schon immer gewesen. Der Jakobsweg. Der echte. Der Camino Francés.
Sieglinde weiß natürlich, dass sie nicht mehr die Jüngste ist. Wenn, dann muss es jetzt passieren, bevor ihr Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Dabei kenne ich wenige 73-Jährige, die so fit sind wie meine Mutter. Ich bin sicher, sie wird mir davonlaufen. Sie hat lediglich eine Herzinsuffizienz ersten Grades, weshalb der Hausarzt empfohlen hat, die drei Tage durch die Pyrenäen am Anfang des Wegs zu überspringen und in Pamplona zu starten.
Mehr als 700 Kilometer sind es von hier bis Santiago de Compostela. 700 Kilometer, auf denen ich hoffe, meine Mutter besser kennenzulernen. Sie wieder kennenzulernen. Zum ersten Mal kennenzulernen. Einen Fragenkatalog habe ich nicht dabei. Ich möchte es einfach geschehen lassen, Zeit mit ihr verbringen. Das ist mein Antrieb, deshalb bin ich ihre Begleitung.
Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht richtig weiß, wer sie eigentlich ist, abseits ihrer Rolle als Mutter. Was sie antreibt, wie sie früher war, welche Träume sie hatte und welche davon noch übrig sind.
Mal keine Themen beiseiteschieben, offen sein. Reden und zuhören. Da sein. Das will ich. Nur wir zwei, ohne Ablenkung und kurze Zeitfenster. Es ist eine einmalige Chance. Hätte ich sie nicht genutzt, würde ich mir das später vorwerfen.
Und so haben wir uns aufgemacht, zwei – trotz der gemeinsamen Vergangenheit – ziemlich unterschiedliche Menschen in einer Schicksalsgemeinschaft, mit einer gewaltigen Aufgabe vor sich.
Und gleich am ersten Tag in der Herberge im Kirchenschiff habe ich Angst, mir einen Fußpilz oder Schlimmeres einzufangen. Ich hasse Bettenlager. Aber ich komme nicht drum herum; Sieglinde ist eine sparsame Frau, sie will keine 70 Euro für ein Hotelzimmer ausgeben. Das könnte sie sich zwar leisten, aber die Sammelunterkunft kostet nur elf Euro pro Nacht. Und sie braucht „diesen Luxus“ nicht. Was mich angeht, bin ich mir da nicht so sicher. Ich bin verwöhnt. Hatte schon mit 17 Jahren eine EC-Karte, und seitdem kommt immer Geld aus dem Automaten.
Morgen geht es richtig los. Und ich weiß, es wird wehtun. 24 Kilometer bis Puente la Reina. Ich hoffe, ich übernehme mich nicht. Ich hoffe, meine Mutter übernimmt sich nicht. Ich bin ihre Begleitung, ich muss auf sie aufpassen.
Bevor wir uns hier einquartiert haben, wurden wir übrigens abgewiesen. An der ersten Unterkunft, die wir in Pamplona vollgeschwitzt aufgesucht haben. Es war die Casa Paderborn – ein kleines Haus mit 26 Betten. Die Herberge hatte noch genau einen Platz frei.
Diesmal hat Sieglinde den Shrek-Kater gemacht. Bitte, bitte, lass mich hierbleiben. Sie war fertig vom Tag. Um 2.30 Uhr aufstehen. Flieger nach Pamplona. Buschaos. Durch die Stadt irren. Sie wollte das Zimmer. Sich ausruhen und ihre Müsliriegel knabbern. Es wäre okay für mich gewesen.
Meine Mutter war schon mit einem Fuß über die Türschwelle. Aber dann hat sie mir ins Gesicht gesehen. Zwei Sekunden. Und gesagt:
„Nein, wir machen das gemeinsam.“
Tag 2:
14. September
Pamplona–Puente la Reina (24,0 km)
Die Nacht ist die Hölle. Als ich gegen zwei Uhr zur Toilette muss und die schmale Leiter des Etagenbetts hinabsteige, hebt meine Mutter den verwuschelten Kopf und fleht:
„Herr, lass diese Nacht schnell vorübergehen!“
Ich bin schon vor dem Wecker wach, um 4.30 Uhr, und will einfach nur los. Lieber zu einer unchristlichen Zeit pilgern, als noch länger hierzubleiben. Im Bett neben uns, Luftlinie eineinhalb Meter von meiner Mama, schläft ein Spanier. Auf seine Wange ist ein kleines schwarzes Kreuz tätowiert, auf dem breiten Rücken prangt ein großes, das wir gestern bewundern konnten. Jetzt holzt er einen Wald ab.
Beim Zähneputzen postiert sich eine Endfünfzigerin hinter mir. Ich spüre ihre Ungeduld. Schließlich drängt sie sich neben mich:
„Sorry, now it’s my turn!“ Dazu ein Knuff in die Hüfte.
So erobert man sich das Waschbecken.
Ich schwöre mir, dass wir nie wieder in einem Raum mit 120 Leute übernachten werden. Niemals. Sieglinde ist ganz meiner Meinung.
Es ist noch dunkel, als wir aufbrechen. Ich bewundere meine Mutter dafür, dass sie ohne Frühstück losziehen kann. Für mich gab es Studentenfutter und eine bräunliche Banane, die ich noch am Flughafen gekauft hatte.
Nachdem wir zehn Minuten über das Kopfsteinpflaster Pamplonas gewandert sind, wird mir klar, was in den kommenden Wochen ein großes Problem für mich werden dürfte: der Rucksack. Er ist mit seinen dreizehn Kilo (zwölf Kilo Gepäck und ein Liter Wasser) deutlich zu schwer. Je nach Körperhaltung zieht er mich nach hinten oder drückt mich nach vorn. Die Schultern schmerzen. Shit. Vielleicht kann ich noch was rausschmeißen. Dabei bin ich meine Sachen bereits unzählige Male durchgegangen. Das Ding ist: Ich habe Technik dabei. Ich schreibe Tagebuch auf meinem Laptop, der steckt in einer Schutzhülle und braucht ein Ladekabel. Einen Zusatz-Akku habe ich für den Notfall auch mitgenommen. Das alles wiegt etwa zwei Kilo.
Ein paar Nussvorräte kommen noch dazu, als eiserne Reserve. Mit dem Essen ist es bei mir so ein Thema. Seit meinem 15. Lebensjahr verzichte ich auf Fleisch. Damals hatte ich eine Dokumentation über Tiertransporte gesehen und bekam die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ich hörte von heute auf morgen auf mit Fleisch. Das bedeutete auch, von da an das jährliche Weihnachtsmenü (Gulasch mit Klößen) und Silvesteressen (Fleischfondue) zu verschmähen. Meine Eltern waren not amused.
„Jetzt stell dich nicht so an, das kommt alles vom Fleischer an der Ecke, den kenn ich doch“, sagte meine Mutter, als an Silvester ein Teller mit Fleischwürfeln vor mir stand, trotz meiner Ankündigung. Ich habe nichts runterbekommen.
„Weißt du eigentlich, wie teuer das war?“
Spanien ist ein Land der Fleischesser. Mir ist klar, dass das nicht einfach werden wird.
Nun also raus aus Pamplona, rein in die Weite Navarras. Der Morgen hat sich den Himmel erobert, schönstes Blau, Schleierwolken. Die Landschaft: beige, braun, verdorrt – selbst das Grün der Sträucher und Bäume wirkt matt, ausgetrocknet. Olivenbäume. Mandelbäume. Walnussbäume. Schrumpelige Sonnenblumen. Und verkohlte Brandflächen, die Narben Spaniens – der Sommer war wieder der heißeste seit Aufzeichnungsbeginn. Wasser, ich brauche Wasser, schreit die Landschaft einem entgegen.
Überall liegen Steine, immer nur Steine. Und Steinhaufen plus Steinmännchen, denn Pilger spielen offenbar gerne mit Steinen. Sie legen sie ab und befreien damit ihre Herzen von Ballast.
Auch meine Mutter hat Ballast dabei. Wir haben ein angenehmes Tempo gefunden, ich gehe jetzt im T-Shirt, die Jacke hinten festgeschnürt, da lässt sie die Katze aus dem Sack. Beziehungsweise den Hund.
„Ich wandere aus einem bestimmten Grund. Ich will, dass die Trauer um Lara nicht mehr so schmerzhaft ist“, sagt sie und atmet tief, damit keine Tränen kommen.
Ich bin überrascht. Das ist also ihr Anlass, diesen Weg zu gehen. Sie verspricht sich Heilung. Es ist ein Jahr her, dass Lara gestorben ist. Sie stammte aus Italien, eine Straßenhündin, mittelgroß, honigfarbenes Fell, sehnig und schnell. Anfangs war es alles andere als einfach mit ihr. Immer, wenn ich zu Besuch kam, verkroch sie sich zitternd unter Mamas Stuhl. Sie muss als junger Hund Traumatisches erlebt haben. Mit Artgenossen konnte sie gut; fremde Menschen, besonders Kinder, flößten ihr eine Heidenangst ein. In Italien landete sie in einer Auffangstation, von dort kam sie mit etwa acht Monaten zu meinen Eltern. Und Mama schaffte es, mit viel Hingabe und Geduld, dass dieser Hund wieder Vertrauen fassen konnte, auch zu mir. Zunächst ertrug sie, dass ich ihr den Kopf streichelte, wenn auch nur kurz und mit eingezogenem Schwanz. Schließlich akzeptierte sie mich als Rudelmitglied und entspannte sich.
Lara wurde eine aufmerksame, freundliche, ausgeglichene Hündin – zumindest, wenn meine Eltern anwesend waren. Ließen sie sie allein oder bei mir, war sie ein Schatten ihrer selbst und rührte sich so lange nicht weg von der Tür, bis die beiden zurückkehrten. Und so passten sie ihren Alltag Laras Bedürfnissen an – wo der Hund nicht mitkonnte, gingen sie nicht hin, zumindest nicht zu zweit. Eine große Liebe, auf beiden Seiten: Laras Dankbarkeit und Ergebenheit vor allem Sieglinde gegenüber waren deutlich spürbar.
Doch auch Lara wurde älter. Mit dreizehn Jahren stand sie nur noch wackelig auf den Beinen. Jeder Schritt schien zu schmerzen. Dann verweigerte sie ihre Nahrung. Meine Mutter versuchte alles. Lara bekam Spezialfutter und viel Leberwurst, in der Pillen gegen die Schmerzen versteckt waren. Irgendwann aß sie gar nichts mehr. Es brach Mama das Herz, ich hatte sie lange nicht mehr so niedergeschlagen gesehen.
Aber selbst in dieser Situation war Sieglinde die Handelnde. „Ich fahre jetzt zum Tierarzt, damit der ihr die Spritze gibt. Sie soll nicht mehr leiden.“
Lara, nur noch Haut und Knochen, wurde eingeschläfert. Und starb im Kofferraum des Autos meiner Eltern, auf ihrer Hundedecke, Mama saß neben ihr und streichelte sie.
Wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Loszulassen. Sie hat Lara einfach über alles geliebt. Viel zu lange haben wir nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe die Sache erfolgreich verdrängt, während sie bei meiner Mutter dauerpräsent sein muss.
Kilometer elf, und der Schulterschmerz strahlt hoch in den Nacken und runter ins Kreuz. Der Jakobsweg heißt Leiden. Man weiß es vorher, doch jeder denkt insgeheim, bei mir wird es anders, ich bin besser vorbereitet. Falsch gedacht. It’s real. Aber noch fliegen meine Füße über den steinigen Weg. Auch als er ansteigt, ist das kein Problem, jedenfalls nicht für Beine und Knie. Aber diese Schultern, verdammt. Ich werfe einen Blick zu meiner Mutter, sie schaut mich an. Es geht ihr ähnlich.
Und dann hören wir von einer Geschichte, die mich schwer beschäftigen wird. Hinter dem steilsten Stück des Anstiegs liegt ein winziger Ort: eine Straße, eine Kirche, ein Shop – für uns wie eine Oase in der Wüste. Die Auswahl umfasst nicht viel mehr als ein Schinkensandwich in der Theke und den Joghurt im Kühlschrank. Wir kaufen beides und verschlingen es auf einem Mäuerchen vor der Kirche, ich den Joghurt, meine Mutter das Sandwich.
Sieglinde quatscht zwei Frauen an, Deutsche, die eine hochgewachsen, die andere leuchtend orange gekleidet. Sie haben lediglich kleine Rucksäcke dabei, weil sie den Camino nur für fünf Tage laufen wollen. Frechheit.
Zu den Frauen gesellt sich ein Mann, Typ wettergegerbt und jung geblieben, ein Deutsch-Spanier. Er hat seinen Wohnsitz nach Spanien verlegt und zeigt sich gern einfach so auf dem Camino, um mit den Touris zu plaudern – auf der Suche nach weiblichen Bekanntschaften, so scheint es mir. Jedenfalls ist er ganz offensichtlich an den beiden Freundinnen interessiert, weniger an meiner Mutter und überhaupt nicht an mir. Wir hören trotzdem zu.
Er berichtet von einem älteren Pilger, der vor einigen Tagen durch diesen Ort gekommen ist und dann den holprigen Pfad hoch zum Memorial Fosas de la Sierra del Perdón genommen hat. Auf dem Weg kippte er um und starb. Einfach so, jede Hilfe zu spät. Der Mann hat es mit eigenen Augen gesehen.
Ich bin verstört. Die beiden Damen haben es plötzlich eilig aufzubrechen, und der Mann verstummt. Ich traue mich nicht nachzuhaken. Wer war dieser Alte? Warum ist er umgekippt? Welche Geschichte steckt dahinter? Welches Leid? Hat jemand (der Deutsch-Spanier vielleicht) Erste Hilfe geleistet? Übliche Notfallsanitätergedanken gemischt mit Romanautoren-Neugierde und einem Hang zum Düsteren.
„Er war nicht der Erste, der auf dem Camino gestorben ist.“ Der Deutsch-Spanier dreht sich um und geht.
Der Weg fordert Tote. Nicht nur der Geist des Apostels Jakobus des Älteren schwebt über dem Camino. Auch Gevatter Tod geht um. Vorsicht vor diesem Weg, er kann dich verschlingen. Bämm – und tot bist du. Der Rettungsdienst hat auf diesen verschlungenen, zugewachsenen, engen Pfaden keine Chance. Die Anfahrtszeit dürfte die in deutschen Städten üblichen fünfzehn Minuten um ein Vielfaches überschreiten. Da müssten sie schon mit dem Heli kommen.
Wer war der tote Pilger? Hätte ich doch nur einen Detektivclub, im Team ein Bob Andrews, Recherchen und Archiv, den ich jetzt aktivieren könnte. Ich beginne, mir die Lebensgeschichte des Mannes selbst auszumalen.
Wir machen uns wieder auf den Weg. Verlaufen ist unmöglich, denn alle naselang weist das Piktogramm einer Jakobsmuschel uns den Weg. Die gelbe Muschel auf blauem Grund – aufgemalt auf dem Asphalt, eingelassen in Beton, geklebt auf einen Wegweiser, kombiniert mit einem gelben Pfeil. Und so erreichen wir Puente la Reina, wo die Herberge deutlich kleiner und sauberer ist als die in Pamplona. Neben der Rezeption steht ein großer Snackautomat ohne Snacks. Stattdessen sind die Fächer mit Zahnpasta und Blasenpflastern gefüllt. Gibt es irgendwo auch neue Schultern?
Wir finden eine andere Lösung, die einen Tag zuvor noch undenkbar gewesen wäre: Wir massieren uns gegenseitig die Schultern. Das ist ja eigentlich keine große Sache, aber mit meiner Mutter fühlt es sich erstaunlich intim an. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir bereits am zweiten Tag so weit sind. So nah. Aber es tut gut. Und ist wie jede Massage viel zu kurz.
Bevor wir todmüde ins Bett fallen, verabschiedet sich Sieglinde noch von ein paar Dingen in ihrem Rucksack: Eine kleine Plastiktüte, ein T-Shirt und ihre Packung Ohropax fliegen in den Mülleimer – sie will nun Watte in die Ohren stopfen. Das macht lächerlich wenige Gramm aus, bringt aber kiloschwere Hoffnung, dass der Weg morgen etwas leichter wird.