Prolog
Was ist eigentlich klassische Musik? Sie ist ein Abenteuer, eines, das wir erleben, wenn wir uns auf sie einlassen. Sie nimmt uns mit in eine andere Welt. Sie entfaltet dort eine ungeheure Macht. Und aufgrund dieser Macht kann sie uns ungemein viel geben, gerade heute in diesen unruhigen, so sehr beschleunigten Zeiten. Davon handelt dieses Buch. Die Frage l?st sich noch anders beantworten. Klassische Musik ist ein Universum, das sich ausdehnt, sobald man sich hineinbegibt. Man findet dort alles, was diese Kunstform seit fast tausend Jahren bis heute hervorgebracht hat: die mittelalterliche Musik, die Musik der Renaissance und des Barock, die Klassik und Romantik, schlie?ich die Neue Musik, die Oper, sinfonische Werke, Kirchen- und Kammermusik. Wenn ich in diesem Buch immer wieder von klassischer Musik spreche, dann umfasst dieses Universum all diese ?thetischen Ausdrucksformen, die ?er die Anordnung von T?en geschaffen wurden und werden. In der klassischen Musik liegen unsere gesamte abendl?dische Tradition, die gro? Entwicklungsidee bis hin zur Moderne und der Kanon mit seinen Werken aus den unterschiedlichen Epochen. In ihr liegt nie versiegende menschliche Kreativit?, durch die unaufh?lich Werke in dieser Kunstform hervorgebracht werden. In ihr liegen aber auch das Gemeinschaftserlebnis und die Begegnungen in den Opern- und Konzerth?sern. Und nicht zuletzt der Konsens ?er die Bedeutung und den Wert dieser Kunstform. Das meine ich mit klassischer Musik. In diesem Buch geht es nicht nur um sie, sondern auch um uns und darum, warum wir es nicht zulassen sollten, dass die klassische Musik in unserer schnelllebigen, hochtechnologisierten und visuell gepr?ten Welt an gesellschaftlicher Bedeutung verliert. Was w?de uns sonst an unsere Traditionen erinnern, die wir in unserer postmodernen Orientierungslosigkeit so dringend brauchen? Was k?nte uns umf?glicher inspirieren, unsere Vorstellungen bereichern, was w?de uns weitertreiben ? weit in die Zukunft hinein, ohne dass wir vergessen, wer wir sind, und uns in ihr verlieren?
Kent Nagano, im Oktober 2017
Kapitel 1
Von Rinderzüchtern und Trompeten
„Die gesprochene Sprache hat stets etwas mit Aussagen
und Argumenten zu tun, mit Fragen und Antworten.
In der Sprache der Musik gibt es das nicht. Es gibt keine Argumente; die Musik ist frei davon und immer bereit,
ein Teil von jedermann zu werden.“
Wachtang Korisheli
Das klingende Fischerdorf Ich habe einen Traum. Vielleicht ist es irreführend, ein Buch mit diesem Satz zu beginnen, der mich unweigerlich in die Nähe der Träumer rücken könnte. Aber ich bin kein Träumer, sondern Realist. Und deshalb schreibe ich dieses Buch. Für meinen Traum. Dieser Traum zieht mich weit zurück in meine Kindheit, in die fünfziger und sechziger Jahre, die ich – aus europäischer Perspektive – am Ende der Welt verbrachte. Er führt mich an die Westküste der Vereinigten Staaten, irgendwo ins Niemandsland auf der gut vierhundert Meilen langen Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco, die man heute, wenn man über den Highway fährt, in sieben Stunden zurücklegen würde.
Direkt an der landschaftlich wilden Küste liegt auf etwa halbem Weg zwischen den beiden Metropolen der unscheinbare Ort Morro Bay, damals nichts weiter als ein kleines Fischerdorf mit vielleicht zweitausend Einwohnern aus aller Herren Länder. Wenn ich an meine Kindheit in diesem Dorf zurückdenke, dann erklingt in meinen Erinnerungen immerfort Musik – Bachs Präludien und Fugen, Beethovens und Mozarts Sinfonien, Choräle für große Chöre, Kantaten. Für einen Dirigenten ist es womöglich nichts Ungewöhnliches, Erinnerungen mit Musik zu verbinden, wo doch Klänge den Lebensalltag bestimmen. Wer kennt nicht die suggestive Kraft von Melodien, die in der Lage ist, Landschaften, Gebäude, Situationen, Menschen und ganze Phasen der Vergangenheit in der eigenen Vorstellung auferstehen zu lassen.
Doch so meine ich das nicht. Ich höre Musik, die von unseren Orchestern damals gespielt und von den Chören tatsächlich gesungen wurde, immerzu, weil die ständige Präsenz klassischer Musik mit großer Selbstverständlichkeit unseren dörflichen Alltag bestimmte. Sie war Teil unseres Lebens, einfach immer da – zum Üben, zum Zeitvertreib, zum Erwerb sozialer Anerkennung, für das Gemeinschaftserlebnis. Ohne Musik war das Leben meiner Geschwister, Freunde, Klassenkameraden und mein eigenes gar nicht vorstellbar. Dabei machten wir Musik um der Musik willen. Keines von uns Bauernkindern dachte damals an eine Karriere als Musiker. In meiner Kindheit und Jugend deutete nichts darauf hin, dass ich irgendwann einmal als Dirigent meinen Lebensunterhalt verdienen würde.
Chor- und Orchesterproben, Klavierunterricht, dazu Musiktheorie – das alles bestimmte die sieben Tage der Woche, ohne dass meine Geschwister und ich da etwas Besonderes gewesen wären. Fast jeder in unserer ländlichen Gemeinde war irgendwie in das Musikleben involviert. Die Kinder der Rinderzüchter genauso wie die der Feldbauern und Fischer, der Handwerker, der Lehrer und Lebensmittelhändler, des Schuldirektors. Morro Bay war ein klingendes Dorf, etwas Merkwürdig-Einmaliges zwischen Felsen, Feldern und dem Pazifik. In der Intensität, mit der sich die Kinder der Musik widmeten und ihre Eltern in die Welt der Klassik hineinzogen, war unser Ort ungewöhnlich, vielleicht sogar ein wenig seltsam. Die Musik verband uns alle, diese Gesellschaft aus Einwanderern völlig unterschiedlicher ethnischer und kultureller Hintergründe. Im Rückblick erscheint mir das fast wie ein Traum.
Vielleicht sollte ich ein bisschen ausholen: Meine Großeltern väter- und mütterlicherseits waren Ende des 19. Jahrhunderts von Japan nach Amerika ausgewandert und hatten sich als Gemüsebauern an der Westküste Amerikas niedergelassen, um sich dort im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ ihr Glück zu erarbeiten. Unsere Familie lebt seit gut 120 Jahren in Amerika – die Hälfte der Zeit seit es die Vereinigten Staaten gibt. Ich bin also ein echter Amerikaner. Meine Großeltern betrieben eine Farm, die später, nachdem mein Großvater schwer erkrankte, mein Vater und seine Brüder übernahmen. Weder mein Vater noch meine Mutter waren als Landwirte ausgebildet. Beide sollten es nach dem Willen ihrer Eltern weiterbringen und Berufe erlernen, die ihnen eine Existenz jenseits der Landwirtschaft ermöglichten. Beruflich verfolgten sie deshalb ganz andere Pläne: Mein Vater hatte an der University of California, Berkeley, Architektur und Mathematik studiert, meine Mutter graduierte dort als Mikrobiologin und Pianistin.
Dann aber wurden sie Bauern – gezwungenermaßen, denn mein Großvater hatte keine Kraft mehr, seine Felder selbst zu bewirtschaften. Erst viel später, im Jahr 1976, bekamen sie die Möglichkeit, sich ihrer akademischen Ausbildung entsprechend beruflich zu engagieren. Damals wurde unser Ackerland im Rahmen eines regionalen Entwicklungsprogramms in Baugrund umgewandelt und von einem Nahrungsmittelkonzern aufgekauft. Auf Teilen unserer ehemaligen Felder stehen heute Gebäude. Meine Mutter arbeitete fortan als Mikrobiologin für die Gesundheitsbehörde, mein Vater plante und baute nicht nur Privathäuser, sondern auch große Handelszentren. Da lebte ich längst nicht mehr in Morro Bay.
Ich bin, wenn man so will, ein Bauernkind, das Kind eines Artischockenzüchters; eines, das seinen Vater wenig sah, er war meistens draußen auf den Feldern. Erst abends, wenn er zurückkam, beschäftigte er sich mit seiner Architektur, er zeichnete Entwürfe, später immer öfter als Auftragsarbeiten. Er hatte schon früh begonnen, neben der Landwirtschaft ein kleines Architekturbüro aufzubauen, und zog sich oft in sein „Studio“ zurück, wo er Entwürfe zeichnete und seinen Träumen nachhing. Meine Mutter achtete sehr darauf, dass wir Kinder ihn in seiner Arbeit dort niemals störten. Meine Mutter war nicht nur eine passionierte Wissenschaftlerin, sondern spielte eben auch hervorragend Klavier. Darüber hinaus war sie ungemein belesen und trug ihre Faszination für die Wissenschaft und ihre Liebe zu den Schönen Künsten der Musik und Literatur in unsere Familie hinein.
Die Landschaft, die uns umgab, war rau und weitläufig. Die kalifornischen Metropolen San Francisco im Norden und Los Angeles im Süden lagen von Morro Bay jeweils über zweihundert Meilen entfernt und waren damit in den fünfziger Jahren für uns Kinder nahezu unerreichbar. So selten, wie wir dorthin fuhren, waren das immer ganz besondere Ausflüge. Wir lebten buchstäblich am äußersten Rand Amerikas, da wo die Küste steil hinab in den Pazifik stürzt, wo sich die felsige Landschaft hin und wieder mit langen Stränden abwechselt, auf die in Sturmzeiten gigantische Wellen heranrollen. Am Meer waren meine drei jüngeren Geschwister und ich in unseren frühen Jahren allerdings eher selten, wenn man bedenkt, dass es direkt vor unserer Haustür lag. Unser Leben spielte sich weitgehend in den beiden Mikrokosmen unseres Zuhauses und der Schule ab.
Der Ernst der Mütter Als ich vier Jahre alt war, setzte mich meine Mutter ans Klavier. Sie tat das mit der ihr eigenen Bestimmtheit, mit der sie auch mit uns Bücher anschaute und uns aus ihnen vorlas oder sonntags mit in die Kirche nahm und keinen Zweifel daran ließ, dass wir auch die langweiligsten Predigten über uns ergehen lassen mussten. Jeder von uns ging von diesem Alter an bei ihr in die Lehre. Die Frage, ob wir das wollten, wurde überhaupt nicht gestellt. Sie stellte sich uns Kindern damit ebenso wenig. Wir übten das, was sie uns zeigte. Wir lernten Notenlesen und Zuhören – uns selbst und anderen, wir verinnerlichten den Unterschied zwischen Krach, Geklimper und ernsthafter Musik.
Musik war eine ernste Angelegenheit, sie war meiner Mutter wichtig, mehr als nur eine Spielerei, so essenziell wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Das Üben war Teil unseres kindlichen Alltags. Es war ein unumstößliches Faktum, das wir nie in Frage stellten. Vielleicht, weil meiner Mutter nicht daran gelegen schien, uns schon im Alter von vier Jahren zu Wunderkindern und später zu Künstlern auszubilden. Musik gehörte für sie zur Erziehung ihrer Kinder, sie war ganz selbstverständlich Teil einer humanistischen Ausbildung und damit unseres Alltags. Niemals war sie Mittel für irgendeinen Zweck. Ich würde nicht behaupten wollen, dass wir als Kinder übermäßig motiviert waren, uns regelmäßig dem Klavier zu widmen. Ob wir gern geübt haben?
Ich zumindest nicht. Aber ich wehrte mich auch nicht dagegen. Es war eine Frage der Folgsamkeit, die sich automatisch einstellt, wenn einem jemand mit unbeirrbarer Bestimmtheit etwas abverlangt, das er selbst täglich vorlebt. Vielleicht ist es das, was man heute als sanfte Gewalt bezeichnen würde, wenn man Kinder in manchen Fragen überhaupt nicht erst vor die Wahl stellt, sondern für sie entscheidet. Musik stand nicht zur Wahl, sie gehörte einfach zum Leben. Wenn ich zurückdenke, kommen meine Geschwister und ich mir heute erstaunlich folgsam vor, verglichen mit anderen Kindern zu dieser Zeit.
Meine Eltern waren für ländliche Verhältnisse ein wenig ungewöhnlich. Das lag nicht nur an der Kunstsinnigkeit meiner Mutter. Auch mein Vater trug seine eigentliche Berufung in unser Familienleben hinein. In unserem Haus fanden sich überall Skizzen, Bauzeichnungen und Architekturmodelle. Als wir etwas älter waren, nahm er uns immer öfter auf seine Baustellen mit. Er erklärte uns nicht nur die Konstruktion der Gebäude, sondern ließ keinen Zweifel daran, dass er Architektur auch als eine Kunstform verstand, die in ästhetischer Hinsicht ihre Zeit widerspiegelte, sie prägte und im besten Fall über sie hinausführte.
Meine drei Jahre jüngere Schwester und ich spielten überwiegend Klavier. Mein Bruder dagegen entwickelte ziemlich bald eine Vorliebe für Blechblasinstrumente und lernte Posaune, meine jüngste Schwester Bratsche. Nie hat einer von uns daran gedacht, ein Instrument aufzugeben. Auf eine solche Idee wären wir einfach nicht gekommen, zumal unser tägliches Leben tatsächlich wenig Ablenkung bot. Wir lebten abgeschieden, trieben schon deshalb keinen organisierten Sport, gingen nur hin und wieder zum Strand und versuchten, uns von den großen Jungen das Wellenreiten abzuschauen. Mitte der fünfziger Jahre kauften meine Eltern einen Fernseher. Viel aber gab es gar nicht zu sehen. Der Empfang in Morro Bay, das im Osten von Bergen und im Westen von Wasser umgeben war, blieb über Jahre dürftig. Meinen Vater interessierte das Fernsehen vor allem wegen des täglichen Wetterberichts, auf den er als Landwirt natürlich angewiesen war, weil die Vorhersage die Planbarkeit erhöhte. Meistens aber verließ er sich dann doch auf das Radio.
Sicher spielte in unserer sechsköpfigen Familie die klassische Musik vergleichsweise früh eine Rolle. Das lag einfach daran, dass meine Mutter Musik liebte. Abgesehen davon aber unterschieden wir uns kaum von unseren Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern im ziemlich konventionellen Amerika der fünfziger und sechziger Jahre, in denen der Kirchgang, die Verwandtenbesuche und das Treffen von Freunden ebenso Bestandteil des Alltags waren wie die Schule und an den Wochenenden manchmal der Strand oder die Berge.
Es gibt die verrücktesten Geschichten über die Kindheit von Künstlern. Nach den Vorstellungen moderner Erziehung sind es vielfach traurige. Sie ähneln denen von exzellenten Sportlern. Da ist der strenge Vater, der von seinem Sohn einen gnadenlosen Einsatz fordert, stundenlanges Üben und Trainieren, tagein, tagaus, ohne Rücksicht auf die physischen und psychischen Folgen einer derart widernatürlichen Quälerei. In der Szene klassischer Künstler finden sich viele solcher Beispiele. Oder es ist die Mutter, die mit unbändigem Ehrgeiz eines ihrer Kinder zum Solisten machen will, weil es bereits in jungen Jahren Talent oder zumindest Interesse gezeigt hat. Kinder wecken schnell elterliche Phantasien. Und dann geht es los: Eine Vorführung jagt die nächste, die Kinder werden zu Wettbewerben geschickt, Musikern und bekannten Lehrern vorgestellt. Ein charakteristisches Phänomen unserer heutigen Zeit ist das nicht, es war schon vor Jahrhunderten so.
Wolfgang Amadeus Mozart wurde als Kind von seinem Vater täglich viele Stunden unterrichtet und in zahllosen Reisen der Welt vorgeführt – bis an die Grenzen der physischen Erschöpfung. Ähnlich erging es dem jungen Ludwig van Beethoven, dessen Alter von seinem überehrgeizigen Vater angeblich sogar um ein paar Jahre heruntergemogelt wurde, damit das Wunderkind am Klavier noch heller strahlte. Über die Leiden der kindlichen Stars spricht man ungern. Manche Autobiografie zeugt davon. Der Perfektionismus lässt das Idyll einer unbeschwerten Kindheit schnell zerfallen. Idyllisch jedenfalls ist es bei so manchem Klassik- oder Sportstar der Vergangenheit und Gegenwart nicht zugegangen. In Morro Bay aber war die Welt eine andere, die mir im Rückblick fast ein wenig unwirklich erscheint.
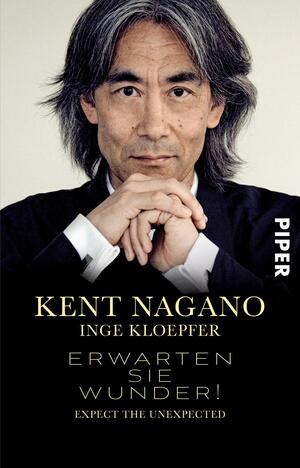
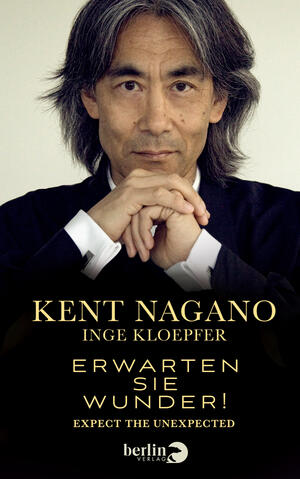

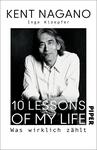


Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.