Der georgische Gründungsmythos
Paradies auf Erden
Es war einmal eine Zeit, in der es noch keine Grenzen auf der Erde gab. Aber Gott beendete dies, indem er jedem Volk ein eigenes Land schenkte. Den Italienern, die Sonne und Wärme liebten, gab er den von Meer umringten Stiefel, den Engländern, die geborene Entdecker waren, eine eigene Insel, und so ging es weiter, bis schließlich alles verteilt war. Nur die Georgierinnen und Georgier waren nicht da gewesen, um sich ein Stück Land zu erbitten. Stattdessen hatten sie den Tag tanzend, singend und trinkend auf einem großen Fest verbracht. Es entspricht nicht ihrer Natur, sich um Dinge zu sorgen, die in der Zukunft liegen, und sie leben in dem Vertrauen auf einen guten Ausgang. Als Gott das sah, war er verstimmt, denn er wollte immer beachtet werden. Da wurde er von dem feiernden Völkchen kurzerhand eingeladen. Der Wein mundete ihm vorzüglich, die Musik erklang in schönsten Harmonien, und die vielen köstlichen Speisen wurden auf den langen Tafeln wieder und wieder aufgefüllt. Alle Männer, Frauen und Kinder waren so freundlich, ihre Gastfreundschaft so unermesslich, dass Gott seinen Groll bald vergaß. Als der Tag sich dem Ende neigte und alle zufrieden und müde waren, erinnerte er sich daran, dass er dem glücklichen Volk noch kein Land gegeben hatte. Gerührt von der Leidenschaft dieser Menschen überlegte er nicht lange: Er schenkte ihnen das Paradies – jenes Stückchen Land, das er für sich selbst hatte bewahren wollen. Und so kommt es, dass die Georgierinnen und Georgier fortan und bis zum heutigen Tag im Paradies leben sollten.
Zweiseelig
[sprich: orsuli; eine Frau, die zwei Seelen hat; ori = zwei, suli = Seele]
Von der Aserbaidschanischen Grenze durch Kachetien
Zeus’ donnernde Einführung in den Kaukasus
Es kracht so markerschütternd, dass ich im Bett in eine sitzende Position katapultiert werde. Gleichzeitig wird es plötzlich stockfinster. Ich fasse mir an den Kopf, wirr, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Es ist schwarz um mich herum, eine blinde Dunkelheit hüllt mich ein.
In meinem Magen spüre ich das Echo dieses metallenen explosionsartigen Knalls, der mich aus dem Tiefschlaf gerissen hat. Wellenförmig erreicht der Widerhall meinen Kopf, in dem sich kaum die Frage formen kann, was zur Hölle das war, bis es für eine lange Sekunde gleißend hell wird. So hell, dass ich das gesamte Gästezimmer, meinen halb entleerten Rucksack und die Pfirsiche auf dem Tisch mit überscharfer Klarheit sehe. Die Umrisse bleiben kurz in der Luft hängen, dann durchbricht der nächste Knall die Stille, und es wird wieder finster, lichtlos, schwarz um mich herum.
Damit kehrt auch langsam das Bewusstsein in meinen Körper zurück, und ich begreife endlich, dass das ein Gewitter und der Strom ausgefallen ist. Denn nicht nur das Licht im Haus ist erloschen, auch die Straßenlaternen davor sind aus, der gesamte Ort liegt im Dunkeln.
Es ist meine erste Nacht im Kaukasus, ich befinde mich in einem Gästehaus in dem von etwa 5000 Menschen bewohnten Bergdorf Lagodechi an der östlichen Grenze Georgiens, unweit von Aserbaidschan. Während ich mich wieder hinlege, mache ich mir bewusst, wie ich hier gelandet bin. Schritt für Schritt lasse ich die Reise bis hierher, die vor etwa einer Woche zu Hause in Oberaudorf im Inntal begonnen hat, Revue passieren.
Slow Travel
Als ich mit meinem großen Rucksack in Kufstein in den Zug nach Wien einsteige, bin ich wesentlich aufgeregter als je zuvor vor einer langen Tour. Der Zug fährt bald darauf durch mein Heimatdörfchen Oberaudorf, und ich spüre fast ein bisschen Abschiedsschmerz. Auch das ist neu. Aber als ich in Wien in den Fernbus umsteige, hat sich etwas von der Aufregung gelegt, und in mir wächst langsam die Vorfreude. Endlich geht es los! Nach fast zwei Jahren Planung und Verschiebung, nach Hürden und Hindernissen, Änderungen und Anpassungen: Es geht los. Ich fahre in den Kaukasus, dieses mystische Gebirge meiner Träume. Die wilde Weite hat sich in meinem Kopf und Herzen so viel Platz geschaffen, dass sie mir manchmal schon fast vertraut vorkam, obwohl ich sie noch nie mit eigenen Augen gesehen habe.
In Wien am Busbahnhof treffe ich Christian. Ein glücklicher Zufall hat ergeben, dass ich die lange Reise mit meinem guten Freund gemeinsam unternehmen kann. Er ist in Georgien mit seiner russischen Freundin verabredet, ein pandemiebedingter Beziehungsumweg für beide. Und für unsere Freundschaft eine wunderbare Möglichkeit, mal wieder ausführlich über all die wichtigen Dinge im Leben zu sprechen.
Der Fernbus nach Sofia, wo wir auf unserem Weg in die georgische Hauptstadt Tiflis ein zweites Mal umsteigen werden, ist fast ausgebucht. Unsere Mitreisenden sind ein buntes, fröhlich wirkendes Völkchen, von denen nur sehr wenige Deutsch sprechen.
Aufgrund des Klimawandels kann ich es nicht mehr vertreten, eine Flugreise zu unternehmen. In Christian habe ich diesbezüglich einen verlässlichen Komplizen. So habe ich mich für die An- und Rückreise auf dem Land- beziehungsweise auf dem Seeweg entschieden, was sich aufgrund der Pandemie als gar nicht so einfach herausstellte: Denn es fahren derzeit keine internationalen Züge auf dieser Strecke, sodass ich ausschließlich Busfahrten buchen konnte.
Dennoch ist die Reise über Land kein Verzicht beziehungsweise keine verlorene Zeit, sondern vielmehr ein Gewinn: Nur so kann ich ein räumliches, kulturelles und emotionales Verständnis für die Distanz entwickeln, die zwischen meiner Heimat in den Alpen und dem hohen Kaukasus, dem Gebirge meiner Tour, liegt.
Ich habe in diesen ersten Stunden der Busfahrt außerdem viel Zeit, den Moment des Aufbruchs ausführlich auszukosten. Und es ist schön, auch im weiteren Verlauf der ungarischen, serbischen, bulgarischen und türkischen Landschaft dabei zuzusehen, wie sie am breiten Busfenster vorbeizieht.
Nach Sofia geht es aber über Nacht. Die Fahrt ist von den Klängen der gut gelaunten Bulgaren geprägt, die auf den hinteren Bänken im Bus nachts traurige Lieder singen. Alle sind sehr freundlich, neugierige Augen mustern uns, man bietet auch mir an mitzutrinken. Ich muss ablehnen, ziehe unter der Hose die unbequemen Thrombosestrümpfe hoch und setze mir die erste Thrombosespritze.
Doch, halt, warum denn das?
Alles begann an einem sonnigen Morgen vor etwa vier Wochen …
Zwei Streifen verrücken das Zentrum meines Universums
Ich starre ungläubig auf die zwei kleinen, aber eindeutigen Streifen eines Schwangerschaftstests. Das kann doch nicht wahr sein! In mir dreht sich alles. Es fühlt sich so entschieden an. Ein markanter Wendepunkt in meinem Leben. Hier und jetzt. Und irreversibel. Völlig überrascht falle ich augenblicklich zwischen himmelhoch jauchzender Freude und gravierender Zukunftsangst hin und her. Ein Kind, was für eine wunderbare Überraschung!
Und … jetzt?! Warum ausgerechnet jetzt? So kurz vor meinem geplanten Aufbruch zu einer Tour, an deren Planung ich seit bald zwei Jahren arbeitete? Ich kann es nicht glauben, mache einen Termin bei meiner Frauenärztin und versuche, alle Gedanken daran auf danach zu verschieben.
Der Ärztin, bei der ich schon lange Patientin bin, schicke ich eine E-Mail mit zwei Anhängen: ein Foto des positiven Schwangerschaftstests und das Portfolio für die Kaukasus-Tour. Dazu schreibe ich nur: „Das ist mein Dilemma. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen.“
Bei unserem Termin bestätigt sie das Leben in mir und gratuliert: Auf dem Monitor ist deutlich ein kleines Knäuel zu sehen, das sich in der Gebärmutter eingekuschelt hat. Daraus könnte also unser Kind werden. Irre. Im Gesicht meines Freundes Martin sehe ich einen Ausdruck, den ich vorher noch nie bei ihm wahrgenommen habe.
Meine Frauenärztin ist bezüglich meines „Dilemmas“ tiefenentspannt: „Natürlich können Sie die Tour machen, vielleicht nicht genau so, wie Sie es geplant haben, aber Sie sind doch eine verantwortungsbewusste Frau mit einem guten Körpergefühl. Solange es Ihnen und dem Kind gut geht, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.“
Ich weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass so eine Schwangerschaft früh wieder vorbei sein kann. Aber auch wenn ich in den folgenden Wochen wiederholt versuche, mir das klarzumachen, komme ich nicht gegen das Gefühl der Gewissheit an: Da ist ein eigenständiges kräftiges Wesen in mir, das gesund ist und wächst.
Von diesem Moment an wird dieses zweite Leben schlagartig zum Zentrum meines Universums, um das sich ab jetzt unweigerlich alles andere drehen wird.
Über Land nach Georgien
Im Bus spüre ich das breite Lächeln, das sich in mein Gesicht gräbt, wenn ich an diese Situation denke. Die blöde Spritze, die juckenden Strümpfe und die latente leichte Übelkeit, all das sind doch Peanuts. Außerdem gibt es genug Ablenkung. Bevor ich versuche, eine bequeme Schlafposition für die Nacht zu finden, lerne ich die Abiturientinnen Julia und Fabienne kennen, die – ebenfalls motiviert von dem Bedürfnis, das Klima zu schützen – mit dem Bus in den Urlaub nach Griechenland fahren. Wir reden eine Weile über das Thema, und ich bin beeindruckt, wie selbstverständlich das Wissen um den Klimawandel bei vielen jüngeren Menschen ist. Am nächsten Tag kommen wir gegen Mittag in Sofia an, und wir sind uns einig, dass allein schon das Erlebnis der Reise bis hierher spannende Eindrücke hinterlassen hat.
Nach einer kurzen Pause in der Hauptstadt Bulgariens geht es direkt weiter nach Istanbul. Ich musste mich aus Zeitgründen entscheiden, ob ich lieber mehr Zeit in Sofia oder in Istanbul haben möchte – Istanbul hat mich letztendlich mehr gereizt. Auf dem Weg dorthin geht es durch weite, hügelige Landschaften, deren Farben zunehmend blasser erscheinen, während die Vegetation immer mediterraner wird. Große, verrostete Werbeschilder am Straßenrand erinnern mich an meine Reise durch den Westen der USA zwei Jahre zuvor. Ganz anders als dort fallen mir hier aber die zahlreichen, teils stattlichen Bauruinen am Straßenrand auf. Sie recken ihre Gerippe hin zur Abendsonne, als hofften sie, in deren Strahlen zu neuem Glanz erweckt zu werden. Die Trostlosigkeit dieses Anblicks macht mich melancholisch.
Mitten in der Nacht kommen wir in Istanbul an. Hier übernachten Christian und ich in einem Hotel, und es ist schon nach diesem Teil der Reise eine an Luxus grenzende Wohltat, sich eine ganze Nacht lang ausstrecken zu können. Am nächsten Morgen bleibt genug Zeit für einen kleinen Stadtbummel, und für ein paar Stunden verliere ich mich in dem bunten Gewusel, atme die vielen Düfte ein, trinke einen frischen Granatapfelsaft und bestaune beeindruckende Mosaike. Besonders dieses warme Dunkelblau – wie bei einem Nazar, einem dieser glasierten Keramiksteine, die als Evil-Eye-Amulette den bösen Blick abwenden sollen – bleibt mir in dieser bewegenden Stadt in Erinnerung.
Zurück im Reisebus, gibt es noch eine schöne Überraschung: Der Bus fährt tatsächlich auf eine Fähre, und wir überqueren den Bosporus. Die Meeresluft, der Wind in den Haaren, die türkisfarbenen Wellen vermitteln ein Gefühl von Urlaub. Die Weiterreise bis zur georgischen Grenze ist von zahlreichen Stopps geprägt. Fast stündlich halten wir an, auch nachts. Sogar um drei Uhr in der Früh sind die bunt blinkenden Autobahnraststätten stark besucht. Ein großer Grill vor dem Gebäude darf jeweils nicht fehlen, brutzelndes Fleisch und Gemüse verbreiten den typisch anatolischen Geruch. Dazu Berge von Weißbrot und klebrige bunte Süßigkeiten, hoch aufgetürmt die vielen Varianten süßer und salziger Nusskreationen. Großfamilien laufen laut redend und rufend durcheinander. Den Gestank auf der Toilette habe ich nicht ausgehalten, weshalb ich nun übermüdet vor meinem Bus auf dem Parkplatz stehe und mir inmitten des Gewusels die Zähne putze. Dabei beobachte ich eine mir völlig sinnlos erscheinende Tätigkeit: Die vielen weißen Fernbusse werden hier gründlich und mit viel Wasser und Seife gesäubert, bevor sie sich wieder auf die staubigen Straßen aufmachen.
Als ich später am Morgen nach ein paar erstaunlich tiefen Schlafstunden aufwache, schaue ich über das Schwarze Meer. Die Weite dieses Anblicks verschafft mir eine große Erleichterung. Die nächsten Stunden fahren wir durch offenbar derzeit wenig besuchte und nicht besonders einladend wirkende Ferienorte. Palmen vor grauem Himmel, starker Wind und düstere Wellen schaffen die dramatische Stimmung, in der ich mir meine dritte Thrombosespritze verabreiche. Vor mir eine dicke junge Frau, die sich permanent schnatternd mit ihrer Freundin ein Handy mit Videos hin und her reicht. Sie trägt einen roten Jogginganzug, dessen Schultern und Ärmel ebenso wie die seitliche Naht der Hose mit einer silbernen Borte versehen sind. Darauf steht aus Strasssteinen der sich wiederholende Schriftzug „Only Rich Class“.
Schließlich erreichen wir ein seltsames Bauwerk, das die mehrspurige Straße überragt. Der Grenzposten zwischen der Türkei und Georgien, der sich um die Behauptung einer europäischen Außengrenze zu bemühen scheint. Die weiße geschwungene Form des Wachturms erinnert wahlweise an ein unbeholfen hockendes Männchen oder an die abstrakte Nachempfindung einer sich in die Höhe schlängelnden Rauchfahne. Obwohl das Gebäude offensichtlich modern sein soll, wirkt die Sinnlosigkeit seiner Form wie ein großes „Fuck You“ in Richtung Bauhaus. Ich frage mich, wie viel dieses Eindrucks schon mit dem leichten Delirium zu tun hat, in dem ich nach nunmehr drei Tagen Reise ankomme. Die Irritation geht weiter, denn es folgen langwierige, nervenaufreibende und akribische Kontrollen von Coronatests, Impfnachweisen und Einreisepapieren.
Kaum haben wir die Grenze passiert, wird die Landschaft plötzlich auffallend grün. Als würde mich das innerlich erfrischen, geht es auch mir schlagartig besser. Saftige, weite Wiesen und sumpfartiges Flachland, durch das magere Kühe staksen, ohne dass ein Zaun sie auf ihren Wegen behindern könnte.
Dann schleicht der Bus plötzlich durch den dichten Verkehr von Batumi, und Christian und ich denken beim Blick aus dem Fenster, wir wären plötzlich in Dubai gelandet. Die teils noch im Bau befindlichen Hochhäuser übertreffen sich gegenseitig an Opulenz und Ausgefallenheit. Die Formen sind teils surreal und irrsinnig. Da steht ein Weißes Haus auf dem Kopf, anscheinend ist es ein Restaurant. US-amerikanisch anmutende Papphäuser säumen eine Hafenstraße, daneben verfällt ein alter, offensichtlich leer stehender riesiger Sowjetbau. Hinter dem wiederum ragt ein elliptisches futuristisches Bürohaus in den Himmel, und ein schiefer Turm soll wohl an Pisa erinnern. An einem gläsern glänzenden Hotelblock hängen außen an Seilen noch Bauarbeiter in schwindelerregender Höhe. Ein spitz zulaufender hoher Turm könnte an das Empire State Building erinnern, würde ihm nicht eine überdimensionale protzige goldene Sonnenuhr um den Hals baumeln. Und die spitz zulaufenden gläsernen Kanten des Hilton machen Angst, sich daran zu schneiden, und wirken alles andere als einladend.
Nachdem ich mich von Christian verabschiedet habe, der im westlichen Landesteil bleibt, ziehen sich die letzten Stunden der Fahrt nach Tiflis ins scheinbar Endlose. Überall ist Baustelle, riesige Betonklötze sollen zu Brückenpfeilern zusammengesetzt werden. Auf der Strecke wird eine neue Nationalstraße gebaut, wir aber fahren noch über schmale und schlaglochreiche Teerpisten, auf denen sich stundenlange Staus bilden. Dabei scheint der Busfahrer jetzt überhaupt nicht mehr anhalten zu wollen, und auch dass ich als eine von nur vier übrig gebliebenen Fahrgästen dringend aufs Klo muss, kann ihn kaum dazu bewegen. Ab jetzt sehne ich mich danach, endlich anzukommen.
Bevor wir von der Autobahn nach Tiflis abfahren, erlebe ich noch einen Moment der Neuorientierung: Auf einem Straßenschild steht die iranische Hauptstadt Teheran angeschrieben. Wenngleich diese Stadt, in der ich vor einigen Jahren eine für mich sehr wichtige Zeit verbracht habe, noch weit weg ist, gehört sie hier offenbar schon zum Koordinatensystem wie Zürich oder Paris in unseren Breiten.
Dass der Taxifahrer für die Strecke zum Hotel in Tiflis schließlich viel zu viel verlangt, ist mir egal, ich sehe nur noch das weiße Laken des Hotelbetts auf mich warten. Und endlich angekommen gestehe ich mir ein: Diese Reise war mindestens genauso anstrengend, wie sie spannend war. Glücklicherweise kann ich mich jetzt ausruhen, bevor ich meinen Fußmarsch beginne, denn ich muss in der georgischen Hauptstadt auch noch einiges erledigen.
Georgische Freunde
Am nächsten Tag lerne ich endlich die Leute kennen, die mir in meiner Vorbereitung so viel geholfen haben und denen ich mich aufgrund ihrer Herzlichkeit schon ganz verbunden fühle. Sie wissen bereits von meiner Schwangerschaft und haben mir auch bei den notwendigen Anpassungen meiner Planung und dem Beschaffen der zusätzlich erforderlichen Kontakte sehr geholfen.
In einem Café in der Innenstadt bin ich mit Shota und George verabredet, zwei Bergführern von „Climbing Georgia“. Bei ihrem kräftigen Händedruck fühlt es sich an, als würde ich gute Freunde treffen. Die Sonne der Berge strahlt aus den wettergegerbten Gesichtern der beiden Männer. Bisher haben sie mir insbesondere bei der Routenplanung, logistischen Fragen und bezüglich der Permits für das Betreten der georgisch-russischen Grenzregionen im Gebirge unbezahlbare und unermüdliche Hilfe geleistet. Beide sprechen sehr gut Englisch, und so tauschen wir uns über unsere Bergerlebnisse aus. Zuletzt sprechen wir auch noch einmal über die veränderten Umstände meiner Tour.
„Wenn unterwegs jemals irgendwas ist, Ana“, sagt Shota eindringlich und schaut mich ernst an, „wenn du Hilfe brauchst: Du kannst mich jederzeit, immer anrufen. Okay?“
Ich nicke, bin gerührt.
Lachend fügt er hinzu: „Ich kenne wirklich alle Helikopterpiloten im Kaukasus, darauf kannst du dich verlassen. Der Chef der Bergrettung hier ist ein sehr guter Freund von mir.“
Na klar, hier kennt man sich. Ich bin dankbar, all diese kompetenten, zuverlässigen und hilfsbereiten Menschen in der Nähe zu wissen.
Abends treffe ich Grigol. Auch wenn ich mir schon vorgestellt habe, dass er ein freundlicher Mensch ist, so bin ich von der Wärme und Ruhe, die er ausstrahlt, und von seiner feinen, etwas schüchternen Art umso berührter. Grigol hat zwölf Jahre in Hannover gelebt, spricht sehr gut Deutsch und arbeitet oft als Übersetzer. Er wird auch unterwegs für mich ein zuverlässiger Ansprechpartner bleiben, wenn ich Hilfe bei der Verständigung brauche oder andere Fragen zu Land und Leuten habe.
Ich habe in meinem kleinen Notizbuch auf Deutsch ein paar Sätze vorbereitet und bitte Grigol darum, sie für mich in Laut- und Schriftsprache zu übersetzen. Einer der Sätze lautet: „Ich bin schwanger.“
Grigol schaut den Satz an, lächelt und schweigt eine Weile. Dann blickt er mich an und sagt: „Da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber ich schreibe dir die schönere auf, ja?“
„Wie meinst du das?“, will ich wissen.
„Auf Georgisch heißt schwanger orsuli. Und wenn man das Wort ins Deutsche übersetzt, dann bedeutet es mit zwei Seelen oder zweiseelig.“
Ich nicke grinsend, mir kommen fast die Tränen. „Das ist sehr poetisch. Und sehr passend. Danke!“
Einen Moment schweigen wir beide. Ich möchte eine Hand auf meinen Bauch legen, aber das kommt mir zu kitschig vor, deswegen lasse ich es lieber.
„Was ist Rohmilchkäse?“, fragt mich Grigol mit Blick auf den umständlichen Satz „Ich darf keinen Rohmilchkäse essen.“
Mir ist das fast ein bisschen unangenehm, und ich beginne zu ahnen, wie fern der Schwangerschaftskosmos einer vorsichtigen Deutschen den Georgiern sein könnte. „Na ja, also es gibt Käsesorten, die werden in der Herstellung pasteurisiert, also ultrahocherhitzt, und dabei werden alle Bakterien abgetötet, die möglicherweise in der Schwangerschaft für das ungeborene Kind gefährlich sein könnten“, erkläre ich.
Grigol überlegt und sagt dann: „Ich kenne dafür kein Wort auf Georgisch.“
Georgia, good! Paradise!
„Pa Ruski?“, sprichst du Russisch?, fragt mich der Fahrer am Busbahnhof am nächsten Morgen, und ich schüttle den Kopf. Wie die meisten älteren Georgier spricht er Russisch, Englisch haben nur die Jüngeren in der Schule gelernt. Die Marschrutka, die mich in die Berge bringt, ist hinten schon voll mit georgischen Frauen besetzt, die offenbar Einkäufe in der Hauptstadt getätigt haben, deshalb darf ich auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.
Marschrutkas – der Begriff stammt, wie vieles hier, aus der Zeit der Sowjetunion, wenngleich das Wort mit deutschem Ursprung (von „Marsch“ und „Route“) angeblich bei dem deutschen Vormarsch auf Stalingrad in Russland und der Ukraine hängen geblieben und von dort erst über den Kaukasus nach Süden gelangt ist. Es handelt sich dabei jedenfalls um Kleinbus-Sammeltaxis und Georgiens gängigstes öffentliches Verkehrsmittel, das auf mehr oder weniger festen Routen zu mehr oder weniger festen Zeiten verkehrt. Eigentlich fahren sie erst dann los, wenn sie eben voll sind, was ausländischen Besuchern gleich mal die erste Lektion in georgischer Mentalität beschert: Geduld haben, entspannt bleiben, irgendwann geht’s los! Dazu muss man wissen, dass die Kleinbusse jeweils Eigentum der Fahrer sind, diese also auf die Auslastung mit Reisenden angewiesen sind. Es gibt zwar auch außerordentlich viele Angebote von privaten Taxis, die kosten aber doppelt so viel, und man lernt weniger Leute kennen.
Auf unserer rasanten Fahrt über die grünen Ebenen des Vorgebirgslands überholen wir Pferdekutschen, zahlreiche uralte Mercedes-Benz und auffällig viele alte Transporter mit deutschen Aufschriften. Offenbar landen unsere gebrauchten Firmenwagen oft in Georgien. Das klapprige Gefährt, in dem wir sitzen, wirbelt Staub auf, der sich auf die Obst- und Gemüsestände am Straßenrand legt, und im Vorbeipesen bringen wir sicher den einen oder anderen der imposanten Türme aus Wassermelonen zum Schwanken. Es wird gehupt, gelacht, gewunken. Einmal hält der Fahrer an, um mit einem alten Bekannten ein paar Tschatscha, den lokalen Schnaps, zu trinken und Pfirsiche zu kaufen, die er dann an seine Fahrgäste verteilt, während er auf der zweispurigen, unmarkierten Straße spontan für ein weiteres Überholmanöver eine dritte Spur eröffnet. Dabei fährt er so sicher und strahlt so viel Souveränität aus, dass ich mir eigentlich nie Sorgen mache. Ich zeige lachend auf den nicht funktionierenden Tacho, und er reagiert mit einem freudigen Strahlen. Für eine weitere Unterhaltung ist der Motor zu laut und die Sprachbarriere zu groß.
Nach ein paar Stunden halten wir an der Hauptstraße von Lagodechi, und der Busfahrer bedeutet mir auszusteigen. „Georgia, good! Paradise!“, sagt er zum Abschied und hilft mir, den Rucksack aufzusetzen. Ich kann nur nicken, denn ein bisschen benommen bin ich dann doch von der Fahrt. Aber zum Gardenia Guesthouse ist es zum Glück nicht weit.
Gastgeberin Lia heißt mich mit einem herzlichen Lächeln willkommen und lädt mich gleich zum Abendessen ein. So komme ich direkt in den Genuss einer typisch georgischen Supra, wie ein Festmahl hier genannt wird. Die gesamte Großfamilie versammelt sich um den Tisch auf der Veranda, der sich unter den zahllosen Tellern und Schüsseln voller bunter Köstlichkeiten zu biegen scheint. Ich mache deutlich, dass ich schwanger bin, und alle strahlen und gratulieren überschwänglich. Die Freude darüber ist ehrlich, und einer der älteren Männer beginnt, an mich als werdende Mutter gerichtet, eine Rede zu halten. Obwohl ich sie natürlich nicht im Wortlaut verstehe, transportiert sich der Inhalt über seine Stimme und seine Gesten.
Offenbar ist dieser Mann der Tamada, wie man den Hausherrn oder Zeremonienmeister nennt, dessen zahlreiche Reden oder zumindest Trinksprüche bei einer Supra nicht fehlen dürfen. Es gibt ungeschriebene Gesetze über die Reihenfolge der Themen dabei. So beginnt er meist mit Gott oder dem Frieden, dann geht es um Georgien, die Eltern, die Liebe und oft auch die Freundschaft oder gute Wünsche für den Gast. Wenn man auf die Verstorbenen trinkt, erheben sich alle, und im darauffolgenden Toast geht es üblicherweise um das Leben, die Kinder oder allgemein die junge Generation. Am Ende trinkt man auf alle Heiligen oder auf St. Georg sowie auf die Kirchen und Klöster. Je wohlklingender seine Sätze, je ausgeklügelter seine Dramaturgie, desto mehr Zuspruch wird er von seiner Tischgemeinschaft erhalten.
Anschließend belädt man meinen Teller, da ich ja nun erst recht viel essen müsse. Zum ersten Mal komme ich in die sprachlose Erklärungsnot, die mir noch so oft widerfahren wird und die sich in all der Natürlichkeit und Gastfreundschaft so unpassend anfühlt: Rohmilchkäse für mich leider nicht, danke! Ich weiß, das ist lecker, „all natural“, „homemade“, ja, ich verstehe. Aber eben trotzdem Rohmilch, denke ich und bemühe mich gar nicht erst darum, das irgendwie zu erklären. Man akzeptiert schließlich, dass ich den selbst gemachten weißen Käse auslasse, auch wenn man es nicht versteht. Ich glaube, man schiebt es auf die Sprachbarriere, was mir ganz recht ist. Dennoch komme ich mir blöd vor.
Mir gegenüber sitzt Lias Tochter, eine Frau Mitte zwanzig. Sie sei auch schwanger, macht sie mir deutlich. Ich freue mich total, fühle mich ihr sofort solidarisch verbunden.
„In der wievielten Woche bist du?“, tippe ich auf meinem Handy in Google Translate ein und nutze damit zum ersten Mal das Tool, das mir in den nächsten Monaten mehrmals aus der Patsche helfen wird.
Sieben, zeigt sie mit den Fingern und trinkt einen kräftigen Schluck Rotwein.
„Drink, drink! Homemade!“, sagt mir der Familienvater und zeigt auf mein volles Weinglas.
„No“, antworte ich entschuldigend lächelnd und zeige auf meinen Bauch. Ich nehme das Glas und rieche daran, strecke den Daumen hoch und tue so, als wäre es wirklich unglaublich schade, dass ich den Wein nicht trinken darf.
Nach einer weiteren Rede des Tamadas wird nun offenbar auf die Mütter getrunken. Der Schwager sagt etwas, und alle lachen. Lias Tochter tippt in ihr Handy: „Sie sagen, du brauchst einen Schnaps, damit es ein Junge wird.“
Aha. Ich fühle mich ein bisschen verloren, anscheinend ist das hier wirklich noch nicht angekommen, dass Alkohol in der Schwangerschaft schädlich ist. Ich konzentriere mich daher auf das Essen, das wirklich vorzüglich ist. Der Vater bringt immer wieder verschiedene Fleischstücke vom Grill, und um mir zu erklären, was es ist, machen alle Tierlaute, worüber wir herzlich lachen müssen. Dazu gibt es gebratene Kartoffeln, die hervorragend gewürzt sind, eingelegte Auberginen und Paprika sowie Berge von Brot und Chatschapuri, hier in Form von mit Käse gefüllten dünnen Teigscheiben. Die frischen Gurken und Tomaten aus dem Garten schmecken so aromatisch, dass mich für einen kurzen Moment das Gefühl beschleicht, bis heute eigentlich noch nie echte Gurken und Tomaten gegessen zu haben. Dazu wird Traubensaft ohne Alkohol gereicht, der ebenfalls „homemade“ und äußerst lecker ist.
„Gemrieli“, sage ich immer wieder. Lecker.
Um uns herum wird es langsam dunkler. Aus den umliegenden Gärten ziehen mit dem Duft der Grills die fröhlichen Stimmen der Nachbarn zu uns herüber, es ist wirklich idyllisch. Auf das aufziehende Unwetter deutet an diesem warmen Sommerabend rein gar nichts hin.
Göttliche Wettergewalt
Um drei Uhr früh blitzt es erneut. Lange imposante Zacken ziehen sich über den weiten Himmel und beleuchten die satten Weinreben auf der Veranda vor meinem Fenster und den dahinterliegenden großen Obst- und Gemüsegarten. Ich denke an den Ausspruch „Schnell wie der Blitz“ und dass der hier nicht zuzutreffen scheint. Denn diese Blitze sind nachdrücklich, geradezu langsam, als wollten sie sich in den Himmel hineinbrennen, um zu bleiben. Schnell hingegen folgt der Donner. Etwas weniger laut jetzt, dafür lange und bedrohlich grollend, als schüttle ein Riese eine überdimensionale Metallplatte.
Ich bin hellwach. Die Luft vor meinem Fenster ist so aufgeladen, dass es mich nicht wundern würde, einen Schlag zu bekommen, wenn ich nur die Hand aus dem Fenster hielte. Die Metalldächer der umliegenden Häuser scheinen zu surren. Ich will gar nicht mehr schlafen, sondern nur noch wissen, wie es da draußen weitergeht. Nach ein paar Minuten fängt es an zu schütten. Nicht sanft und stetig, sondern mit einem Schlag und so brutal, als würden zigtausend Eimer gleichzeitig über dem Dorf ausgekippt. Ich ziehe mir die Decke bis zum Kinn und bin dankbar für das Dach über mir, auf dem bis zum Morgengrauen unablässig trommelnd große Regentropfen zerplatzen werden. Kaum vorstellbar, jetzt irgendwo im Biwak zu liegen.
Später siegt doch noch die Neugier, und ich stehe auf, um das Fenster zu öffnen. Ich will wenigstens hören, was da draußen passiert. Eine Sintflut ergießt sich, die ganze Luft ist voller Wasser. Zwischenzeitig ebbt es etwas ab, wird fast vorsichtig, als müsste es durchatmen und ausruhen, dann schwillt es wieder zu einem wütenden Lärm an. Und es hört nicht auf, wird nur gelegentlich von den grellen Blitzen erhellt und von tobendem Donnern übertönt.
Ich denke an den Götterfürsten Zeus mit seinem Donnerstab. Er hat ihn von Hephaistos bekommen, einer meiner Lieblingsfiguren der griechischen Mythologie. Hephaistos, der als Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Vulkane gilt, ist ein Sohn von Zeus. Bei seiner Geburt aber war er so behaart und sah so verkrüppelt aus, dass sein Vater ihn verschmähte und zum Entsetzen seiner Mutter Hera in hohem Bogen vom Olymp auf die Erde warf, wo er mit geborstenen Knochen von seiner Großmutter, der personifizierten Erd-Urgöttin Gaia, geborgen und gepflegt wurde. Die zeigte ihm das Feuer und lehrte ihn das Schmieden.
Zeus, bekannt für seine unersättliche Lust und Gier nach schönen Frauen, vergewaltigte unterdessen eines Tages Metis (sie steht für den Scharfsinn), eine Okeanide, also ein Wesen der Wasser. Da ihm vorausgesagt worden war, dass ein Sohn ihn einst stürzen würde, verschlang er Metis aus Sorge davor, dass sie diesen Sohn gebären könnte. So wuchs Athene, die aus der Vergewaltigung entstandene Tochter, in Zeus’ Kopf heran und verursachte ihm unsägliche Kopfschmerzen, über die er sich lautstark beklagte.
In einer Variante des Mythos hörte Hephaistos dies und schmiedete daraufhin eine Axt, mit der er auf Zeus’ Wunsch hin dessen Schädel spaltete, was der als Gott natürlich gut überstand. Anschließend sprang aus dem Schädel, als Kopfgeburt und damit Verkörperung des Geistes und schließlich auch als Tochter des Scharfsinns, Athene in voller Rüstung. Zeus war damit von seinen Kopfschmerzen geheilt und nahm seinen Sohn Hephaistos dankbar für diese Befreiung wieder im Kreis der Götter auf dem Olymp auf. Er versprach ihm sogar die schöne Aphrodite zur Frau, doch vorher, so bat der machtsüchtige Zeus, sollte Hephaistos ihm noch eine weitere Axt schmieden, die alle Erze sprengen könne. Bald darauf brachte Hephaistos dem Vater das Gewünschte: einen Donnerkeil, den dieser nur schütteln musste, um gewaltige Blitze schleudern, mächtigen Donner ertönen lassen und das Wetter steuern zu können. So wurde Zeus schließlich zum Donnergott.
Bis zum Morgen gewittert es mit Wucht. Noch nie habe ich ein so konstantes, so langes, so heftiges Gewitter erlebt.
Als ich morgens auf die überdachte Terrasse trete, bin ich angenehm überrascht, wie frisch es ist. Die letzten Tage waren schwül, da ist die Kühle eine große Erleichterung. Überhaupt waren die Erlebnisse der letzten Nacht für mich, als hätte man einen Reset-Knopf gedrückt. Jetzt bin ich angekommen.
Von Lia erhalte ich frische Hühnereier und ein großes Stück Brot, und ich mache mir in der kleinen Außenküche auf der Veranda ein Rührei zum Frühstück. Der Himmel grollt noch immer. Etwas weiter weg zwar, aber immer noch deutlich, als würde das Wetter sagen: „Denk bloß nicht, dass du jetzt losgehen kannst, ich bin schon noch da, und ich kann jederzeit wiederkommen.“
Und das tut es. Während ich auf der überdachten Veranda Yoga mache, beginnt es wieder sintflutartig zu schütten, und den fulminanten Blitzen, die auch tagsüber alles zu überblenden scheinen, folgen unmittelbar diese inbrünstigen Donnerschläge. Ich liebe so ein Wetter, liegt darin doch die ganze Kraft und der ganze Wille der Natur.
Eine Weile sitze ich in der Hollywoodschaukel auf der Terrasse und schaue in die dicht bewaldeten steilen Ausläufer des Gebirges. Zeus grollt noch immer. Es ist, als wollte er mir hier, am eigentlich ersten Tag meiner Tour, ganz deutlich zeigen, wer der Herr dieses Gebirges ist. Ich schaue in den Himmel. Der trägt zwar an manchen Stellen graue Schichtwolken, aber da ist nichts, was an die mir bekannten Gewitterwolken erinnert. Zwischendrin sind sogar einige blaue Stellen zu sehen, und der leichte Wind wirkt freundlich. Ich verstehe: Der Kaukasus hat seine eigenen Wetterregeln.
Ich bin dankbar für diese erste Lektion und stelle mich darauf ein, dass ich hier bestimmt noch eine Weile brauchen werde, bis ich die Wetterlage auch ohne App einschätzen kann.













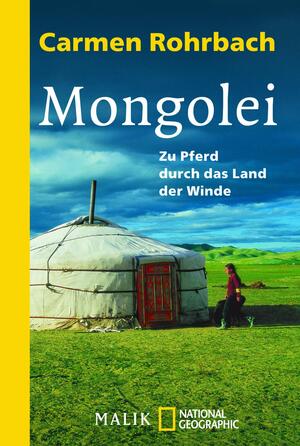



Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.