Fünfzig
Die Geschichte, wie ich sie kenne, geht so: Während Dana, unsere Mutter, auf der Fähre nach Longueuil zwischen zwei Brücken zwei Kinder gebar, stieg unser Großvater Maroun einige Kilometer entfernt die Feuertreppe des Seniorenwohnheims New Hope hinauf, um eine Rakete zu zünden. Dana trug dabei ein Hochzeitskleid, Großvater seinen besten Anzug und Hut. Es gibt ein Polaroidbild, das Jules, unser Vater, aufgenommen hat. Es ist kaum ausgeblichen und zeigt Dana auf Deck, kurz nach der Entbindung. Von Großvater gibt es ebenfalls ein Foto. Es findet sich auf Seite elf der Montreal Gazette vom 5. August 1986 und zeigt ihn im Moment seiner Verhaftung.
Unsere Eltern waren in diesem Sommer beide vierunddreißig Jahre alt und zum Unverständnis einer ganzen Heerschar von Verwandten und Freunden noch immer unverheiratet. Tanten, Vetter und Cousinen nahmen sie bei Kaffeekränzchen, Spaziergängen am Flussufer und sogar bei spontanen Begegnungen im Supermarkt zur Seite, um zu fragen, wann es endlich so weit sei. Dabei boten Dana und Jules, nahm man es genau, selbst hoffnungsvollsten Romantikern kaum Anlass zum Optimismus. In den fünfzehn Monaten ihrer Beziehung hatten sie es vollbracht, dreimal umzuziehen, sich zweimal zu trennen und einmal schwanger zu werden. Es war, als hätte Amor die beiden füreinander bestimmt, seinen Pfeil jedoch sturztrunken abgeschossen. Obwohl also nur wenige Beziehungen einen so funkensprühenden Untergang verhießen wie die Liaison der beiden, wurden die Umstehenden nicht müde, sie mit Fragen nach einer Hochzeit zu konfrontieren. Aus bestimmtem Grund: Dana und Jules hatten erst spät zueinandergefunden. Allerdings kannten sie einander schon viel länger. Als Kinder hatten sie unter den Augen derselben Verwandten in den Hinterhöfen des Saint-Laurent-Viertels gespielt. Mit sieben Jahren trennten sich ihre Wege oder besser: wurden getrennt. Und als sie sich schließlich – Mitte der Achtzigerjahre – an einer windigen Ecke in die Arme liefen, waren beide anderweitig verlobt. In den Augen der ihnen nahestehenden Personen bot ihre Verbindung so viele filmreife verpasste Gelegenheiten, dass diesen, als Dana und Jules endlich eine Beziehung führten, eine schnelle Ehe wohl als einziger Weg erschien, um ein erneutes Auseinanderdriften zu verhindern.
Aus den Mündern unserer Eltern klang das alles – Antrag, Einwilligung, Planung –, wenn sie uns Kindern davon erzählten, vor allem zweckmäßig und unspektakulär. Sie waren beide in Montréal geboren. Ihnen fehlte die Neigung zur Übertreibung, die ihren Vorfahren in den Genen saß, von der es heißt, sie könne eine Generation überspringen.
„Irgendwie scherten wir uns nicht um das, was damals normal war“, erzählte Mutter uns Kindern. Oder sie sagte: „Ich war schwanger. Es war einfach vernünftig.“
Wenn wir Vater fragten, sagte der nur: „Ich glaube, wir mussten uns erst finden.“
Was auch immer Dana und Jules zum Heiratsentschluss bewog: Es scheint einer jener Zufälle gewesen zu sein, die allen guten Geschichten zugrunde liegen, dass sie den 4. August als Datum wählten.
„Anscheinend hatte ganz Montréal vor, an diesem Tag zu heiraten“, erzählte Mutter. All die Jahre später schien sie immer noch ungläubig darüber. „Wir hatten keine Feier geplant, das ganze Drumherum fiel weg; aber wir bekamen einfach keinen Termin im Standesamt.“
Anstatt auf ein anderes Datum auszuweichen, schlug Jules vor, die Fähre vom Old Port of Montréal nach Longueuil zu nehmen, um die Eheschließung im dortigen Standesamt zu vollziehen. Unsere Eltern besaßen noch kein Auto, und hätten sie eins gehabt, sie hätten dennoch die Fähre genommen, denn die Staus auf den Brücken waren schon damals berüchtigt. Dana willigte ein. Sie war erst in der neunundzwanzigsten Woche. Bis auf einen Hang zu wirren Träumen und etwas Kurzatmigkeit gab es für sie keine Beschwerlichkeiten. Die Strecke über den Fluss war nur sieben Kilometer lang. Was sollte also schiefgehen?
Zur selben Zeit verfolgte unser Großvater einen eigenen Plan. Um ihn in die Tat umzusetzen, trug er sich drei Wochen in Folge für den Küchendienst im New Hope ein. Das Seniorenwohnheim hatte einen gemeinschaftlichen Speisesaal. Jeden Abend ab 17:30 Uhr reihte man sich vor der Theke ein, wo Köche das Essen auf die Teller gaben. Es gehörte zum Konzept, sich als Bewohner freiwillig einbringen zu können. Wer jahrelang einen Haushalt geschmissen hatte, hegte im Alter vielleicht den Wunsch, noch etwas zu tun zu haben, um bei Verstand zu bleiben. Es gab Beete, die gepflegt, Bücher, die sortiert werden wollten. Und es gab den Küchendienst. Im Durcheinander von Alltagsgesprächen und Besteckklirren schob Großvater Abend für Abend einen Geschirrwagen vor sich her, räumte dort ab, wo jemand aufgestanden war, wischte Krümel von Tischen und hielt sich ansonsten im Hintergrund. Das konnte er gut. Wir kannten ihn als plaudernden, herzlichen Mann, doch das war er vor allem im Kreis der Familie. Für die Heimbewohner war Maroun el Shami wie ein Buch in einem Regal, an das man nur über eine Leiter herankam. Zwar grüßte er höflich, blieb jedoch nirgendwo lang genug stehen, um angesprochen zu werden. Wenn er sich auf die Spieleabende einließ, jeden Mittwoch im dritten Stock, setzte er sich stets vor das Schachbrett, bis sich jemand fand, der es als das annahm, was es war: die Einladung, gemeinsam zu schweigen. Auf Gespräche über Politik oder – schlimmer noch – Sport ließ Großvater sich nicht ein, und falls er doch eine Meinung zu Brian Mulroney als Premierminister hatte oder zu Guy Lapointes Verteidigungskünsten auf dem Eis, so blieb die im New Hope ein Geheimnis.
Als er mit der Umsetzung seines Plans begann, war er unsichtbar geworden. Die Leute hatten aufgehört, ihn in Gespräche verwickeln zu wollen. Und so nahm auch niemand Notiz von dem Rucksackbeutel, den er über der Schulter trug: leer, wenn Großvater den Küchendienst begann, leicht ausgebeult, wenn er den Speisesaal verließ.
Etwas kann so oft und eindrücklich erzählt werden, dass man meint, sich selbst an die Ereignisse zu erinnern. Wir bekamen die Geschichten bereits im Kindesalter zu hören, und in den folgenden Jahren wurden sie bei verschiedenen Anlässen wieder und wieder erzählt. Anfangs noch einander ins Wort fallend und mit Abzweigungen, die sich als Einbahnstraßen entpuppen konnten, irrelevant für den Verlauf der Handlung. Später, als wir älter waren, mit wirksam gesetzten Pausen und ausgefeilten Erzählbögen, die sich wie Fäden eines Wandteppichs zu einem Bild verflochten. Ursprünglich waren es zwei getrennte Geschichten. Doch mit der Zeit verbanden sie sich zu einer Erzählung, die bei Familienfesten unter Girlanden und im Rauch der Grillfeuer weitergegeben wurde. Oder wir bekamen sie im kleinen Kreis vorgetragen, beim Sonntagsfrühstück, nur in Gegenwart unserer Eltern und unseres Großvaters.
Lina und ich liebten diese Geschichte. Obwohl wir darin kaum vorkamen, standen wir im Mittelpunkt. Am liebsten hörten wir sie, wenn wir den Zeitpunkt bestimmen durften. Meist war das um den Jahrestag der Ereignisse herum, und wir freuten uns Tage im Voraus darauf, bis wir es irgendwann nicht mehr aushielten. Dann rannte Lina los und zog die Erwachsenen aus allen Richtungen herbei, während ich die Sofakissen so auf dem Boden drapierte, dass wir einen Kreis bilden konnten.
„Ist die Rakete echt so weit geflogen?“
„Kam wirklich ein Fremder aus Michigan vorbei?“
„Ist der Krankenwagen mit Blaulicht gefahren?“
„Hat Abu Hamza Rache geschworen?“
Immer wieder stellten wir unsere Fragen, auch wenn wir die Antworten kannten. Selbst nach Jahren noch hofften wir insgeheim, den Erwachsenen etwas Unerwartetes zu entlocken. Vielleicht hatten wir auch das Gefühl, es gebe Dinge, die zwischen den Zeilen vor uns verborgen wurden. Wir waren jung, doch sogar uns war klar, dass es eine vage Geschichte blieb, von der Sorte, wie Eltern sie am liebsten erzählen.
Für unsere Mutter muss es ein aufreibender Sommer 1986 gewesen sein. Nicht nur wegen der Temperaturen, unter denen die Stadt ächzte und schwitzte, sondern auch, weil es ein Sommer der Veränderungen war. Die Schwangerschaft, natürlich. Ihr Körper. Die nahende Trauung. Aber jetzt, und das war neu, kam mit dem Rückzug von der Arbeit auch ein Innehalten hinzu, und Innehalten war Dana nicht gewohnt. Noch immer stapelten sich die Drehbücher auf ihrem Nachttisch, noch immer ging sie alten Gewohnheiten nach. Nachts, wenn das Liegen unbequem wurde, stopfte sie sich das Kissen in den Rücken und las bei gedimmtem Licht, als ginge sie weiterhin zur Arbeit.
Als Kinder wuchsen wir in einem engen Häuschen auf, weit außerhalb des Stadtkerns. Es hatte verwinkelte Zimmer, schiefe Treppen und Türrahmen, und da es im Schatten größerer Häuser stand, schien kaum einmal die Sonne in unsere Fenster. Doch dank der Fähigkeit unserer Mutter, in Räumen Dinge zu sehen, die andere nicht sahen, war es ein schönes Haus. Es wandelte sich mit den Jahreszeiten. Manchmal saß Dana, bevor sie eine Veränderung vornahm, stundenlang in ein und demselben Raum, sah Schatten wandern, das Licht sich verändern, und überraschte uns dann mit Einrichtungskniffen, die uns glauben ließen, gerade erst eingezogen zu sein.
Es war diese Fähigkeit, mit der sie sich Mitte der Siebzigerjahre einen der raren Jobs in Montréals Filmindustrie gesichert hatte. In Hollywood fand damals eine Zeitenwende statt. Junge Regisseure rebellierten gegen die Macht der großen Studios. Namen wie Friedkin, Bogdanovich, Polanski, Scorsese oder Coppola machten die Runde, und mit den Geschichten, die sie erzählten, sickerte das echte Leben in die Filme ein: moralische Verwerfungen, scheiternde Helden. Montréal war gerade dabei, sich einen eigenen Namen zu machen. Seit jeher war die Stadt Anziehungspunkt für Menschen aller Länder gewesen, um sich hier niederzulassen, oder als Tor nach Westen, und diese Einflüsse hatten das Stadtbild geprägt. Die Regisseure, die nun auf die Bildfläche drängten, noch ohne Zugriff auf die großen Budgets, wandten sich auch nach Kanada und fanden in Montréal eine Stadt, die jede Stadt der Welt zu sein vermochte.
Dana fand einen Job als Locationscout in einer Produktionsfirma, was sämtliche Verwandte vor Stolz beinahe platzen ließ und zu der Annahme verleitete, sie werde bald mit Marlon Brando beim Frühstück sitzen. Und falls nicht, könnte sie ihren Angehörigen fortan zumindest freien Eintritt in jedes Kino der Stadt verschaffen.
Sie begann, ihre Umgebung mit neuen Augen zu sehen. Montréal konnte sich in New York, Baltimore, Detroit, Chicago, Paris, Warschau oder Berlin verwandeln. Oder auch in das Montréal eines anderen Jahrhunderts. Was sie an ihrem Beruf liebte, war die Möglichkeit, die Stadt von innen zu sehen. Dana kannte die Straßen und Gassen seit Kindheitstagen, wusste, wie Wege miteinander verbunden waren. Doch jetzt erhielt sie mit nur einem Anruf Zutritt zu Wohnungen, Häusern, Palästen, die man sonst nur von außen oder aus Maklerbroschüren kannte. Sie bekam Drehbücher zugeschickt, machte Listen der Schauplätze, die im Film relevant sein würden. Sie war äußerst gewissenhaft. Sie besuchte infrage kommende Orte mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten, machte sich weitere Notizen über die Beschaffenheit des Lichts, das Auftreten von Störgeräuschen – eine rumpelnde Straßenbahn, eine Baustelle in der Nachbarschaft –, sah sich Zufahrtswege für Filmcrews an, Parkmöglichkeiten für Lastwagen, Kamerakräne und holte Genehmigungen ein für den Dreh oder das Sperren von Straßen.
„Ist wie die Bürgermeisterin, unsere Dana“, sagten die Verwandten.
In der ersten Zeit des Rückzugs hatte ihre Schwangerschaftsvertretung sich fast täglich mit Fragen gemeldet. Inzwischen aber rief niemand mehr an. Zurückgeworfen auf träge, lange Tage in ihrer Wohnung, erkannte Dana – oder glaubte zu erkennen –, dass sie ersetzbar war. Das war die eine Veränderung. Aber auch an Jules nahm sie einen Wandel wahr, der sie überraschte und der erfreulich war.
Anfangs, das gab Vater später zu, war er wenig begeistert gewesen von der Idee, ein Kind in die Welt zu setzen. Er war das vierte von acht Geschwistern und erinnerte sich, wie es sich anfühlte, wenn man von älteren Brüdern in Schränke gesperrt oder in Mülltonnen gesteckt wurde, es aber nicht an den Jüngeren auslassen konnte, weil die einfach zu klein waren. Der Unterschied zu seiner jüngsten Schwester – unserer Tante Emma – betrug sechzehn Jahre. Und weil sein Vater früh verstorben und seine Brüder früh ausgezogen waren, hatte er mit fünfzehn bereits das Gefühl gehabt, den ganzen Spaß – Windeln, Weinen, Wutausbrüche – schon mitgemacht und hinter sich gebracht zu haben. Einerseits war Jules mit dreiunddreißig klar, wie unsinnig diese Haltung war. Andererseits konnte er sich nicht davon freimachen, seine Erkenntnisse als empirisch evident zu betrachten: Kinder, die aufgehört hatten, alles und jeden vollzuspucken, kletterten in Spülmaschinen, hämmerten auf Möbeln herum, zerkauten Gehaltsnachweise oder tranken Flüssigseife und Schlimmeres. Nur alle paar Generationen tauchten sie auf wie Gerüchte, in Bergdörfern oder unter Inselvölkern, und selbst dort galten sie als ungewöhnlich: Babys, auf die diese Mängelliste nicht zutraf. Wann immer das Thema vor Dana oder – was weitaus öfter passierte – vor Verwandten zur Sprache kam, wiegelte Jules ab und führte Einwände an. Wie genau sie ihn überredete, ob er zur Besinnung kam oder welchen Umständen sie ihre Schwangerschaft verdankte, blieb das Geheimnis der beiden. Eine Mischung aus natürlichem Anstand und mangelnder Vorstellungskraft hielt Lina und mich als Kinder davon ab, nachzufragen oder uns diesen Teil der Geschichte auszumalen.
Jules’ Zweifel verflogen erst, als er Dana an einem verschneiten Tag Anfang März zum Ultraschall begleitete. Ihre Hand lag in seiner. Schneeflocken schmolzen auf ihren Jacken und tropften auf den Boden des Untersuchungszimmers. Er sah auf das Monitorflimmern, hörte das Herz seines Kindes schlagen. Und fand es unglaublich. Als er später im Kollegenkreis davon erzählte, imitierte er das Pochen, indem er mehrmals schnell gegen einen Pfannenboden klopfte. Jules arbeitete für ein Filmstudio. Er bereitete nicht nur Mahlzeiten für die Crew vor, die sich in den Drehpausen an langen Tischen traf, sondern auch das Essen für Szenen des Drehs. Das Sandwich zum Beispiel, in das Stacy Keach als Huntley McQueen in Two Solitudes beißt, hat unser Vater geschmiert. Natürlich hielt er die Bedeutung von Essen in Filmen für maßlos unterschätzt. Scorseses Raging Bull fand er in erster Linie wegen des falsch gebratenen Steaks interessant, das Jake LaMotta, gespielt von Robert De Niro, im Film ausrasten lässt. Die Hummer-Szene in Annie Hall fand er nicht Woody Allens gespielter Angst wegen toll, sondern weil er nie zuvor so makellose Scherentiere auf einer Leinwand gesehen hatte. Am liebsten aber mochte er den Anfang von Breakfast at Tiffany’s, als Audrey Hepburn neunundfünfzig Sekunden nach Filmbeginn in einen dänischen Plunder beißt und sich dabei zur Melodie von Moon River im Schaufenster spiegelt. „Dieses Gebäck“, sagte er eines Abends feierlich vor dem Fernseher, „trägt den gesamten Film. Besser wird’s nicht mehr.“
Die Untersuchung jedenfalls ließ zwei Dinge, die Jules wichtig waren, auf unerwartete Weise zusammenkommen. In den Tagen nach dem Ultraschall begann er, in Lebensmitteln Föten im Zustand der achten Woche zu sehen: in Brombeeren, Shrimps oder Kidneybohnen. „Das ist doch nicht zu glauben“, murmelte er jedes Mal. Seine Sorgen verschwanden und machten Vorstellungen von einer Zukunft Platz, die gar nichts Erschreckendes mehr hatten: Spaziergänge am Strand, kleine Fußabdrücke neben seinen. Nachhausewege vom Markt, Hand in Hand mit seiner Tochter. Jules’ Unsicherheit kehrte erst zurück, als er Dana zum nächsten Termin begleitete, wo der Ärztin ein „Hoppla“ entfuhr, gefolgt von einem „Da ist ja noch eins“.
Was Dana in jenem Sommer auffiel, war die Art, wie Jules „anzupacken begann“ – so nannte sie das. Er kaufte Zeitungen, und gemeinsam lasen sie die Wohnungsannoncen, denn die Bleibe in der Rue Saint-Aubin, die sie gerade erst bezogen hatten, war für eine Familie zu klein. Als sie die fünfundzwanzigste Woche vollendet hatten, kaufte Jules Bretter, Nägel und Leim und zimmerte einen Stubenwagen, der groß genug für zwei Babys war. Wie in der Anfangszeit ihres Kennenlernens kochte er wieder für Dana, aufwendig und indem er die Zutaten auf dem Teller zu Kunstwerken stilisierte. Und im Anschluss begann er, ohne dass sie ihn je darum bitten musste, ihr die Füße zu massieren.
Die Veränderungen an seiner Frau faszinierten ihn. Dass Danas Brüste voller wurden, damit hatte er gerechnet. Aber jetzt wurden auch ihre Brustwarzen dunkler. Braune Flecken tauchten an ihren Armen und Beinen auf. Eine Linie erschien unterhalb des Nabels.
„Sicher, dass das normal ist?“
Es war Mitte Juli. Sie lagen auf dem Küchenboden vor dem geöffneten Kühlschrank. Und weil es bis auf das elektrische Summen still war im Raum, während draußen der Sommer tobte, war es, als ob sie sich in zwei Welten bewegten: Vor dem Fenster tanzten die Schatten der Birken über den Gehsteig, Schulkinder wichen lachend Passanten aus, und eine Frau in Stöckelschuhen zog ein Kind hinter sich her, von dessen Kinn Schokoladeneis tropfte. Und drinnen fuhr Jules mit dem Finger das Fleckenarchipel auf Danas Haut nach und dachte: Ich bin vierunddreißig, aber mein Leben fängt gerade erst an.
„Ja, ganz sicher“, sagte sie. Und: „Das kitzelt.“
Jules wiederum fiel auf, wie ihre Ruhe in dieser Zeit auf ihn überging.
„Es war wirklich seltsam“, erzählte er uns, „Dana hatte die Fähigkeit, mir das Gefühl zu geben, sie habe alles unter Kontrolle und alles werde gut werden, ohne dass ich sagen konnte, wie sie es anstellte.“
„Das ist ja nicht auszuhalten“, unterbrach ihn Lina und rollte mit den Augen. Da waren wir neun oder zehn. „Sag doch einfach, ihr wart verknallt!“
Aber es war nicht nur das. Diese Eigenschaft blieb unserer Mutter, solange wir sie um uns hatten, erhalten, und auch wir spürten es. Sie gab uns das Gefühl, uns wachsam und sanft zu beobachten, immer bereit einzuschreiten, sollte es nötig sein. Selbst wenn wir sie ansahen und sie in einer Zeitschrift las, aus dem Fenster schaute oder in ihre Teetasse, wenn sie in Gedanken versunken war oder ein Gespräch führte, ja selbst wenn sie auf dem Sofa schlief, hatten wir das Gefühl, sie habe uns eben noch angesehen und gerade erst weggeschaut oder die Augen geschlossen. Es war eine seltene Verbindung von Abwesenheit und Zuneigung – und Jules wurde sich dessen zum ersten Mal bewusst dort auf dem Boden der Küche in der Rue Saint-Aubin, vierunddreißig Jahre jung und eingerahmt von Danas Arm und der tropfenden Kühlschranktür.

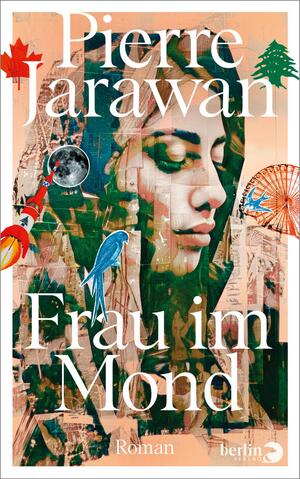
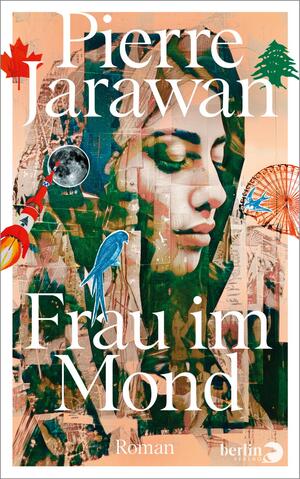









Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.