1
Als ich vor ein paar Jahren pleite war, stellte ich mich freiwillig für eine Forschungsstudie an der Universität von Pennsylvania zur Verfügung. Die Wegbeschreibung führte mich zur Klinik auf dem Campus in West Philly und schließlich in einen großen Hörsaal, in dem jede Menge Frauen saßen, alle zwischen achtzehn und fünfunddreißig.
Es waren nicht ausreichend Stühle vorhanden, und da ich eine der Nachzüglerinnen war, musste ich mich fröstelnd auf den Boden hocken. Es gab kostenlosen Kaffee und Schokodonuts, und auf einem großen Bildschirm lief The Price Is Right, aber die meisten glotzten auf ihre Handys. Die Stimmung glich der im Warteraum einer Zulassungsstelle, außer dass wir stundenweise bezahlt wurden und mehr oder weniger alle recht froh darüber zu sein schienen, den ganzen Tag warten zu müssen.
Irgendwann erhob sich dann eine Ärztin in einem weißen Laborkittel und stellte sich uns vor. Sie sagte, ihr Name sei Susan oder Stacey oder Samantha und sie sei Gastmitglied im Programm für klinische Forschung. Sie las uns die üblichen Haftungsausschlüsse und warnenden Hinweise vor und erinnerte uns daran, dass die Entlohnung in Form von Amazon-Geschenkgutscheinen erfolgen werde, nicht in Form von Schecks oder Bargeld. Hier und da kam Gemurre auf, aber mir war das egal, denn ich hatte einen Freund, der mir Geschenkgutscheine für achtzig Cent pro Dollar abkaufte. Also war ich weiterhin bereit, teilzunehmen.
Alle paar Minuten rief Susan (ich glaube, sie hieß Susan?) einen Namen vom Zettel auf ihrem Klemmbrett auf, worauf eine von uns den Raum verließ. Niemand kam jemals zurück. Bald gab es reichlich freie Plätze, aber ich blieb auf dem Boden sitzen, weil ich befürchtete, mich bei der kleinsten Bewegung übergeben zu müssen. Mein ganzer Körper schmerzte, und ich hatte Schüttelfrost. Immerhin sprach sich irgendwann herum, dass man die Probanden nicht vorher untersuchte. Das hieß, niemand würde meinen Urin testen, meinen Puls messen oder sonst irgendwas tun, was mich aus dem Rennen geworfen hätte. Also schob ich mir eine 40er in den Mund und lutschte sie so lange, bis sich der wachsgelbe Überzug ablöste. Dann spuckte ich sie mir auf die Handfläche, zerdrückte sie mit dem Daumen und schnupfte etwa ein Drittel davon, gerade genug, um mich wieder auf Touren zu bringen. Den Rest wickelte ich in ein kleines Stück Folie für später. Danach hörte das Zittern auf, und auf dem Boden zu warten, war nicht mehr ganz so übel.
Etwa zwei Stunden später rief die Ärztin schließlich: „Quinn? Mallory Quinn?“ Ich ging den Gang hinunter auf sie zu, wobei ich meinen schweren Winterparka hinter mir herschleifte. Falls sie bemerkte, dass ich high war, gab sie keinen Kommentar dazu ab. Sie fragte mich nur nach meinem Alter (neunzehn) und meinem Geburtsdatum (3. März) und verglich dann meine Antworten mit den Daten auf dem Zettel an ihrem Klemmbrett. Ich schätze mal, sie entschied, dass ich nüchtern genug war, denn sie führte mich durch ein Labyrinth von Fluren, bis wir zu einem kleinen, fensterlosen Raum gelangten.
In ihm saßen fünf junge Männer nebeneinander auf Klappstühlen. Da sie alle auf den Boden starrten, konnte ich ihre Gesichter nicht sehen. Ich ging davon aus, dass sie Medizinstudenten oder Assistenzärzte waren – sie trugen alle Krankenhauskittel, noch mit Bügelfalten und strahlend marineblau, als seien sie eben erst gekauft worden.
„In Ordnung, Mallory, bitte stellen Sie sich vorne in den Raum, mit dem Gesicht zu den Männern. Genau hier auf das X, perfekt. Bevor wir Ihnen eine Augenbinde anlegen, erkläre ich Ihnen kurz, was geschehen wird.“ Ich sah, dass sie eine schwarze Augenmaske in der Hand hielt, so eine weiche aus Baumwolle, wie sie meine Mutter immer vor dem Schlafengehen aufsetzte.
Sie erklärte mir, dass die Männer im Moment alle auf den Boden starrten, in den nächsten Minuten jedoch meinen Körper ansehen würden. Meine Aufgabe sei es, die Hand zu heben, wenn ich das Gefühl hätte, einen „männlichen Blick“ auf meinem Körper zu spüren. Ich solle meine Hand so lange erhoben halten, wie das Gefühl andauere, und sie wieder senken, wenn es verschwinde.
„Wir machen das fünf Minuten lang, aber wenn wir fertig sind, werden wir Sie vielleicht bitten, das Experiment zu wiederholen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, bevor wir beginnen?“
Ich fing an zu lachen. „Ja, habt ihr Typen Fifty Shades of Grey gelesen? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das hier eine Szene aus Kapitel zwölf ist.“
Das war mein Versuch, die Sache mit ein wenig Humor aufzulockern. Susan lächelte, um höflich zu sein, aber keiner der Jungs achtete auf mich. Sie nestelten alle an ihren Klemmbrettern herum und synchronisierten ihre Stoppuhren. Die Stimmung im Raum war rein wissenschaftlich. Susan setzte mir die Schlafmaske auf und stellte den Verschluss so ein, dass sie nicht zu eng anlag. „In Ordnung, Mallory, sitzen Sie bequem?“
„Klar doch.“
„Und sind Sie bereit, anzufangen?“
„Ja.“
„Dann zähle ich jetzt bis drei, und wir legen los. Meine Herren, halten Sie Ihre Uhren bereit. Und eins, zwei, drei.“
Es ist total schräg, fünf Minuten lang mit verbundenen Augen in einem mucksmäuschenstillen Raum reglos zu verweilen und dabei zu wissen, dass diese Kerle einem auf die Titten oder den Hintern oder was auch immer schauen. Es gab keinerlei Geräusche oder Anhaltspunkte, die mir hätten helfen können, zu erraten, was geschah. Aber ich spürte es definitiv, wenn sie mich anschauten. Ich hob und senkte meine Hand mehrmals, und die fünf Minuten fühlten sich wie eine Stunde an. Als wir fertig waren, bat Susan mich tatsächlich, das Experiment zu wiederholen, und wir machten alles noch einmal. Dann bat sie mich sogar, das Experiment ein weiteres Mal zu wiederholen! Als sie mir schließlich die Augenbinde abnahm, standen alle Kerle auf und begannen zu klatschen, als hätte ich gerade einen Oscar gewonnen.
Susan erklärte, sie hätten das Experiment schon die ganze Woche mit Hunderten Frauen durchgeführt. Ich sei jedoch die erste, die ein nahezu perfektes Ergebnis abgeliefert und die Blicke in den drei Runden mit 97 Prozent Genauigkeit gemeldet habe.
Sie sagte den Jungs, sie sollten eine Pause machen, führte mich in ihr Büro und begann, Fragen zu stellen. Und zwar: Woher wusste ich, dass die Männer mich anstarrten? Mir fehlten die Worte, um das zu erklären – ich hatte es einfach mitbekommen. Es war so ein flattriges Gefühl am Rande meiner Wahrnehmung – eine Art Spidey-Superhelden-Sinn. Bestimmt haben Sie es auch schon mal gehabt und wissen genau, wovon ich spreche.
„Außerdem war da noch so eine Art Geräusch.“
Nun riss sie die Augen auf. „Wirklich? Sie hören etwas?“
„Manchmal schon. Es ist so ein hoher Ton. Wie wenn eine Stechmücke ganz nah am Ohr summt.“
Sie griff so hektisch nach ihrem Laptop, dass sie ihn fast fallen gelassen hätte. Dann tippte sie auf der Tastatur herum und fragte mich schließlich, ob ich in einer Woche für weitere Tests wiederkommen würde. Ich sagte ihr, für zwanzig Dollar die Stunde würde ich so oft wiederkommen, wie sie nur wollte. Ich gab ihr meine Handynummer, und sie versprach, mich anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Aber noch am selben Abend tauschte ich mein iPhone gegen fünf Oxy-80er Tabletten ein. Sie hatte also keine Möglichkeit, mich zu erreichen, und ich habe seitdem nie wieder von ihr gehört.
Jetzt, da ich clean bin, bereue ich eine Million Dinge, und mein iPhone eingetauscht zu haben, ist das geringste Problem. Aber manchmal erinnere ich mich an das Experiment und denke dann darüber nach. Ich habe versucht, die Ärztin im Internet aufzuspüren, aber ich kann mich ja nicht einmal mehr an ihren korrekten Namen erinnern. Eines Morgens nahm ich mal den Bus zur Uniklinik und versuchte, den Seminarraum zu finden, aber der Campus sieht heute ganz anders aus; da stehen jede Menge neuer Gebäude, und alles ist total zugebaut. Ich habe versucht, Begriffe wie „Blickwahrnehmung“ bei Google zu suchen, aber jedes Ergebnis besagt, dass so ein Gespür kein nachweisbares Phänomen ist – es gibt keinen Beweis dafür, dass jemand „Augen im Hinterkopf“ hat.
Ich schätze mal, ich habe mich damit abgefunden, dass das Experiment nicht wirklich stattgefunden hat. Es ist vermutlich eher eine der vielen nicht realen Erinnerungen, die mir dank meines Missbrauchs von Oxycodon, Heroin und anderen Drogen im Gedächtnis hängen geblieben sind.
Mein Sponsor, Russell, meint, derart falsche Erinnerungen seien unter Süchtigen weit verbreitet. Er sagt, das Gehirn eines Süchtigen „erinnere“ sich an glückliche Fantasien, damit wir die echten Erinnerungen vermeiden können – all die beschämenden Dinge, die wir angerichtet haben, um high zu werden, all die beschissenen Lügen und Betrügereien, mit denen wir gute Menschen, die uns liebten, verletzt haben.
„Achte doch nur mal auf die Details deiner Geschichte“, gibt Russell zu bedenken. „Du kommst auf dem Campus einer renommierten Ivy-League-Universität an. Du bist zugedröhnt vom Kiffen, und niemand kümmert sich um dich. Du betrittst einen Raum mit gut aussehenden jungen Ärzten. Die starren dann fünfzehn Minuten lang auf deinen Körper – und brechen am Ende in stürmischen Applaus aus! Ich meine, nun komm schon, Mallory! Man muss nicht Sigmund Freud sein, um dahinterzukommen!“
Natürlich hat er recht. Bei der Rehabilitation für Suchtkranke ist es mit am schwersten, sich damit abzufinden, dass du deinen eigenen Erinnerungen nicht mehr trauen kannst. Du musst dir sogar darüber klar werden, dass dein eigenes Gehirn zu deinem schlimmsten Feind geworden ist. Es wird dich zu schlechten Entscheidungen verleiten, Logik und gesunden Menschenverstand außer Kraft setzen und deine am meisten geschätzten Erinnerungen zu abstrusen Fantasien verfälschen.
Aber hier mal ein paar Fakten, an denen es nichts zu rütteln gibt:
Ich heiße Mallory Quinn und bin einundzwanzig Jahre alt.
Ich bin seit achtzehn Monaten in der Reha und kann guten Gewissens von mir sagen, dass ich kein Verlangen verspüre, Alkohol oder Drogen zu mir zu nehmen.
Ich habe das Zwölf-Schritte-Programm durchlaufen und mich dem Glauben zugewandt. Sie werden mich zwar nicht gerade an Straßenecken stehen sehen, wo ich Bibeln verteile, aber ich bete jeden Tag dafür, clean zu bleiben, und bis zum jetzigen Zeitpunkt klappt das auch.
Ich lebe im Nordosten von Philadelphia im Safe Harbor, einem von der Stadt geförderten Heim für Frauen im fortgeschrittenen Reha-Stadium. Wir nennen es „Dreivierteloffene Einrichtung“, weil wir alle bewiesen haben, dass es uns ernst ist mit dem Cleansein und wir uns eine Menge persönlicher Freiheiten verdient haben. Wir kaufen unsere eigenen Lebensmittel, kochen unsere eigenen Mahlzeiten und müssen nicht mehr Unmengen nerviger Regeln befolgen.
Montags bis freitags arbeite ich als Hilfslehrkraft in der Aunt Becky’s Childcare Academy, einem von Mäusen befallenen Reihenhaus mit sechzig zukünftigen Schülerinnen und Schülern im Alter von zwei bis fünf. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, Windeln zu wechseln, Goldfisch-Cracker zu verteilen und Sesamstraßen-DVDs abzuspielen. Nach der Arbeit gehe ich joggen und nehme anschließend an einem Meeting teil oder bleibe einfach im Safe Harbor mit meinen Mitbewohnerinnen. Wir schauen uns dann alle auf Hallmark Channel Filme wie Sailing into Love oder Forever in My Heart an. Lachen Sie ruhig, wenn Sie wollen, aber ich garantiere Ihnen, dass Sie in einem Film auf Hallmark niemals eine Prostituierte sehen werden, die weiße Pulverlinien schnupft. Ich will nämlich nicht, dass solche Bilder bei mir Erinnerungen wachrufen.
Russell hat sich bereit erklärt, mich zu betreuen, weil ich mal Langstreckenläuferin war; er hat viel Erfahrung im Trainieren von Läufern. Russell war Assistenztrainer des Teams USA bei den Olympischen Sommerspielen 1988. Später führte er die Uniteams von Arkansas und Stanford zu NCAA Leichtathletik-Meisterschaften. Noch später hat er dann unter dem Einfluss von Methamphetamin seinen Nachbarn überfahren. Russell verbüßte fünf Jahre wegen fahrlässiger Tötung und wurde danach zum Priester geweiht. Heute betreut er gleichzeitig fünf oder sechs Süchtige, die meisten von ihnen sind aus der Bahn geworfene Sportler wie ich.
Russell hat mich dazu inspiriert, wieder mit dem Training zu beginnen (er nennt es „Rennen für die Reha“), und er erarbeitet Woche für Woche auf mich zugeschnittene Trainingspläne: Langstreckenläufe, im Wechsel mit Windsprints entlang des Schuylkill River; dazu kommen noch Gewichtheben und Konditionstraining im YMCA. Russell ist achtundsechzig und hat eine künstliche Hüfte: Trotzdem stemmt er immer noch zweihundert Pfund und kommt an den Wochenenden vorbei, um Seite an Seite mit mir zu trainieren, mir Tipps zu geben und mich zu motivieren. Er erinnert mich ständig daran, dass Läuferinnen ihren Zenit nicht vor dem fünfunddreißigsten Lebensjahr erreichen und dass meine besten Jahre noch weit vor mir liegen.
Außerdem ermutigt er mich, Pläne für die Zukunft zu schmieden, einen Neuanfang in einer neuen Umgebung zu wagen, weit weg von alten Freunden und Gewohnheiten. Aus diesem Grund hat er für mich ein Vorstellungsgespräch bei Ted und Caroline Maxwell arrangiert – Freunde seiner Schwester, die kürzlich nach Spring Brook, New Jersey, gezogen sind. Die beiden suchen ein Kindermädchen, das auf ihren fünfjährigen Sohn Teddy aufpasst.
„Sie sind gerade aus Barcelona zurückgekommen. Der Vater arbeitet in der Computerbranche. Oder in der Wirtschaft? Irgendwas, das gut bezahlt wird, die Details habe ich vergessen. Jedenfalls haben sie sich hier niedergelassen, damit Teddy – das Kind, nicht der Vater – im Herbst eingeschult werden kann. Vorschule. Sie wollen also, dass du ihn bis September betreust. Aber wenn alles gut läuft – wer weiß? Vielleicht übernehmen sie dich ja.“
Russell besteht darauf, mich zum Vorstellungsgespräch zu fahren. Er gehört zu den Leuten, die ständig so aussehen, als wollten sie gleich ins Fitnessstudio, auch wenn sie gerade gar nicht trainieren. Heute trägt er einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug mit weißen Streifen. Wir sitzen in seinem SUV, fahren auf der linken Spur über die Ben Franklin Bridge und überholen den langsam fließenden Verkehr, während ich mich am Angstgriff festklammere und auf meinen Schoß starre, bemüht, nicht auszuflippen. In Autos fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich benutze sonst eigentlich immer den Bus oder die U-Bahn. Außerdem verlasse ich gerade seit fast einem Jahr zum ersten Mal Philadelphia. Wir fahren zwar nur zehn Meilen raus in die Randbezirke, aber es fühlt sich so an, als würde ich zum Mars fliegen.
„Was hast du denn?“, fragt Russell.
„Nichts.“
„Du bist verkrampft, Mallory. Mach dich locker.“
Wie soll ich denn entspannen, wenn uns gerade dieser riesige Bus rechts überholt? Er ist wie die Titanic auf Rädern und so nah, dass ich aus dem Fenster greifen und ihn berühren könnte. Ich warte, bis er vorbeigefahren ist und ich reden kann, ohne schreien zu müssen.
„Was ist mit der Mutter?“
„Caroline Maxwell. Sie ist Ärztin im Veteranenkrankenhaus, in dem auch meine Schwester Jeannie arbeitet. Von ihr weiß ich, dass sie jemanden suchen.“
„Wie viel weiß sie über mich?“
Er zuckt mit den Schultern. „Sie weiß, dass du seit achtzehn Monaten clean bist. Und ich habe dich ihr ohne Wenn und Aber empfohlen.“
„Das habe ich damit nicht gemeint.“
„Mach dir keine Sorgen. Ich habe ihr deine ganze Geschichte erzählt, und sie freut sich sehr darauf, dich kennenzulernen.“ Ich muss eine skeptische Miene aufgesetzt haben, denn Russell legt nach: „Die Frau arbeitet beruflich mit Süchtigen. Und ihre Patienten sind altgediente Soldaten. Wir reden hier von Navy SEALs, von echt abgefuckten afghanischen Kriegstraumata. Nimm mir das nicht krumm, Mallory, aber im Vergleich zu denen klingt deine Geschichte gar nicht so dramatisch.“
Ein Arschloch in einem Jeep wirft eine Plastiktüte aus dem Fenster, und wir haben keinen Platz, um einen Schlenker zu machen, also knallen wir mit sechzig Meilen pro Stunde gegen das Ding, und es erklingt ein lauter Knall von zerberstendem Glas. Es hört sich an wie die Explosion einer Bombe. Russell greift einfach nach dem Regler der Klimaanlage und klickt sie auf zwei Stufen kühler. Ich halte den Blick auf meinen Schoß geheftet, bis ich höre, wie der Motor leiser wird, und spüre, wie wir die sanfte Kurve einer Ausfahrt nehmen.
Spring Brook ist eines dieser kleinen Käffer in South Jersey, die es schon zu Zeiten der Amerikanischen Revolution gab. Hier stehen jede Menge historischer Häuser im Kolonial- und im viktorianischen Stil, auf deren Veranden US-Flaggen flattern. Die Straßen sind ordentlich gepflastert, die Bürgersteige makellos sauber. Nirgends liegt auch nur ein Fitzelchen Müll herum.
Wir halten vor einer roten Ampel, und Russell fährt beide Fensterscheiben herunter.
„Hörst du das?“, fragt er.
„Ich höre gar nichts.“
„Genau. Es ist friedlich. Das ist genau das Richtige für dich.“
Die Ampel springt auf Grün, und wir fahren nun einen drei Häuserblock langen Straßenabschnitt mit Geschäften und Restaurants entlang – mit einem Thai, einem Smoothie-Laden, einer veganen Bäckerei, einer Hundetagesstätte und einem Yogastudio. Es gibt eine Nachmittagsschule namens „Mathe-Gymnasium“ und einen kleinen Buchladen mit angeschlossenem Café. Und natürlich darf auch ein Starbucks mit hundert Teenagern und Jugendlichen davor, die allesamt auf ihren iPhones rumdaddeln, nicht fehlen. Sie sehen aus wie die Kinder in einem Werbefilm von Target. Sie tragen bunte Klamotten und brandneue Schuhe.
Dann biegt Russell in eine Seitenstraße ein, und wir fahren an einem makellosen Vorstadthaus nach dem anderen vorbei. Große, ausladende Bäume werfen lange Schatten auf die Bürgersteige und den Straßenzug. Auf Hinweisschildern steht in großen Buchstaben FUSS VOM GAS – HIER LEBEN KINDER!, und als wir an einer großen Kreuzung ankommen, winkt uns dort ein lächelnder Schülerlotse in einer neonfarbenen Sicherheitsweste durch. Alles ist bis ins kleinste Detail so perfekt, dass es sich anfühlt, als würden wir durch eine Filmkulisse fahren.
Schließlich fährt Russell an den Straßenrand und hält im Schatten einer Trauerweide an. „Also, Mallory, bist du bereit?“
„Ich weiß nicht.“
Ich klappe die Sonnenblende herunter und betrachte mein Spiegelbild. Auf Russells Anregung hin habe ich mich wie eine Betreuerin in einem Sommercamp gekleidet – grüner Rollkragenpullover, khakifarbene Shorts und makellos weiße Sneaker. Ich hatte immer lange Haare, die mir bis zur Taille reichten, aber gestern habe ich mir meinen Zopf abgeschnitten und die Haare einer Krebshilfe-Organisation gespendet. Geblieben ist nur noch ein sportlicher schwarzer Bob. Ich erkenne mich selbst kaum wieder.
„Hier noch zwei kostenlose Ratschläge“, sagt Russell. „Erstens, vergiss nicht zu erwähnen, dass das Kind begabt ist.“
„Wie soll ich das denn erkennen?“
„Das spielt keine Rolle. In dieser Stadt sind alle Kinder begabt. Bau das einfach irgendwie ins Gespräch mit ein.“
„Na gut. Und wie lautet der zweite Ratschlag?“
„Tja, wenn das Gespräch schlecht läuft? Oder wenn du glaubst, dass die beiden unentschlossen sind? Dann kannst du immer noch hiermit punkten.“
Er öffnet das Handschuhfach und zeigt mir etwas, das ich wirklich nicht mit ins Haus dieser beiden nehmen möchte.
„Oh, Russell, ich weiß nicht.“
„Nimm es, Mallory. Betrachte es als eine Art Trumpfkarte. Du musst sie nicht ausspielen, aber vielleicht brauchst du sie.“
Ich habe während der Reha genug Horrorgeschichten gehört, um zu wissen, dass er wahrscheinlich recht hat. Also nehme ich das blöde Ding und schiebe es tief in meine Tasche.
„Gut“, lenke ich ein. „Danke, dass du mich hergefahren hast.“
„Hör zu, ich werde beim Starbucks auf dich warten. Ruf mich an, wenn du fertig bist, dann fahre ich dich wieder zurück.“
Ich behaupte beharrlich, dass es mir gut geht, sage ihm, dass ich den Zug zurück nach Philadelphia nehmen kann, und dränge Russell, jetzt nach Hause zu fahren, bevor der Verkehr noch dichter wird.
„Also schön, aber ruf mich an, wenn du fertig bist“, erwidert er. „Ich möchte jedes Detail erfahren, okay?“












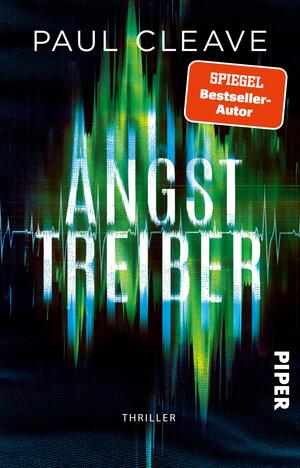
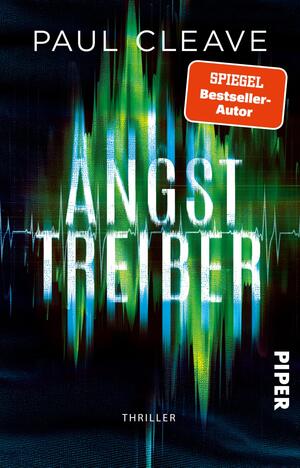



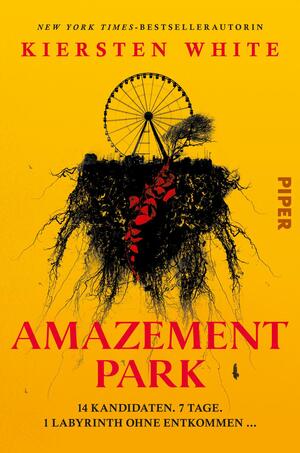
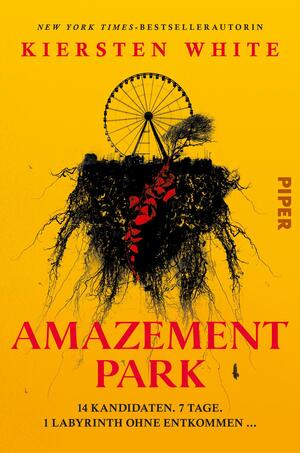



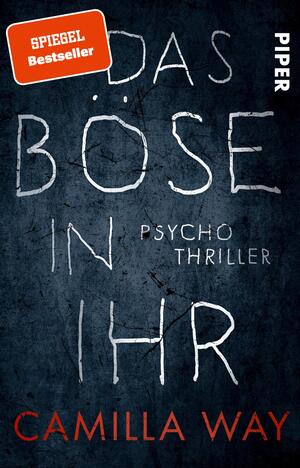
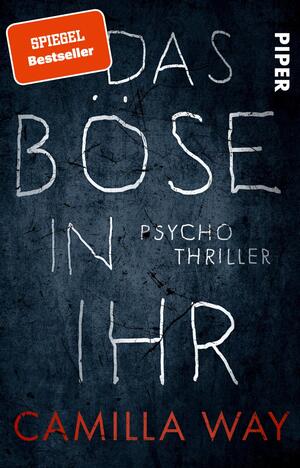




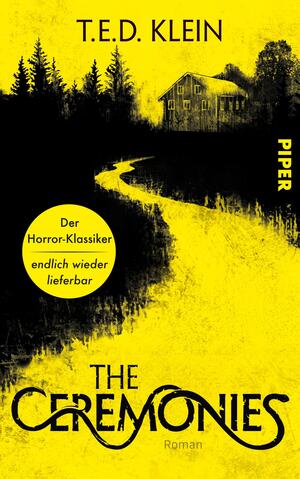




Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.