Prolog
Schwül-feuchte Luft strömt mir entgegen, als ich die Autotür öffne. Meine Kleidung klebt an der Haut, es herrschen über 30 Grad. Neugierig blicke ich mich um. Das Auto parkt unter einer großen Brücke. Um mich herum stehen weitere Pick-ups, ich erkenne vereinzelte Häuser, und zweihundert Meter entfernt befindet sich ein menschenleeres Restaurant. Ich schnappe mir meinen Rucksack und folge einem schmalen Trampelpfad in Richtung Bootssteg. Hier startet die letzte Etappe der Reise, mein Ziel: eine kleine Forschungsstation mitten im Regenwald der Insel Borneo – weit weg von der Zivilisation. Begleitet werde ich von Peter; der Malaysier ist Manager der Forschungsstation.
Ich hebe den Blick, und zum ersten Mal taucht er vor mir auf: der Kinabatangan River. Ein mächtiger schlammbrauner Fluss, der sich durch Urwälder und Schwemmebenen bis in die Sulusee windet. Er entspringt im Herzen der nebelverhangenen Regenwälder im Hochland und ist Lebensader der Provinz Sabah. Die Einheimischen nennen ihn „Sabahs Geschenk an die Erde“. Die atemberaubende Vielfalt der Tierwelt entlang dieses Gewässers ist etwas ganz Besonderes. Lediglich das gewaltige Flusssystem des Amazonas hat einen vergleichbaren Artenreichtum zu bieten.
Umrahmt von gigantischen Bäumen und sattem Grün, liegt der breite, reißende Fluss vor mir. Mein Herz schlägt schneller. Für uns Forschende ist der Kinabatangan der einzige Weg, auf dem wir in die Tiefen des Dschungels gelangen. In den Naturdokus, die ich vor meiner Abreise geschaut habe, wird das Wasser charmant als „kaffee-“ oder „bernsteinfarben“ beschrieben, und es heißt, an seinen Ufern würde das Überraschende alltäglich. Zwar ist das Wasser meiner Meinung nach schlicht schlammbraun, doch vor allem bin ich enorm gespannt auf die nächsten drei Monate im Dschungel.
Ich kann es kaum erwarten, endlich auf das Wasser zu kommen. Mit Schwimmweste um die Schultern und Rucksack auf dem Schoß sitze ich aufmerksam auf der Vorderbank des kleinen Motorboots, das Peter hinter mir steuert. Der Fahrtwind bläst mir ins Gesicht, und Urwaldbäume in allen Größen und Formen rauschen an mir vorbei. Ein herrlich frischer Duft aus Wald und Unbekanntem liegt in der Luft. Das dunkle Wasser spritzt vom Boot ab, und am Horizont türmen sich Wolkenberge auf. Wir rasen von einer Flussschlinge in die nächste.
Aufgeregt versuche ich, überall gleichzeitig hinzugucken. Über meinen Kopf fliegt ein Nashornvogel-Pärchen hinweg: große schwarze Vögel mit weißer Brust und einem mächtigen gebogenen Schnabel, auf dem ein fast ebenso großes Horn sitzt. Durch ihren hektischen Flügelschlag, der mich ein bisschen an flatternde Hühner erinnert, kann ich sie am Himmel gut identifizieren.
Eine weitere Bewegung fällt mir ins Auge: Eine Gruppe Affen erkundet das Ufer. Bestimmt fünfzehn Langschwanz-Makaken laufen leichtfüßig am Wasser entlang und suchen nach Futter. Ein Baby klammert sich am Rücken seiner Mutter fest, zwei Junge tollen über den Boden. Als sich das Motorboot nähert, schauen sie kurz auf, mustern uns kritisch und sprinten geschickt den nächsten Baumstamm hinauf. Die auslaufenden Äste des großen Baumes wippen verräterisch. Hinter jeder Flussbiegung wartet eine neue Überraschung auf mich.
Plötzlich zeigt Peter auf das Ufer rechts von uns und bremst das Boot ab: Langsam schiebt sich ein großer, schuppiger Rücken aus dem trüben Wasser. Erschrocken erkenne ich ein monströses, spitz zulaufendes Maul mit gewaltigen Zahnreihen und zwei gelbe, eng beieinanderstehende Augen. Der braunschwarze Panzer hebt sich kaum vom Ufer ab.
Mittlerweile ist das riesige Reptil ganz aus dem Wasser gekommen und schleicht bedrohlich über den schlammigen Boden, ehe es sich niederlässt. Ein Leistenkrokodil, das größte Krokodil der Welt. Begeistert präge ich mir alles genau ein.
„Leistenkrokodile können über sieben Meter lang werden mit bis zu einer Tonne Gewicht. Und sie sind zahlreich im Kinabatangan vertreten. Sehr zahlreich. Es ist das größte aller heute lebenden Reptilien“, erklärt mir der Malaysier stolz.
Andächtig mustere ich das prähistorische Raubtier. Ruhig liegt es in der Sonne und nimmt keinerlei Notiz von unserem Boot.
„Wichtigste Regel für dich: niemals im Kinabatangan schwimmen! In den angrenzenden Dörfern sind schon Menschen von Krokodilen schwer verletzt worden. Meist waren es Kinder, die am Wasser spielten“, fährt Peter fort.
Ich muss schlucken. Während der Weiterfahrt entdecke ich noch mindestens sechs weitere Krokodile am Flussufer, die meisten liegen bewegungslos in der Sonne. Manche haben ihr Maul weit geöffnet und präsentieren ihre gewaltigen Zähne.
„Wir befinden uns hier in den Tieflandschwemmebenen des Kinabatangan-Flusses!“, ruft mir Peter über das Motorengeräusch zu. „Sie gehören zu den wenigen Regionen der Erde, in denen zehn unterschiedliche Primatenarten heimisch sind. Neben den bekannten Orang-Utans, Gibbons, Makaken und Languren lebt hier einer der seltensten und einzigartigsten Affen der Welt. Gleich müssten wir an einer Gruppe vorbeikommen.“
Staunend suche ich die vorüberrauschenden Bäume ab, und dann sehe ich sie: orangefarbene Flecken mit großer, birnenförmiger Nase und dickem Kugelbauch – die Nasenaffen. Mit beeindruckenden Sprüngen bewegen sie sich in den üppigen Bäumen fort. Ein großer Affe fühlt sich von dem näher kommenden Boot gestört, streckt seinen Oberkörper nach vorne, zeigt seine Zähne und beginnt laut zu rufen. Mich erinnert das Gebrüll allerdings eher an ein bedrohliches Schnarchen.
„Nasenaffen zählen zu den seltensten Affen der Welt, nur etwa siebentausend Tiere leben in freier Wildbahn. Ihr Lebensraum schrumpft stetig“, erklärt mir der Manager.
Es ist eine große Freude, der Affengruppe beim Fressen und Toben zuzuschauen.
Die Naturdokumentationen haben nicht übertrieben: Der Kinabatangan sprüht nur so vor Leben. Ein herausragendes Beispiel dieses Artenreichtums ist der Sunda-Nebelparder. Eine sehr scheue und durch ihre ungewöhnliche Fellzeichnung exzellent getarnte Raubkatze, die nur auf Borneo vorkommt. Mein Traum ist es, diese besondere Katze während meines Forschungsaufenthaltes zu Gesicht zu bekommen.
Ein besonders liebenswertes Tier, das mir in freier Wildbahn allerdings nicht mehr begegnen wird, ist das Sumatra-Nashorn. Das kleine, vollkommen behaarte Nashorn, das hier über fünfunddreißig Millionen Jahre gelebt hat, ist nämlich seit 2015 in Sabah ausgestorben. Eine tragische Entwicklung, die mir die Fragilität dieses Ökosystems schmerzlich vor Augen führt.
Während der rasanten Flussfahrt über den Kinabatangan spüre ich ein Kribbeln in mir aufsteigen: ein aufgeregtes Glücksgefühl – auf ins Unbekannte!
TEIL I: FASZINATION WILDNIS
1. Mein Naturkundemuseum in der Schublade
Goldenes Licht flutet den Raum, die Vögel zwitschern fröhlich vor sich hin, und der Wind rauscht durch das Blätterdach. Widerwillig erwache ich aus meinem Tiefschlaf und öffne vorsichtig die Augen. Etwas enttäuscht stelle ich fest, dass ich mich gar nicht im Dschungel befinde. Das Bett ist zu weich, die Luft zu trocken und das Zwitschern zu eintönig. Da kommt der neumodische Tageslichtwecker mit Vogelfunktion an seine Grenzen. Ernüchtert blicke ich aus dem Fenster. Weder Affen noch Nashornvögel in den Bäumen, stattdessen grauer Himmel, Nieselregen und ein Linienbus, der sich durch die Straßen kämpft. Wenigstens die Kohlmeisen im Baum gegenüber lassen mich nicht im Stich. Mein Leben lang habe ich in Städten gewohnt, und trotzdem werden mir all der Beton, der laute Verkehr, die Hektik und der getaktete Lebensstil manchmal zu viel. Dann zieht es mich in die Ferne, in ein einfaches Leben aus dem Rucksack mit vier T-Shirts, Gummistiefeln, fremden Sprachen, hohen Bäumen und wilden Tieren.
Ich bin Hannah und wohne in Bonn, wenn ich nicht gerade in den Dschungeln unserer Erde arbeiten darf. Ich esse gerne Reis, mag keine Spinnen und freue mich über jede warme Dusche. Warum das so ist – und warum ich nicht eine klassische Tierärztin in der Kleintierpraxis geworden bin, sondern lieber einer vom Aussterben bedrohten Raubkatze durch den Regenwald folge –, erzähle ich in diesem Buch. Ich möchte meine Leserinnen und Leser mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise durch fremde Länder und dichte Wälder mit wilden Tieren und interessanten Begegnungen. Und vor allem möchte ich herausfinden, warum der Orang-Utan auf Borneo, der Lemur auf Madagaskar oder der Hellrote Ara in Guatemala vom Aussterben bedroht sind und was wir alle dagegen tun können.
Mit meiner Kaffeetasse in der Hand setze ich mich an den Laptop und gehe die Newsletter in meinem Posteingang durch. Schlagzeilen fluten die Kanäle:
„Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht“.
„Ein Massensterben wie bei den Dinosauriern – nur menschengemacht“.
„Artensterben so gefährlich wie der Klimawandel“.
Bestürzt lese ich mich durch die Nachrichten. 2019 veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) der Vereinten Nationen einen wichtigen Bericht über den Zustand der Biodiversität. Hundertfünfzig Fachleute aus fünfzig Ländern analysierten dafür Tausende Studien zum Thema Artenvielfalt und Ökosystemleistungen. Erstmals bezogen sie darüber hinaus auch das Wissen indigener Völker und regionaler Gemeinden mit ein.
Was bedeutet Biodiversität überhaupt? Dieser etwas sperrige Begriff beinhaltet alles, was zur Vielfalt der belebten Natur beiträgt, also eigentlich alles, was uns umgibt: unterschiedliche Arten von Tieren, Pflanzen, Moosen, Pilzen und Mikroorganismen – im Boden, in der Luft, unter Wasser oder in den Bäumen. Unter Biodiversität versteht man aber auch die Vielfalt der Lebensräume – von Wüsten bis zum Regenwald, vom Gebirge bis zum Sumpfgebiet. Oft vergessen, aber nicht weniger wichtig, ist die genetische Vielfalt. Sie beschreibt die Vielfalt an Pflanzen oder Tieren innerhalb einer Art, denn nur durch diese genetische Vielfalt können sich Arten an die sich rasant verändernden Lebensbedingungen durch Klimawandel, menschliche Einflüsse oder Krankheiten anpassen. Als Beispiel eignen sich hier die verschiedenen Apfelsorten, die in Deutschland angebaut werden. Manche sind frostresistenter als andere und können somit einem frostreichen Frühjahr trotzen, sterben nicht ab und tragen im Herbst trotzdem Früchte. Ohne Biodiversität gäbe es kein Leben auf unserem Planeten. In der Wissenschaft sprechen wir von sogenannten Ökosystemleistungen der Biodiversität, also Leistungen aus der Natur, die uns wie selbstverständlich zur Verfügung stehen: sauberes Trinkwasser, fruchtbare Böden zum Anbau von Lebensmitteln, saubere Luft zum Atmen, eine Vielfalt an Insekten, die unsere Apfelbäume bestäuben, eine Regulierung von schädigenden Krankheiten oder Wälder, die CO2 speichern. Biodiversitätsschutz bedeutet demnach nicht nur, die Schönheit der Natur zu bewahren, sondern auch die Grundlage des Überlebens für uns Menschen auf unserem Planeten zu sichern.
Leider sind die Ergebnisse des Artenschutzberichtes erschreckend: Immer mehr Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Gründe dafür sind eine intensive Nutzung der Landflächen und Meere durch Landwirtschaft, Waldrodung, direkte Ausbeutung von Wildtieren und Organismen, Überfischung oder Ozeanversauerung. Auch der Klimawandel mit seiner zunehmenden Trockenheit, den Starkregenfällen und der Erwärmung der Ozeane bringt die intakten Ökosysteme an ihre Grenzen. Hinzu kommen die Verschmutzung der Umwelt und die Verbreitung invasiver Arten , die heimische Tiere und Pflanzen verdrängen. Sogar bei unseren Nutztieren schwindet die Vielfalt. Laut Biodiversitätskonvention sollten bereits bis 2020 der Verlust der Lebensräume um die Hälfte reduziert, die Überfischung gestoppt und Schutzgebiete erweitert werden. Keines dieser Ziele wurde erreicht.
Ich bin entsetzt. Mit einer derart schlechten Bilanz habe ich nicht gerechnet. Eine Million Arten vom Aussterben bedroht – es haut mich um, so etwas zu lesen. Schließlich sind darunter auch Arten, die wir bisher nicht mal kennen. Beispielsweise der Tapanuli-Orang-Utan, der erst vor wenigen Jahren auf Sumatra entdeckt wurde und mit nur achthundert Individuen schon jetzt als die seltenste Menschenaffenart der Welt gilt. Häufig sind es sogar Arten, von denen wir noch gar nicht wissen, welche Rolle sie im Ökosystem spielen. Jeden Tag gehen dabei Informationen verloren, die für uns Menschen von großer Bedeutung sein können, zum Beispiel für die Gewinnung von Arzneimitteln und Antibiotika. Gleichzeitig verspüre ich einen starken Drang, etwas gegen das fortschreitende Artensterben zu tun.
Bedrückt klappe ich den Laptop wieder zu. Mein Kaffee ist mittlerweile kalt. Klar achte ich beim Kaffeekauf auf Bioanbau und fairen Handel, um die Kleinbauern in den Anbauregionen zu unterstützen und dem Ökosystem nicht zu schaden. Zahlreiche alltägliche Kaufentscheidungen wie diese können einen Unterschied machen, aber reicht so etwas aus, um unseren Planeten lebenswert zu halten? Ich hatte noch nie einen besonderen Hang zur Schwarzmalerei und bin froh, als ich in dem Bericht doch noch einen Hoffnungsschimmer entdecke. Auf die Frage, ob sich der Rückgang der Artenvielfalt überhaupt noch aufhalten lasse, antworten die Publizierenden mit einem klaren Ja. Aber nur, wenn auf allen Ebenen unverzüglich und konsequent gegengesteuert wird.
Ich liebe Tiere. Ob groß, klein, schuppig, süß oder gefährlich – nichts fasziniert mich so sehr wie die Tierwelt. Deswegen bin ich Tierärztin geworden. Das wollte ich schon als kleines Mädchen: „Tiereztin“ steht in krakeliger Schrift in meinem „Wilde Hühner“-Freundebuch. Was ich damals mit sieben Jahren gar nicht mochte, sind „Tierkweler“. Auch das hat sich bis heute nicht geändert.
„Du hattest immer diesen besonderen Draht zu Tieren“, erzählt mir meine Mutter, als ich sie nach den Anfängen meiner Tierliebe befrage. „Schon im Kindergarten, da warst du gerade mal fünf, bist du mit den Vorschulkindern jeden Freitag zur Jugendfarm gefahren, um Ställe auszumisten und Tiere zu füttern. Die anderen Kinder hatten Angst, den Stall des Ziegenbocks sauber zu machen, weil der so stur war. Aber Klein Hannah ließ sich davon nicht beeindrucken, stapfte schnurstracks in den Stall und stemmte sich gegen den Bock, wenn er sie beiseitedrängen wollte. Berührungsängste Tieren gegenüber waren dir völlig fremd.“
Ich bin im Rheinland aufgewachsen, in einem Haus am Stadtrand mit kleinem Garten und viel Grün drum herum. Meine Kindheit spielte sich weitgehend draußen ab, und ich hatte nie Hemmungen, mich dreckig zu machen. Als Tochter einer Biologin und eines Forstwissenschaftlers wurde ich in einem naturverbundenen Haushalt groß und kam früh mit einem umweltbewussten Lebensstil in Berührung. Das erste gemeinsame Projekt mit meiner Mutter, an das ich mich erinnere, war das Züchten von Salzkrebsen. Wir starteten öfter solche Experimente: Insektenhotels bauen, Zwiebelschalen mikroskopieren oder Spinnen aufziehen, um die Abneigung ihnen gegenüber zu verlieren. Gut, Letzteres hat bei keinem von uns so richtig geklappt. Ein Dackel gehörte ebenfalls zur Familie Emde. So lernten meine Schwester und ich schon früh, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen.
Mein Vater erzählte damals gern, dass er bei „Wetten, dass …?“ die Wette abschließen wolle, zwölf verschiedene Baumarten an ihrem Geschmack zu erkennen. Daraufhin verbrachte ich einige Tage damit, Bäume anzulecken, weil ich das auch können wollte. Außerdem hatte ich eine Vorliebe für Naturschätze. Bereits in der Grundschule begann ich damit, jeden schönen Stein, jede Feder und jeden Knochen einzusammeln, den ich im Wald fand. Meine große Schwester pflegte eine hübsche Ausstellung von Edelsteinen und Sammelfiguren in ihrer Glasvitrine. So etwas wollte ich auch haben, allerdings war mir all die Ordnung zu viel Aufwand, sodass mein „Naturkundemuseum in der Schublade“ etwas rustikaler ausfiel. Als mein großer Stolz musste es von jedem Gast des Hauses bewundert werden.
Mit der Zeit häuften sich immer mehr „Materialien“ an, die ich vorsichtig mit dem Lupenglas inspizierte und dann in der Schublade verschwinden ließ. Eines Tages begrüßten mich viele kleine Mitbewohnerinnen in meinem Kinderzimmer. Zu meiner großen Freude und dem Entsetzen meiner Eltern hatten sich Hunderte weiße Larven in dem Rehschädel in meiner Schublade eingenistet. Daraufhin bestanden die Erwachsenen darauf, dass ich ihnen jeden neuen Fund erst zeigte, bevor er dort seinen ehrenvollen Platz bekam.
Auch meine Grundschullehrerin trug zu meinem frühen Forscherdrang bei. Frau Vogel schickte uns, wann immer es möglich war, hinaus in die Natur. Sie weckte durch ihren anschaulichen und spannenden Unterricht einen Wissensdurst in mir, für den ich ihr bis heute dankbar bin.
Frau Vogel führte von Anfang an zahlreiche Projekte mit unserer Klasse durch, die nicht im Lehrplan standen, entdeckte meine Stärken und förderte mich, wo immer es ging. Dabei blieb mir am meisten unser Schneckenprojekt im Gedächtnis: Jeder Gruppentisch bekam ein Terrarium mit Weichtieren. Wir richteten ihnen das Zuhause naturnah ein, teilten uns die Fütterungszeiten ordentlich auf, gaben unseren Schnecken Namen, erforschten und studierten sie. Das hatte zur Folge, dass ich ein großer Schneckenfan wurde. Stundenlang konnte ich hinter unserem Haus neben den Büschen hocken und Schnecken beobachten. Andere spielten mit Barbies oder Gameboys, ich veranstaltete Schneckenrennen, sammelte Futter und pflegte die schleimigen Tierchen. Einmal nahm ich eine Schnecke mit in mein Kinderzimmer, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich muss ungefähr sieben Jahre alt gewesen sein. Als ich mich nach dem Abendessen wieder zu ihr gesellen wollte, war sie nicht mehr aufzufinden. Erst erzählte ich niemandem von meinem schmerzlichen Verlust, bis meine Eltern einige Wochen später fast verzweifelten. Es stank ziemlich übel in meinem Zimmer, doch keiner konnte sich die Ursache erklären. Mein Vater montierte die halbe Holzvertäfelung ab, da er dahinter eine tote Maus vermutete, doch der penetrante Verwesungsgeruch blieb unaufgeklärt. Sogar Dackel Lotta kam als Spürhund zum Einsatz. Da nahm mich meine Mutter zur Seite: „Hannah, war hier irgendein Tier in deinem Zimmer? Sei ehrlich, ich schimpfe auch nicht.“
Betreten gab ich zu: „Mhhm … na ja … ich hatte eine Schnecke in der Hosentasche. Dann gab es Abendbrot, und ich habe sie hier so lange auf den Tisch gelegt. Und als ich wiederkam, war sie nicht mehr da.“
Jetzt wussten sie zumindest, wonach sie suchten, aber es dauerte trotzdem noch einige Tage, bis sie einen dunklen, streng riechenden, festgetretenen Fleck an einer Kante des Teppichs fanden. Danach durfte ich keine lebendigen Tiere mehr mit in mein Zimmer nehmen. Und hatte nie wieder einen Teppich.
Meine Mutter erzählt heute noch lachend: „Mir war klar, dass das bei dir nie die ›Pferdenummer‹ werden würde. Du hast auf dem Reiterhof schon immer lieber mit den Tieren gearbeitet, als sie zu striegeln oder ihnen Flechtfrisuren zu zaubern. Du wolltest nicht Tierärztin werden, weil du so gerne Tiere streichelst, sondern weil du sie erforschen wolltest.“
Meine ersten wichtigen Naturmomente erlebte ich in Schweden. Seit ich klein bin, fahre ich dorthin, damals häufig mit Familie und VW-Bus in den Sommerferien, später dann mit den Pfadfindern oder Freundinnen. Wildes Zelten, Blaubeeren pflücken, Pfannkuchen über dem Feuer. In klaren, kalten Seen schwimmen und mich anschließend auf den warmen Felsen wieder aufwärmen. Klar kenne ich die Geschichten von Astrid Lindgren, und Ronja Räubertochter bleibt eine große Heldin.
Ich schwärme für warme Zimtschnecken und rostrote Schwedenhäuschen, aber vor allem liebe ich diese raue skandinavische Natur: Nadelwälder, so weit das Auge reicht, moosbewachsene Felsen, einsame Inseln und die kurzen Sommer. Besonders eindrücklich blieben mir die langen Kanutouren. Im Nachhinein bewundere ich den Mut meiner Eltern. Für zehn Tage mit zwei Kanus, zwei Kindern, zwei Zelten und einem Dackel auf dem Wasser unterwegs zu sein ist wahrlich eine Herausforderung. Auf diese Weise lernte ich schon als Kind, meine Sinne zu schärfen und sorgsam mit meiner Umwelt umzugehen.
Meine erste lange Station im Ausland war ein Jahr in den USA. Zwei Tage nach meinem sechzehnten Geburtstag flog ich nach Pennsylvania. Ich lebte bei einer Gastfamilie in einer Kleinstadt, besuchte die Highschool und spielte in der Drumline (Schlagzeuggruppe) einer Marching Band. Schnell erfuhr ich kulturelle Unterschiede. Mit meiner Mülltrennung und dem Stromsparen wurde ich zur Exotin. Zu dem Fast-Food-Restaurant auf der anderen Straßenseite fuhr die Familie mit dem Auto. Und für den Black Friday standen wir bereits um fünf Uhr morgens in der Warteschlange der Shopping Mall.
Ich erlebte die Konfrontation mit dem amerikanischen Lebensstil als eine Herausforderung und Bereicherung zugleich. Losgelöst aus meinem bisherigen Wertesystem lernte ich, die Dinge infrage zu stellen, bewusster durch die Welt zu gehen und meinen eigenen Standpunkt zu finden. Sogar unsere Politik und unser Gesundheitssystem wusste ich plötzlich anders zu schätzen. Und vor allem lernte ich dort Folgendes: Anpassung, Kommunikation, Heimweh überwinden, neue Freunde finden und Englisch.
Zurück in Deutschland plante ich mit meiner Pfadfindergruppe ein Projekt für ein Waisenhaus in Südafrika. Für die Finanzierung sammelten wir ein Jahr lang Spenden, verkauften selbst gebackene Plätzchen, putzten Fenster, arbeiteten als Kinderbetreuer und veranstalteten Flohmärkte: zehn Jugendliche und zwei Gruppenleiter aus unterschiedlichen Lebenssituationen (Schule, Zivildienst, Ausbildung, Studium, Arbeit, frischgebackener Vater) mit einem gemeinsamen Ziel.
Unsere Reise beginnt in der Hauptstadt Johannesburg. Ich bin mittlerweile fast achtzehn, die Jüngste der Gruppe, und freue mich, dieses fremde Land besser kennenzulernen. Wenige Wochen zuvor fand die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika statt, und Shakiras Worte „Waka waka … ’cause this is Africa!“ begleiten uns die gesamte Reise. Für die ersten Tage in Johannesburg kommen wir in den Gastfamilien südafrikanischer Scouts unter. Anfangs wirken die riesigen Mauern mit Stacheldraht und Elektrozaun noch etwas einschüchternd, aber unsere südafrikanischen Freundinnen und Freunde machen uns das Wohlfühlen leicht. Schnell wird mir deutlich, dass wir uns in den reicheren Teilen der Stadt aufhalten.
Wir besuchen das Apartheid-Museum, steigen in eine Goldmine und lernen viel über die Geschichte des Landes. Anschließend geht es für unsere Gruppe mit zwei Kleinbussen Richtung Süden. Die Landschaft wird immer grüner, die Straßen werden immer wilder, und wir lernen auch die ärmeren Gegenden des Landes kennen: In einem Lager aus Wellblechhütten leben illegale Einwanderer dicht beieinander. Sanitäre Anlagen und sauberes Trinkwasser gibt es nicht.
In der Nähe von Mbombela beginnen wir mit unserem Projekt im AIDS-Waisenhaus Siyakhula. Als wir über die staubigen Straßen der Townships fahren, ist uns noch etwas mulmig zumute, denn wir wissen nicht, was uns erwarten wird. Doch sobald wir im Waisenhaus ankommen, werden wir von so vielen aufgeregten Kindern empfangen, dass es einfach nur schön ist. Wie froh die Kinder sind, viel Aufmerksamkeit und Abwechslung zu bekommen. Wir erfahren Neugierde und pure Lebensfreude. Gerade bei dem Fußballspiel „Deutschland gegen Südafrika“ mit dem zerfledderten Ball auf staubigem Boden blühen wir alle auf.
Unsere Unsicherheit weicht fünf sehr bewegenden und anstrengenden Tagen. Wir streichen ein Haus, erneuern Fußböden, bauen einen Gartenzaun und einen Kompostkasten. Außerdem kaufen wir von dem Geld, das wir in Deutschland verdient haben, einige Utensilien für das Waisenhaus ein. Am letzten Tag des Siyakhula-Projektes treffen wir abends auf die südafrikanischen Scouts, bei denen wir für die nächsten Nächte unterkommen sollen. Wir werden euphorisch mit Gesang, Tanz, Lagerfeuer und Gebäck von den Jugendlichen begrüßt. Das Leben bei den Gastfamilien im Township ist das krasse Gegenstück zu dem Leben der reichen weißen Gastfamilien, bei denen wir in Johannesburg wohnten: Fließendes Wasser für ein paar Stunden und ein eigenes Zimmer hat hier kaum einer. Aber das ist überhaupt nicht mehr wichtig, denn die Gastfreundschaft ist überwältigend.
Als Nächstes steht ein Zeltlager mit zweihundert afrikanischen Scouts auf unserem Programm. Wir hatten dieses Camp schon in den Gruppenstunden in Deutschland vorbereitet und uns ein passendes Programm für die Sieben- bis Zehnjährigen überlegt. Zum Glück kommen unsere Spiele, Stationen und Morgenrunden gut an, und wir genießen die Tage mit den Kindern.
Mein abschließendes Highlight dieser Reise ist der Kruger Nationalpark. Wir zelten mit Affen und bunten Vögeln und werden nachts von Löwengebrüll geweckt. Ein Traum geht für mich in Erfüllung, als wir in einem Safaribus sitzen und nach wilden Tieren Ausschau halten: Ein riesiger Elefant überquert vor uns die Schotterpiste, Zebras stehen zwischen den Bäumen, und Schwarzfersenantilopen springen durch die Savanne. Durch mein Fernglas entdecke ich eine Gruppe Löwen, die im Schatten eines Baumes döst. Der Kopf einer Giraffe taucht plötzlich zwischen den Baumkronen am Straßenrand auf. Wie in Zeitlupe rennt sie über das goldgelbe Gras. Am Flussufer tummeln sich die Flusspferde.
Augenblicke, die ich tief in mein Herz geschlossen habe. Und die ich heute noch abrufen kann, als Beginn meiner Liebe für das wilde Leben auf unserem Planeten.
2. Über Grenzen gehen – auf die Philippinen
Bonn. Ich habe gerade mein Abitur abgeschlossen, da stecke ich schon in den Vorbereitungen für mein erstes eigenes internationales Abenteuer: zwölf Monate Freiwilligendienst auf den Philippinen. Nach der Schule erst einmal etwas ganz anderes machen, bevor es mit dem Studium weitergeht – das schwebte mir seit Langem vor. Ich recherchiere stundenlang nach Organisationen und Projekten im In- und Ausland, die etwas mit meinen Interessen zu tun haben: eine Seehundschutzstation an der Nordsee, oder ab zur Schutzstation Wattenmeer?
Letztendlich stoße ich auf einer Berufsmesse in Köln zufällig auf den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums, weltwärts. Da ich für ein Auslandsjahr auf finanzielle Unterstützung angewiesen bin, bewerbe ich mich bei den zuständigen Organisationen, durchlaufe Bewerbungsrunden und bekomme tatsächlich einen Platz bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – für mich geht ein Traum in Erfüllung.
Die Einrichtung für Entwicklungszusammenarbeit ist eine große Organisation, die überall auf der Welt tätig ist. Ich bin froh, dass die GIZ mich mit meinen achtzehn Jahren gut auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet: Es gibt Medical Check-ups und Informationsveranstaltungen, Visa und Flüge werden für mich gebucht, und ich nehme an einem fünftägigen Vorbereitungsseminar teil, das mich für die Arbeit im Ausland sensibilisiert und nachhaltig prägt.
Sätze wie „It’s not right, it’s not wrong, it’s just different!“ klingen mir heute noch bei Auslandsaufenthalten im Ohr, und ich versuche, Probleme ohne meine „kulturelle Brille“ zu beurteilen. Als ich damals mit den anderen Freiwilligen in den Flieger Richtung Südostasien stieg, hätte ich nie gedacht, dass mich diese zwölf Monate so anhaltend verändern würden. Neben tropischem Klima, fremden Lebensmitteln, Ilonggo (der Ortssprache) und Selbstständigkeit lernte ich vor allem eins kennen: ein Zuhausegefühl am anderen Ende der Welt.
Insel Negros. Die Philippinen sind ein schönes und vielfältiges Land. Nicht ohne Grund zählen ihre siebentausend Inseln zu den fünfunddreißig Biodiversitäts-Hotspots der Welt. Es existiert dort eine sehr hohe Anzahl einheimischer Arten. Gleichzeitig ist ihr Lebensraum aber einer starken Gefährdung ausgesetzt. Für mich ist es das erste Mal in den Tropen, und ich genieße es, in das Leben auf den Visayas einzutauchen. Diese Inselgruppe liegt im Zentrum der Philippinen und überrascht mich mit ihren traumhaften Sandstränden, dem Regenwald, den Wasserfällen und Vulkanen.
Für mein Freiwilligenjahr wohne und arbeite ich auf der Insel Negros in Bacolod City, von der die friedliche Natur nur eine kurze Fahrt mit dem Tricycle entfernt ist. Die alten Motordreiräder sind das Hauptverkehrsmittel auf den Philippinen. Sie bestehen aus einem Motorrad mit Beiwagen, auf dem sechs Leute plus Fahrer Platz haben. So dachte ich zumindest am Anfang, denn letztendlich sind wir meistens zu elft auf dem klapprigen Gefährt unterwegs. Das Leben findet auf den Straßen statt. Das kennt man aus vielen südlichen Ländern, aber auf den Inseln scheint diese Lebensweise besonders ausgeprägt. Die Wohnungen sind quasi zur Straße hin offen. Die Sari-Sari-Stores, kleine Lädchen am Straßenrand, in denen alles von Chips über Eier bis hin zur einzelnen Zigarette verkauft wird, sind halb Wohnzimmer, halb Kiosk. Eine Familie sitzt selten in ihrem Haus (ein Raum ist meist Schlaf-, Wohn- und Esszimmer zugleich), sondern unterhält sich angeregt mit ihren Nachbarn auf der Straße. Fußnägel werden lackiert, oder es wird mit den Bekannten von gegenüber über das nicht anspringende Motorrad gefachsimpelt. Kinder jeden Alters sind überall mit dabei.
In genau solch einer Nachbarschaft wohne ich zusammen mit zwei weiteren Freiwilligen aus Deutschland. Wir wurden von den Filipinos herzlich empfangen und rasch gut integriert. Teilweise etwas zu gut: Erst nachdem ich mich einige Monate über die extrem hohen Stromrechnungen wundere, komme ich mit meinen Mitbewohnern auf die Idee, unseren Stromkasten zu inspizieren. Mit der Zeit haben sich immer mehr Nachbarn unseren Strom abgeklemmt – reicht wohl, wenn einer zahlt? An den Kabelsalat entlang der Straßen hat sich eh jeder gewöhnt, der gehört zum Stadtbild. Und als mir zum dritten Mal die Schuhe von der Veranda geklaut werden, beschließe ich, sie nur noch im Haus zu lagern. Alles letztlich nur Kleinigkeiten.
Ein Stück die Straße hoch befindet sich eine winzige Eatery mit Plastikstühlen, eine Art Imbiss, in dem sich die Berufstätigen zur Mittagszeit angeregt unterhalten. In einer Glasvitrine stehen fünf Gerichte, die von den Frauen am Morgen gekocht wurden. Jeder bedient sich selbst aus den dampfenden Töpfen: etwas Gemüse, Hühnchen, dazu natürlich Reis.
Wenn ich aus dem Haus gehe, werde ich von den Filipinos mit einladendem Lachen und einem begeisterten „Good Morning, Mam! How are you, Mam?“ begrüßt. Jeden Morgen nehme ich den Jeepney zur Arbeit, ein altes, klappriges, bunt geschmücktes Militärfahrzeug ohne Fensterscheiben, umfunktioniert zum Linienbus. Das Ticketgeld, sieben Philippinische Peso, gebe ich einfach nach vorne zum Fahrer weiter und rufe gedehnt „Bayaaad!“, um kundzutun, dass ich zahlen möchte. Und wenn ich aussteigen will, klopfe ich gegen das Blechdach und rufe „Lugar lang! Anhalten!“. Bushaltestellen gibt es nämlich nicht. Auf den Straßen herrscht reges Treiben. Verkehrsregeln werden nur äußerst ungern befolgt. Wer laut genug hupt, gewinnt, und wer die nächste Lücke findet, darf fahren. Es ist ein Chaos, doch ein gewisser Verkehrsfluss herrscht trotzdem. Das Beeindruckende dabei: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirken tatsächlich sehr entspannt.
Ich bin gerade neunzehn geworden und arbeite für meinen Freiwilligendienst an der West Negros University in Bacolod City an einem Umweltbildungsprojekt. Dort unterstütze ich eine Stiftung, die sich zum Ziel setzt, endemische Arten, also Tiere, die nur auf den Philippinen vorkommen, zu erhalten und die Wälder vor Ort zu schützen – die Negros Forests and Ecological Foundation. Denn auf den Philippinen stellen der Raubbau an Ressourcen durch zum Beispiel Dynamitfischerei und Bergbau sowie die Abholzung der Wälder aufgrund von Palmöl- und Zuckerrohrplantagen große Probleme dar. Die Monokulturen verdrängen die Diversität der Regenwälder, und den Tieren wird der Lebensraum genommen. Außerdem ist und bleibt Korruption weitverbreitet. Die Oberschicht besteht aus einigen reichen und alteingesessenen Familien, die viel Macht ausüben. In den Firmen der fünfzehn reichsten Familien des Landes wird über die Hälfte des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. Nicht nur materieller Reichtum, sondern auch politische Positionen werden von Generation zu Generation weitergereicht.
Ein wichtiger Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf den Inseln ist, neben der Armutsbekämpfung, die Umweltbildung: Welche Tier- und Pflanzenarten leben im eigenen Land, und warum hängt das eigene Wohlergehen davon ab, sie zu schützen? Der kleine Zoo der Foundation kann dazu beitragen, indem er über den Reichtum des eigenen Landes an Natur und endemischer Artenvielfalt aufklärt und für einen umweltbewussten Lebensstandard sensibilisiert. Trotzdem wird mir in diesem Jahr deutlich, wie schwer es ist, in einem Land für den Umweltschutz zu arbeiten, in dem die Menschen in vielen Regionen selbst noch um das Überleben kämpfen und auf Jobs auf den Plantagen angewiesen sind, um ihre Familien zu ernähren.
Armut ist in meinem Leben auf den Philippinen jeden Tag präsent ist. Trotzdem habe ich selten so ein herzliches, freundliches und gut gelauntes Volk wie die Filipinos kennengelernt. Es ist beeindruckend, woher die Menschen ihre Lebensfreude und Kraft schöpfen. Hier zählen andere Werte zum persönlichen Glück als in Europa: Familie und Zusammenhalt stehen an oberster Stelle, und auch der Glaube ist den Filipinos sehr wichtig.
Was ich in diesem Jahr besonders lieben lerne, ist die Entdeckung der Langsamkeit. Hier existiert ein anderes Tempo: Das beginnt im Straßenverkehr, in dem man nie schneller als dreißig Stundenkilometer fahren kann. Oder die fast schon heiligen Mittags- und Kaffeepausen. Als Deutsche fällt es mir anfangs schwer, mich alldem anzupassen, schließlich bekommt man so doch kaum Arbeit geschafft? Aber nach einiger Zeit kann ich mich dieser Entschleunigung hingeben und vermisse sie seither im gehetzten Deutschland immer wieder.
Tan-Awan. Neben den Umweltprojekten führe ich an der West Negros University im Rahmen meines Freiwilligendienstes auch ein Forschungsprojekt mit einem mehrköpfigen Team aus Professorinnen, Professoren und Studierenden durch. Dafür untersuchen und dokumentieren wir die Kultur und Traditionen einer indigenen Gemeinschaft. Das Dorf Tan-Awan liegt verborgen in den Bergen am Ilog-Hilabangan, dem längsten Fluss der Insel Negros, und ist etwa acht Stunden von Bacolod City entfernt. Die siebentausenddreihundert Einheimischen in Tan-Awan leben noch relativ abgeschottet vom modernen westlichen Einfluss. Obwohl die Indigenen zum größeren Volk der Bukidnon gehören, sind einige ihrer kulturellen Bräuche einzigartig. Viele Indigene leben noch heute weit entfernt im Hinterland und betreiben dort Ackerbau. Das durchschnittliche Familieneinkommen in der Region liegt bei zweitausend Philippinischen Peso pro Monat, das sind circa 37,50 Euro. Ziel unserer Forschung ist es, kulturelle Praktiken wie Sprache, Kunst, Medizin und Essenszubereitung des Dorfes Tan-Awan kennenzulernen. Denn auch in diesen ländlichen Gebieten werden westliche Werbung, moderne Kommunikation und Technologie immer präsenter, und das Bewusstsein der Bevölkerung über ihre eigene Kultur nimmt ab. Es ziehen jedes Jahr mehr Bewohner in die umliegenden Städte und lassen ihre Heimat mitsamt den Traditionen und dem Wissen zurück.
Im Rahmen des Projektes lebe ich mit dem Forschungsteam für mehrere Wochen mit der indigenen Gemeinschaft zusammen. Wir nehmen Anteil an den täglichen Routinen der Dorfbewohnerinnen, führen mithilfe von Übersetzern Interviews mit den Stammesältesten und Medizinmännern und verfolgen den wöchentlichen Tauschhandel am Fluss, den sogenannten Barter Trade. Dieser Handel findet in Tan-Awan traditionell jeden Freitag an den Ufern des Ilog-Hilabangan statt. Er ist die Wasserquelle für viele Tausend Menschen in der Provinz und ein wichtiger Transportweg. Das Flussufer wird zum Ort des Handels von landwirtschaftlichen Produkten und ist für viele der einzige Weg, an Lebensmittel und Güter zu kommen.
Eines frühen Morgens im Dorf lehne ich über einer kleinen Wanne und wasche mich. Nachdem ich mir das eiskalte Wasser mit einer Schöpfkelle über den Kopf geschüttet habe, bin ich hellwach. Gleich brechen wir zum Flussufer auf. Es ist erst kurz nach vier, und ich habe auf dem harten Steinboden nicht besonders viel schlafen können – an das rustikale Leben muss ich mich noch gewöhnen. Ich teile mir das kleine Zimmer mit Lilibeth, einer philippinischen Professorin. Im Gegensatz zu mir scheint sie, ihrem Schnarchen nach zu urteilen, sehr gut genächtigt zu haben.
Nach einem fünfzehnminütigen Fußmarsch erreichen Lilibeth und ich das Flussufer. In völliger Dunkelheit werden schon die ersten Stände aufgebaut. Schweigend stehe ich am Rand und folge dem Geschehen. Langsam fällt Sonnenlicht auf die Bergspitzen, und die ersten Frauen, Männer und Kinder überqueren den Fluss. Manche kommen zu Fuß, ihre Ware auf dem Kopf balancierend, manche reiten auf Ponys, voll bepackt mit Säcken und Körben, andere doch tatsächlich auf ihrem Carabao (Wasserbüffel). Sie alle haben einen langen Weg aus den Bergen hinter sich. Sogar viele Kinder bringen auf ihrem Weg zur Schule Waren am Ufer vorbei. Staunend beobachte ich das mir so fremde Bild. Ich schieße Fotos und lausche den Fragen, die Lilibeth den Händlern stellt.
„Die meisten Kinder fangen im Alter von zehn Jahren an zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen“, erklärt ein junger Mann mit Kappe und rotem Shirt, der gerade Reissäcke von seinem Tricycle lädt. „Während der Aussaat und Erntesaison bekommen die Kinder regelmäßig Schwierigkeiten mit der Schule im Dorf. Die Arbeit auf den Feldern ist intensiv und zeitaufwendig, daher ist es für sie eine Herausforderung, sich auf schulische Aktivitäten zu konzentrieren.“ Er tätschelt seiner kleinen Tochter liebevoll den Kopf.
Ich entdecke zwei junge Mädchen, die Arm in Arm das Ufer entlanglaufen. Vielleicht sind es Schwestern, denke ich mir, in ihren weißen und rosa Kleidern sehen sie hübsch zurechtgemacht aus. Im Kontrast dazu laufen sie in Flip-Flops über das schlammige Ufer. Was mir nie wieder aus dem Kopf geht, ist ihr eindringlicher Blick. Ich habe das Gefühl, nicht in Kindergesichter zu schauen, sondern in Gesichter, die schon sehr viel erlebt und gesehen haben. Vielleicht zu viel für ihr Alter: in Gesichter, die früh erwachsen werden, Verantwortung für ihre Familie mitübernehmen und harte körperliche Arbeit leisten mussten. An diesem Morgen wird mir wieder bewusst, wie privilegiert und behütet ich doch aufgewachsen bin.
Lilibeth und ich sprechen mit einem Mann, der auf seinem Wasserbüffel über den Fluss geritten kommt. Der muskulöse Büffel mit seinen gewaltigen Hörnern zieht einen selbst gebauten Karren aus einfachen Holzstämmen hinter sich her. Der junge Mann hat sich ein schwarzes Tuch um den Kopf gewickelt, auf seiner linken Schulter prangt ein blasses Tattoo, und um seine Hüfte trägt er ein dünnes Seil, an dem seine Machete befestigt ist. Er erklärt uns: „Da das Vieh einen wesentlichen Teil des täglichen Überlebens unserer Familien ausmacht, kümmern wir Landwirte uns intensiv um unsere Tiere. Mein Wasserbüffel ist mein wertvollster Besitz. Er bekommt mehr zu essen als ich, und wenn es ihm nicht gut geht, behandele ich ihn mit Medikamenten und Vitaminen.“
Bald erscheint das erste Balsa hinter der Flussbiegung. Es handelt sich um ein selbst gebautes Bambusfloß, das mit natürlichen Materialien zusammengehalten wird. Diese traditionelle Art des Warentransports gilt als wichtiger kultureller Teil der Identität von Tan-Awan. Es ist kaum zu glauben, dass die Menschen jeden Freitag auf den wackeligen Flößen die gefährlichen Stromschnellen des Flusses aus den Bergen hinunter bis zum Dorf Tan-Awan kommen, um dort ihre Produkte mit den Käufern aus der Umgebung zu tauschen. Immer mehr Balsas legen am Flussufer an. Neben den hiesigen Nutzpflanzen wie Süßkartoffeln, Reis, Obst und Gemüse erkenne ich auch vereinzelt Hühner, Schweine und Ziegen auf den schwankenden Gefährten.
Die Sonne ist mittlerweile ganz aufgegangen und taucht das Geschehen in goldenes Licht. Die Pferde mit den Holzsatteln grasen am Flussufer, ein Hahn plustert sich zwischen den Bananenstauden auf, und Kinder flitzen zwischen den Karren umher.
Ein Feld etwas abseits des Ufers wurde zum Marktplatz umfunktioniert, und es herrscht bereits reges Treiben, als wir ihn betreten. An einzelnen Ständen wird Native Coffee angeboten – und Sticky Rice, ein köstlich-klebriger, mit Zuckerrohr gesüßter Reis, der in Bananenblättern verpackt ist. Ein sehr alter Mann, anscheinend der Medizinmann des Dorfes, wird von Lilibeth zum Barter Trading befragt.
„Seit ich alt genug war, um die Dinge zu verstehen, war der Tauschhandel in Tan-Awan bereits eine Tradition, die zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden ist. Es treffen sich Markthändler, Käufer und Bauern, um Produkte zu tauschen. Dazu gesellen sich Händler aus dem Tiefland mit ihren urbanen Gütern. Diese wirtschaftliche Aktivität macht den Markttag lebendig und spannend. Und: Die Kakofonie des Feilschens begeistert die Bewohner heute noch.“
Er hat recht. Ich tauche in einen lauten Wirrwarr aus Stimmen und Marktgeschrei ein. Die Händler überbieten sich gegenseitig, und das Angebot ist riesig: Neben dem lokalen Obst und Gemüse entdecke ich getrockneten Fisch, Kleidung, Schrauben, Seife, selbst geschnitzte Holzinstrumente und Medikamente. Früher wurden die Güter nur getauscht, doch heute ist der Einsatz von Geld auch hier üblicher.
Ein fröhlicher Mann mit blau-weiß karierter Baseballcap hält mir begeistert seinen Einkauf vor die Kamera und erzählt: „Unsere Vorfahren übten den Barter Trade aus und tauschten Ware gegen Ware. Doch aufgrund der zunehmenden Alphabetisierung und Bildung unserer Stammesmitglieder und des zunehmenden Einflusses der nahe gelegenen Städte ist Geld mittlerweile das wichtigste Tauschmittel geworden. In der Vergangenheit wurden die Waren nicht nach ihrem Preis verkauft, sondern jeder tauschte lediglich gegen eben die Waren, die er gerade benötigte.“
Am Rande des Marktes sind kleine Eaterys aufgebaut, an denen die Dorfbewohnerinnen Essen anbieten: Reis, Chicken Adobo (ein traditioneller Hühnereintopf), scharfes Gemüse und Kokoswein. Dazu wird lauthals Karaoke gesungen, was bis zum Fluss hinunterschallt. Vor Mittag kehren die Balsa-Händler zu Fuß oder auf ihren Lastzügen in die Berge zurück, beladen mit den Produkten, die sie gekauft oder eingetauscht haben. Die Balsa-Aktivitäten bestehen seit Jahrhunderten, und die Menschen aus den Bergen brachten nicht nur ihre Waren, sondern auch ihre Kultur und Traditionen mit. Umgekehrt trugen sie bei ihrer Rückkehr die Kultur des Tieflandes mit sich in ihre Heimatdörfer. Dieser dynamische Kulturzyklus dauert bis heute an.
Zur Feier des Barter Trade findet einmal im Jahr das Balsahanay Festival statt. Zu diesem Anlass kommen alle Bewohner der umliegenden Dörfer und aus den Bergen nach Tan-Awan. Die Festlichkeiten gehen über drei Tage. Es beginnt freitags mit dem wöchentlichen Markt, viele Reden werden gehalten, und abends gibt es einen Schönheitswettbewerb für die jungen Mädchen, bei dem die „Miss Tan-Awan“ gewählt wird. Am Samstag finden Spiele und Wettkämpfe für alle Altersklassen statt. Ich nehme zum Beispiel an einem Kochwettbewerb mit den Frauen des Dorfes teil. Dafür sollen lokale Gerichte gekocht und in Szene gesetzt werden, die von einer Jury der Uni bewertet werden. Es macht großen Spaß, zusammen mit den Bewohnerinnen über dem Feuer zu kochen, Besol (Jamswurzel) auszuhöhlen oder die Cassava (Maniok) zu raspeln. Die Frauen geben sich viel Mühe und zaubern sagenhafte Kuchen, Reisgerichte, Suppen und Salate, die sie der Jury in Bananenblättern, Kokosnüssen und selbst gefertigten Behältern vorsetzen. Ich darf die Rezepte dokumentieren und werde in sämtliche Zutaten und Gerichte eingeweiht.
Am Sonntag gibt es zum krönenden Abschluss eine feierliche Zeremonie am Flussufer mit Musik und Tänzen. Viele Familien kommen auf ihren festlich geschmückten Balsas den Fluss entlang. Anschließend zieht eine Prozession zu der Kirche des Dorfes, und es wird gemeinsam ein Gottesdienst gefeiert. Am Nachmittag findet eine Parade durch die Straßen statt, die bis auf den großen öffentlichen Platz führt. Dort ist eine Musikanlage aufgebaut, zu deren Klängen die Schulkinder von Tan-Awan ihre Tänze präsentieren. Mit farbenprächtigen, selbst gestalteten traditionellen Kostümen stellen die Kinder den Tauschhandel am Flussufer dar. Im Tanz säen sie, ernten, beladen ihre Flöße und tauschen mit Händlern. Am Abend werden „Prince and Princess of Balsahanay Festival“ gekrönt – ein spektakuläres Fest und einmaliges Erlebnis.
Banaue. Mein treuster Begleiter in diesem Auslandsjahr ist der Reis (Oryza sativa Linnaeus). Die Reispflanze ist das wichtigste Getreide und Lebensmittel Asiens, sie sättigt, ist ertragreich und gut an die klimatischen Bedingungen angepasst. Ich esse hier dreimal täglich Reis, was mir erstaunlicherweise überhaupt nichts ausmacht. Ich werde nie vergessen, wie meine philippinische Freundin Ritzy bei einem Abendbrot in Deutschland ungläubig den Tisch beäugte und mich verwundert fragte: „Und wo ist der Reis?“
Sogar zu Spaghetti oder Kartoffeln wird hier selbstverständlich Reis serviert. Der philippinische Ausdruck für „Essen“ ist gleichzeitig Synonym für „Reis essen“ (Kanin). Das führt dazu, dass ausschließlich mit Löffel und Gabel gegessen wird. Oder auch gern einfach mit den Händen. Ein Messer gehört zu den Utensilien, die kaum jemand braucht und die in diesem südostasiatischen Land schwer zu kriegen sind.
Im Norden der Philippinen besuche ich die Hochebenen von Luzon mit ihren immens großen und beeindruckenden Reisterrassen. Von den Stämmen der Ifugao, den Indigenen dieser Bergregionen, jahrhundertelang in Handarbeit erbaut und mit eigenem Bewässerungssystem ausgestattet, erstrecken sich die Felder über Täler und Berge. Stolz nennen die Einheimischen sie die „Stufen zum Himmel“.
Die Reisproduktion ist ein aufwendiger Prozess, der mehrere Monate präziser, sorgfältiger Arbeit erfordert. Als ich die Einheimischen beeindruckt frage, ob die Reisbauern hier an ihren Feldern gut verdienen, schütteln sie energisch die Köpfe. Es könne nur zweimal im Jahr gesät werden. Und die Ernte reiche kaum für den Eigenbedarf aus. Auf die Frage, ob ich denn hier im Dorf den heimischen Reis essen könne, folgt ein erneutes Kopfschütteln: „In unseren Restaurants oder auf den Märkten gibt es nur noch den kommerziellen Reis zu kaufen. Alles andere wäre viel zu teuer.“
Schon komisch, da bin ich umgeben von Reisfeldern, ernähre mich fast ausschließlich von dem Getreide und komme trotzdem nicht in den Genuss, den regionalen Reis zu probieren. Das extreme Wachstum der Weltbevölkerung im 20. Jahrhundert führte auch auf den Philippinen zu einer nahezu ausschließlich kommerziellen Reisproduktion mithilfe von moderner Wissenschaft und Technik. Konsequenzen sind die sinkende Bedeutung kultureller Werte sowie ein sinkender Glaube an Reis, Ackerbau und Landwirtschaft. Ein Phänomen, das sich bis in diese abgeschiedenen ländlichen Bergregionen auswirkt.
Ich finde es interessant, Reis und die Reis-Landwirtschaft in Kontext mit Biodiversität und dem Klimawandel zu setzen: Nur noch zwei von ursprünglich über zwanzig verschiedenen Oryza-Arten werden heute kommerziell angebaut. Der Verlust der genetischen Vielfalt innerhalb der Reissorten ist ein großes Problem. Diese Vielfalt könnte nämlich zu einer Anpassung an die sich doch extrem verändernde Umwelt beitragen. Ohne diese Vielfalt führen plötzliche Wechsel von Trocken- und Regenzeit, extreme Wetterbedingungen sowie Pflanzenschädlinge oder Pilze zu verringerten Erträgen. Dieses Phänomen findet leider weltweit statt: Seit Beginn der Landwirtschaft wurden circa siebentausend Pflanzenarten von Menschen angebaut. Heute nutzen wir gerade einmal dreißig dieser Arten, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Knapp 60 Prozent der Energie, die wir aufnehmen, stammen sogar von nur drei unterschiedlichen Pflanzenarten – Reis, Weizen und Mais.
Im Ökolandbau wird darauf geachtet, landwirtschaftlich nutzbare, aber bedrohte Sorten und Rassen zu erhalten und gefährdete Pflanzenarten wieder anzubauen. Durch den Kauf und die Verarbeitung von ökologischen und regionalen Nahrungsmitteln lässt sich also auch gegen den Verlust der genetischen Vielfalt handeln. Darauf möchte ich in Zukunft beim Einkaufen von Brot-, Getreide- oder Apfelsorten achten.
Während meiner zwölf Monate auf den Philippinen komme ich häufig an meine Grenzen: Sei es, dass ich ausgeraubt werde, weil meine Hautfarbe Reichtum suggeriert. Dass ich wegen einer Motorpanne stundenlang auf einsamen Straßen auf den Ersatzbus warten muss. Sei es ein frustrierendes Arbeitsprojekt, bei dem es aufgrund fehlender Materialien oder Motivation wieder nicht weitergeht. Oder dass ich in Tan-Awan mit einer Magenverstimmung und ohne Badezimmer viele Tage lang krank auf dem Boden liege, nachdem ich von einer Blutsuppe kostete, die extra für uns zubereitet wurde. Letztendlich heilt mich der Medizinmann des Dorfes. All diese Erfahrungen, gepaart mit einer Sehnsucht nach Heimat und Gewohnheit, machen mir das Leben in der Fremde manchmal furchtbar schwer. Umso wichtiger ist es, mir Auszeiten zu nehmen, das merke ich zum ersten Mal auf der Insel Palawan. Wie die Natur dort mich immer wieder durchatmen und Kraft schöpfen lässt: Sie wird mein Lieblingsort auf den Philippinen.
Insel Palawan. Das türkise, glasklare Wasser. Die zahlreichen kleinen, einsamen und naturbelassenen Buchten. Traumhafte weiße Sandstrände mit Kokosnusspalmen. Mangrovenwälder. Farbenprächtige Korallenriffe. Und Kalksteinklippen, die aus dem Meer herausragen. Während ich im Jeepney über die Insel Richtung Norden fahre, gleiten die verschiedensten Landschaften an mir vorbei: Ein kleines ländliches Dorf mit Häusern, die aus Nipapalmblättern gebaut sind, die Hühner scharren im sandigen Boden, eine große Sau suhlt sich im Schlamm, und mit einem Wasserbüffel wird das Feld hinter dem Haus gepflügt. Dann tiefgrüner Dschungel, aus dem eine beeindruckende Geräuschkulisse tönt. Die Bäume ragen hoch in den Himmel, und ich erkenne Vögel, die zwischen den Ästen sitzen. Angrenzend vereinzelt Zuckerrohrplantagen. Kokosnüsse, Bananen, Ananas, Papayas, Mangos – alles scheint hier in Fülle zu wachsen. In der Ferne ist ein großer Vulkan erkennbar, die Spitze verschwindet in dunstigen Wolken. Und das türkise Meer, das von überall auf der schmalen Insel schnell erreichbar ist. Obwohl „schnell“ relativ ist – bei den schlecht ausgebauten, holprigen, häufig einspurigen Straßen mit unzähligen Schlaglöchern ist das Fahren nicht mit dem Zurücklegen einer Strecke in Europa zu vergleichen.
Meinen größten Wildlife-Moment erlebe ich unter Wasser: Das Schnorcheln fühlt sich ein wenig so an, als wäre ich im Wartezimmer meines Zahnarztes und würde meinen Kopf in das bunt schillernde Aquarium stecken. Nur eben viel größer und aufregender. Ich entdecke große bunte Fische, knallblaue Seesterne und schillernde Korallenriffe. Alles ist in Bewegung. Interessante zigarrenförmige Fische verschwinden schnell in den Löchern und Fugen der Felsen, sobald ich mich nähere. Die großen Fische fressen seelenruhig weiter am Riff, ihre Gesichtszeichnung erinnert mich an die eines Pandas. Plötzlich finde ich mich inmitten eines großen Schwarms aus winzig kleinen Fischen wieder. Seegras und Algen schwingen im Einklang. Manchmal wird das Meer so flach, dass ich Sorge habe, die Pflanzen und Korallen zu berühren. Dann bleibe ich ganz still, lasse mich von der Wasseroberfläche tragen und beobachte das bunte Getümmel unter mir.
Nach stundenlangem Schnorcheln – die Taucherbrille drückt, und der Salzgeschmack wird immer penetranter – taucht plötzlich eine über einen Meter große Schildkröte neben mir auf. Seelenruhig schwimmt sie unter mir durch, bewegt sich gelassen, gleichmäßig und langsam fort. Ich bin völlig aus dem Häuschen und folge dem schillernden Riesen durch die Fluten. Es handelt sich um eine Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas), die weltweit unter Schutz steht. Sie scheint sich überhaupt nicht an mir zu stören und beginnt in aller Ruhe, auf dem flachen Grund zu grasen. So erinnert mich die schöne Schildkröte ein wenig an eine grasende Kuh im Sauerland, bemerke ich grinsend. Zwei große Putzerfische saugen unablässig an ihrem Panzer und säubern ihn von überschüssigen Hautschuppen, Pilzen und Parasiten. Auf diese Weise verschaffen sie sich gleichzeitig Nahrung – ein perfektes Zusammenspiel. Zwischendurch taucht die Meeresschildkröte wieder neben mir auf, streckt den Kopf aus dem Wasser und holt tief Luft. Ich könnte ihr stundenlang zuschauen.
Genau solche Momente haben mein Auslandsjahr auf den Philippinen so einzigartig gemacht. Es war nicht immer leicht, noch sehr jung und für lange Zeit in einer völlig fremden Welt zu leben. Doch auch die schwierigen Zeiten haben mich im Nachhinein nur stärker gemacht und auf das vorbereitet, was mein Leben noch mit sich bringen würde.














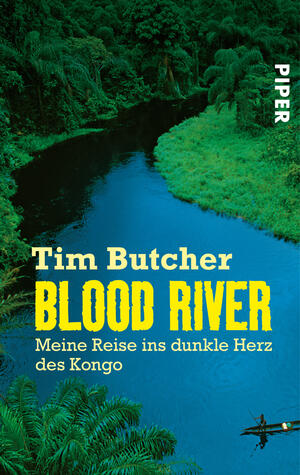
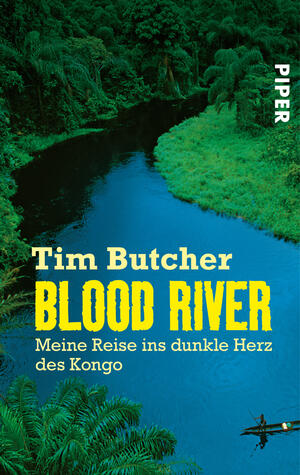







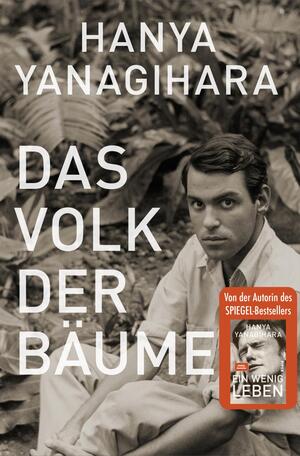



Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.