Die magischen Kräfte der Eisenbahn
Die Eisenbahnmenschen lieben die Eisenbahn. Doch es geht um viel mehr. Für die Eisenbahnmenschen ist die Bahn, ähnlich wie für die Autoren und Autorinnen dieses Reisebuches, nicht nur ein Verkehrsmittel, das sie von A nach B bringt. Sie fahren zwar auch von A nach B, aber gern über D, L oder R. Genau so sagt es ein guter Freund von mir, der nur drei Minuten vom Hauptbahnhof in Wien lebt. Er muss es wissen, denn mit dem Zug fährt er im Jahr an die hundertsechzigtausend Kilometer, das wäre viermal um die ganze Erdkugel. Mindestens!
Dieser Freund weiß auch, was alle Eisenbahnmenschen wissen: Die schnellste Reise muss nicht die schönste sein. Und er weiß auch, dass die Eisenbahn viele Geschichten erzählen kann. Und auch viel Geschichte. So wachsen die Eisenbahnmenschen mit der Eisenbahn zusammen und lassen sich einfach treiben. Genauso machen es auch die Autorinnen und Autoren dieses Buches.
Die wahren Eisenbahnmenschen gehen im Speisewagen frühstücken, verrichten schnell ihre Arbeit am Computer, und schon wird das Mittagessen im Speisewagen serviert. Sie fahren von Wien nach Graz und von Graz über Wien bis nach Prag und von dort wieder zurück nach Wien, gern über Bratislava oder Budapest. Geschlafen wird dann im Nachtzug nach Zürich, Rom, Warschau, Lviv oder Bukarest.
Ja, so mancher Eisenbahnmensch hat es schon bis nach Peking mit der Eisenbahn geschafft, wie eine Heldin aus diesem Erzählband, der es gelingt, im Gespräch mit einer Nachtzugschaffnerin hinter die Kulissen des Regimes zu schauen.
Jeder Eisenbahnmensch kennt aber auch die Freiheit, die man mit Interrail in ganz Europa erleben kann. Immer wieder sind sogar singende Schaffner unterwegs, so wie in Spanien. Ja, jeder Eisenbahnmensch hat ein Nomadenherz, wie eine andere Geschichte heißt. Wie gut versteht man die Erzählerin, die sich – auch singend – fragt: „Wo gehöre ich hin wo gehöre ich hin wo gehöre ich hin wo …“ Und alle wissen, „dass jede noch so kurze Reise die Reisenden verändert, dass auch die unscheinbaren Dinge, die man außerhalb des fest abgesteckten Alltags erlebt, uns ein klein wenig zu einem anderen Menschen machen“.
Ja, auch über solche fast magischen Kräfte verfügt die Eisenbahn.
Jeder Eisenbahnmensch könnte wohl diesen Satz aus einer anderen Geschichte unterschreiben: „Es gibt Bahnstrecken, die man nicht oft genug fahren kann.“ Denn so ist es wirklich. Es gibt immer so viel zu entdecken. Egal, ob man allein reist, mit Freunden oder mit Familie. Eine Fahrt von Deutschland nach Italien über den Brenner ist im Sommer ganz anders als im Frühjahr oder Herbst und wiederum ganz anders im Winter. Man weiß nie, wer im Abteil mitfährt. Wer sich dort vielleicht versteckt. Und warum.
Denn die Eisenbahn erzählt auch dramatische Geschichten: vom Krieg, von der Flucht, von Ängsten und von Trauer. Jeder Eisenbahnmensch war bestimmt einmal hin und her gerissen, wie die verzweifelte Heldin einer anderen wunderbaren Geschichte, die im ICE nach Köln sitzt, zu einem Termin rast, in ihren Gedanken aber ganz woanders ist – am Krankenbett ihrer Mutter. Viele Erinnerungen kommen hoch. Und viele Tränen fließen.
Trotzdem kann man nie satt vom Bahnfahren werden. Zum Beispiel, wenn man in Großbritannien einen Freund von London über Glasgow bis in die Einsamkeit von Corrour in den schottischen Highlands begleitet. Oder in einer Schmalspurbahn in Südböhmen sitzt, Bier trinkt und aus dem Fenster in den alten Wald schaut und darüber nachdenkt, warum diese wunderschöne Gegend Böhmisch Kanada heißt.
Aus Südböhmen ist es nach Wien, in das Eisenbahnherz Europas und zum Hauptwohnsitz vieler Eisenbahnmenschen, nicht weit. Doch auch Kenia, Saudi-Arabien, China, Russland, Thailand oder die Vereinigten Staaten, wo andere Eisenbahngeschichten aus diesem Buch spielen, scheinen plötzlich nah zu sein. Die Eisenbahn verbindet uns und unsere Geschichten.
Gute Reise, wir sehen uns im Speisewagen.
Jaroslav Rudiš, im Sommer 2024
Zwei Bahnreisen, der Botschafter und Bai - von Nanna Harth
Ungeachtet der Kritik an meinem Vorhaben, die darin bestand, dass in China ein halbes Jahr zuvor prodemokratische Arbeiter- und Studentenproteste niedergeschlagen worden waren, startete ich mit der Planung. Ich wollte die Menschen und Landschaften kennenlernen. Mir mein eigenes Bild machen. China, das klang nach einem Puzzle mit großem Panorama.
Erste Bahnreise
Als sich die Türen des aus West-Berlin kommenden S-Bahn-Zuges im Bahnhof Friedrichstraße öffneten, blies mir ein frostiger Wind entgegen.
Es ertönte die Ansage: „Dieser Zug endet hier und fährt zurück.“
Noch musste man im Winter 1989/90 für die Weiterfahrt in den ehemaligen Sowjetischen Sektor von Bahnsteig B nach C wechseln und dabei den mittlerweile verwaisten Grenzposten, ein groteskes Labyrinth aus Trennwänden und Kontrollräumen, durchlaufen.
Dort angekommen, trippelte ich auf dünnen Ledersohlen zwischen Wartenden über eiskalten Beton und hielt Ausschau nach dem Ostberliner Anschlusszug. Mit beschlagenen Scheiben und einem Quietschen fuhr er mit Verspätung ein. Auch er würde wie der Zug aus West-Berlin wieder zurückfahren. Als die Menschen aus dem anderen Teil der Stadt hinausgeströmt waren, stieg ich mit den neuen Fahrgästen ein und setzte mich auf eine Bank mit porösem Kunststoffpolster.
Der Zug setzte sich in Bewegung. Ich erinnere mich an das Deckelgeklapper der Aschenbecher, aus denen es nach Zigarettenstummeln, Kaugummi und Bananenschalen muffelte, und an die Hitzeschübe, die durch kleine Lüftungsgitter in das Abteil stießen. Auch an zaghafte Kritzeleien, Vorboten der Graffitis, die wahrscheinlich bald auch diese Waggonhaut zieren würden.
Die Gleise führten uns vorbei an Blockrandbebauungen mit im Krieg durchsiebten Fassaden, Bürogebäuden mit bronzefarbenen Fensterbändern, Plattenbauten und alten Industrieanlagen. Der Zug entfernte sich aus dem Zentrum und ratterte durch die zerbröselnde Stadtlandschaft in Richtung Norden.
Nach zwei Linienwechseln fuhr ich am S-Bahnhof Pankow mit der Straßenbahn weiter in Richtung Niederschönhausen. Gründerzeitvillen im Dornröschenschlaf, verwildertes Gartengrün und ein Konsum-Supermarkt mit Broilergrill vor dem Eingang säumten den geflickten Asphalt. Es roch nach Kohleöfen und dem verpuffenden Zweitaktergemisch der Trabanten. So tief war ich bisher nie in den Osten Berlins vorgedrungen. Nie über die Achsen und Plätze in Mitte hinausgekommen.
Von der Straßenbahnstation irrte ich auf den ausgetretenen Sandbelägen der Bürgersteige noch etwas weiter. Niemand außer einer Kinderwagen schiebenden Mutter und einem Seniorenpaar mit Einkaufsbeuteln war unterwegs.
War ich falsch? Hatte ich mich womöglich in meinem ganzen Vorhaben geirrt?
Dann entdeckte ich am Eingang einer alten Villa zwei steinerne Löwen. Zuerst betrat ich die Treppe, dann das Hoheitsgebiet der Volksrepublik China.
In meinen Vorstellungen war eine Botschaft ein repräsentativer und kosmopolitischer Ort. Mein Herz klopfte.
Als ich die Tür öffnete, lief jenseits des Eingangsbereiches eine Frau über den Korridor. Ich sprach sie an, und sie platzierte mich auf einem Stuhl in einem leeren Wartezimmer. Es dünstete nach Linoleum und einem alten Wasserschaden. Leuchtstoffröhren überzogen die in die Jahre gekommenen Oberflächen mit einem Gelbstich, wie dem von Zahnbelag.
Nachdem ich eine Weile dem Rauschen und Klopfen der Heizungsrohre gelauscht hatte, kehrte die Frau zurück und geleitete mich in den Nachbarraum. Überall standen Kartons auf dem Boden.
Eine zweite Frau, die noch Schreibmaschine schrieb, nahm hinter dem Tresen meinen Antrag für das Visum auf. Sie ließ mich lange stehen.
Der „große Steuermann“, ein gerahmter Mao, grinste überheblich von der Wand. Vierzehn Jahre nach seinem Tod.
Ich spürte Unbehagen.
Die erste Frau kam zurück und bat mich die Treppe hinauf. Sie führte mich in einen mit alten Möbelstücken, ich glaube, es war Biedermeier, ausgestatteten Salon. Das Fischgrätparkett knarzte bei jedem Schritt. Trübes Januarlicht drückte durch die Fenster an blassgelben Perlonbahnen vorbei und vermischte sich mit dem Qualm einer Zigarre.
In einer Ecke, neben einem Gummibaum, saß ein älterer Herr in einem Ohrensessel. Er trug einen steingrauen Anzug mit Mao-Kragen und zwei, drei bunte Abzeichen am Revers. Sein Hinterkopf ruhte auf einem Spitzendeckchen, das reinweiß leuchtete auf dem blutroten Samt des Sessels.
Er winkte mich zu sich.
Ich verstand, ich sollte mich setzen.
Die Frau servierte Grüntee in Porzellantassen. Der kurze, dicke Zeigefinger des Herren deutete auf eine Schale Kekse. Es fühlte sich an, als ob man einen Großonkel besuchte, den man nicht kannte.
Als er nichts sagte, sagte ich, ich hätte vor, über die Mongolei mit dem Zug in sein Land einzureisen. Sein Dauerlächeln verunsicherte mich. Ich konnte es nicht lesen.
Warum, wieso, weshalb? Das fragten nur seine Augen.
Meine Pupillen flüchteten in den schwebenden Staub unter dem Schein eines Kronleuchters. Ich fühlte mich zu jung und unerfahren für eine solche Situation.
Warum saß ich plötzlich hier oben? War ich überhaupt willkommen in seinem Land?
Nachdem er meine Begutachtung beendet hatte, sagte er etwas auf Chinesisch zu der Frau, die daraufhin verschwand. Schweigsame, endlos lange Minuten verstrichen.
Sie kehrte mit einem Lacktablett zurück.
Der Botschafter zog kräftig an seiner kubanischen Bruderzigarre, reichte mir Visum und Pass und nickte mich hinaus.
Zweite Bahnreise
Nach einer zehntägigen Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn erreichte ich Mitte Februar den Pekinger Zentralbahnhof und war bereits wenige Tage später wieder unterwegs.
In einem Zickzackkurs bewegte ich mich, kleinere Aufenthalte eingeschlossen, nach Süden. Die Lokomotiven der chinesischen Staatseisenbahn schleppten ihre Wagenketten durch schlafendes Ackerland. Unter einem meist verhangenen Winterhimmel passierten wir landwirtschaftliche Großbetriebe, Ziegeldörfer, qualmende Industrieanlagen und Städte mit gesichtslosen Wohnsiedlungen. Altstadtquartiere begannen neuen Stadtplanungen zu weichen, unzählige Tempel und Pagoden waren während der Kulturrevolution beschädigt oder zerstört worden. Ihre Instandsetzung kam nur zögerlich wieder in Gang.
Das Land wurde noch nicht von Expresshighways und aufgeständerten Schnellzugtrassen durchschnitten. Keine aus dem Boden gestampften Giga-Stadtsilhouetten formten den Horizont. Fahrrad, Bus und Bahn waren die gängigen Fortbewegungsmittel. Private Pkw und Flugtickets waren für die Masse unerschwinglich und kaum erhältlich.
Ältere Mitreisende trugen oft noch Mao-Anzüge und -Mützen, ob aus Verehrung, Bequemlichkeit oder Armut, das war mir nicht klar. Die Kleidung der Jüngeren erinnerte an Muster und Schnitte aus den Siebzigerjahren. Gereist wurde mit Stoffkoffern und Jumbo-Taschen aus Kunststoffplane.
Eine erste Generation von Wanderarbeitern war unterwegs und strömte aus ländlicher Armut in die Fabriken und auf die Baustellen der wachsenden Städte. Sie nächtigten in Gruppen auf Bahnsteigen und auf Bergen von Habseligkeiten.
Südlich des Jangtsekiang in subtropischen Gefilden gewann das Gelände an Formen und Farben. Leuchtende Raps- und Lotusfelder, Bambuspflanzungen und Hügelketten mit exotischen Mischwäldern verschwammen ineinander wie dahinaquarelliert.
Mit der Lieblichkeit und der Frühlingswärme wuchs meine Spontanität. Im Voraus gekaufte Zugtickets verfielen oder wurden umgebucht. Aussteigen, bleiben, weiterfahren, auch mal in eine nicht vorgesehene Richtung. Dafür nahm ich das Anstehen und Organisieren von Tickets in lauten, überfüllten Bahnhofshallen gern in Kauf. Allein das Auffinden des richtigen Schalters war Abenteuer genug.
An einem Nachmittag versuchte ich, kurzfristig ein Ticket für einen Nachtzug zu bekommen.
Méiyǒu. Gibt es nicht.
Warum nicht? Ich insistierte mit Händen und Grimassen.
Die von mir angesprochene Dame schloss mit versteinerter Miene ihren Schalter. Aufgrund des Zeitdrucks drängelte ich mich zum nächsten, auch an ihm und den benachbarten Theken schnarrten die Metallgitter herunter. Rums!
Ich hatte tatsächlich das Gesicht verloren.
Es kam vor, dass ich auf Bahnhöfen von Studenten angesprochen wurde. „I want to practise my English.“ Sie ergriffen die seltene Chance einer Plauderei. Seit den Geschehnissen auf dem Tian’anmen-Platz in Peking war das Land leer gefegt von Besuchern aus dem Westen.
Für meine Fahrten buchte ich Hardseater oder Hardsleeper. Als Ausländer zahlte man selbst für diese einfachen Klassen noch einen verhältnismäßig hohen Preis. In deren offenen Abteilen reiste man dicht gedrängt, manchmal mit halben Hausständen und mit Hühnerkäfigen vereint.
Oft fand sich auch hier jemand, der einige Brocken Englisch sprach und den man zwischen die anderen Zuggäste und mich stopfte.
Während unzählige Augenpaare sich auf mich richteten, Beine von Pritschen baumelten, beantwortete ich mithilfe des Übersetzers die üblichen Fragen und erntete dafür Gelächter. Unverheiratet, kinderlos, fern der Heimat unterwegs in einem Zug, einfach so, das sorgte für Aufsehen. Eine Fahrt mit dem Zug brachte einen üblicherweise von A nach B, da man etwas erledigen musste. Man fuhr zur Arbeit, zur Großmutter ins Krankenhaus oder zu Einkäufen in die Stadt. Aber nicht zum Vergnügen quer durch das Land. Wer finanziell in der Lage war, machte eine Ausnahme zum chinesischen Neujahrsfest.
Der Austausch im Zug war von der Hoffnung auf ein besseres Leben geprägt. Es wurde das Existenzielle, nie die Politik thematisiert. Weder über das kollektive Trauma der Kulturrevolution, das hinter den Menschen lag, noch über die Niederschlagung der Demokratiebewegung im Vorjahr wurde gesprochen.
Ich hatte den Eindruck, jeder war mit sich selbst beschäftigt und wollte von der neuen Ära profitieren. Man vertraute mir Geschäftsideen an oder berichtete von Familienmitgliedern, die einen Fernsehapparat bestellt oder das erste Auto ergattert hatten.
Einmal kaufte ein Mitreisender während eines Stopps auf dem Bahnsteig bei einer sechsfingrigen Greisin ein tausendjähriges Ei, um es mir mit Profit weiterzuverkaufen. Er redete freundlich, werbend auf mich ein. Ich verstand seine Worte nicht, nur seine Absicht. Er bekam den geforderten Betrag. Nach Abschluss des Geschäftes gab ich ihm das Ei zurück. Fermentiertes Eiweiß ist eine Sache für sich. Ich bedeutete ihm, er solle diese Delikatesse genießen oder weiterverkaufen. Er sah mich ratlos an.
Mir begegneten die unterschiedlichsten Menschen, aber selbst wenn eine sprachliche Verständigung möglich war, bekam ich selten einen Zugang zu ihnen. Unsere Mentalitäten waren sich fremd, und die Welten, in denen wir lebten, begannen sich gerade erst im Zuge der Globalisierung und Öffnungspolitik Chinas miteinander bekannt zu machen.
Dann traf ich Schaffnerin Bai.
Anfang März, in den frühen Morgenstunden auf einem Bahnsteig und zu Beginn meiner letzten großen Zugfahrt.
Ihre zarten Glieder verschwanden in einem übergroßen blauen Hosenanzug, ihre Füße in Männerhalbschuhen. Den Blusenkragen schnürte ein rotes Halstuch. Mit gefalteten Händen vor der Brust stand sie vor dem Waggon und empfing jeden Fahrgast persönlich mit einem Nicken. Kein einziger erwiderte ihre Geste. Sie war lediglich die Bedienstete einer Bahngesellschaft. Offensichtlich auch keine Han-Chinesin. Ihr Gesicht war zu braun und sommersprossig, ihre Augen zu mandelförmig und ihre Nase nicht besonders flach. Selbst unter der fahlen Bahnhofsbeleuchtung war sie wunderschön.
Ich grüßte sie.
Sie blickte auf, und ihre Mundwinkel schnellten nach oben.
Das erste Mal auf dieser Reise stieg ich in einen Softsleeper-Waggon. Hier gab es komfortable Vier-Bett-Abteile, die man mit einer Schiebetür schließen konnte. Ich hatte eines für mich allein und freute mich über das kleine Refugium.
Mit mir waren nur wenige andere Reisende eingestiegen. Männer in Kunstlederjacken, Anzughosen oder Uniformen. Auch eine elegant gekleidete Frau mit einem Jungen an der Hand.
In der Morgendämmerung machte sich der Zug auf seine zweitägige Reise. Die schrillen Bahnhofsansagen verhallten. Das erste Mal seit Wochen nur noch das Rattern der Räder. Kein Geschnatter und Getümmel im Waggon. Wie in einem Vakuum durchdrangen wir die Schichten der bereits quirligen Stadt.
Bai war damit beschäftigt, heißes Wasser am Boiler zu zapfen und es in Thermoskannen in die Abteile zu bringen.
Türen schoben sich auf und wieder zu.
Später am Morgen stand ich im Gang und ließ mir den schwülen Fahrtwind ins Gesicht blasen. Bilderbuchszenarien zogen über Stunden vorüber. Ineinander verschachtelte Bauernhäuser mit geschwungenen Dächern schmiegten sich an die Hänge neongrüner Reisterrassen. Ein Fluss tauchte auf. Wie eine Schlange wand er sich um mächtige Felsmonolithe.
Gelegentlich trat ein Fahrgast heraus, rauchte eine Zigarette oder ging zur Toilette. Mehr nicht. Diese Mitreisenden waren von einem anderen Schlag. Sie wirkten abwesend und ernst.
Ich ging wieder in mein Abteil und ließ die Tür offen.
Plötzlich hörte ich es trappeln. Der kleine Junge stand vor meinem Abteil und zielte mit einem winzigen Spielzeugfotoapparat auf mich. Wir machten uns einen Spaß daraus, uns gegenseitig abzulichten. Bai eilte herbei, es war ihr sichtlich unangenehm. Sie fing ihn ein und brachte ihn der Mutter zurück. Er schrie und zappelte. Eine Minute später war er wieder da, mit einer Tüte Süßigkeiten. Ich gab Bai mit einer Handbewegung zu verstehen, er könne bleiben.
Gegen Mittag brachte sie eine Styroporbox mit einer warmen Mahlzeit. Auch Snacktüten mit Nüssen, Rindfleischchips und etwas glibberigem Süßen lagen auf dem Tablett. Viel zu viel für mich allein. Ich fasste an meinen Bauch und prustete.
Sie winkte ab, kicherte und ging weiter.
An die Esskultur der Chinesen, die mit Gerülpse, Gespucke und Geschmatze einherging, hatte ich mich nie gewöhnen können. Es war eine Wohltat, die Mahlzeit allein einzunehmen.
Am Abend brachte Bai die nächste Box und eine frisch gefüllte Thermoskanne. Ich gab ihr durch Grimassen zu verstehen, dass das Rindfleisch am Mittag schön scharf gewesen sei. Sie legte eine Hand auf die Brust, verbeugte sich und wiederholte mehrmals das chinesische Wort für Danke. Xièxiè. Sie freute sich über das Kompliment, als hätte sie das Gericht selbst zubereitet.
Zur Nacht brachte sie ein lindgrünes dünnes Handtuch, darauf lag ein Stück Seife in Papier gewickelt. Es duftete nach Jasmin. Sie zuckelte die Fenstergardine zu und zog die Betttücher glatt.
In der Frühe überraschte ich sie am Fenster im Gang. Sie winkte mich zu sich und deutete hinaus. Im Dämmer zeichnete sich eine karstige Gebirgskette ab. Surreal und fern.
Sie sagte etwas.
Ich zuckte ratlos mit den Schultern.
Sie wiederholte ihre Worte.
Ich fragte: „English?“
Sie schüttelte heftig den Kopf.
Eine Stunde später bekam ich als Erste das Frühstück, obwohl ich der Reihenfolge nach die Letzte gewesen wäre. Bai stellte eine Box auf den Tisch und öffnete den Deckel, wie eine Kellnerin die Servierglocke in einem feinen Restaurant. Reis mit Rührei, Röstzwiebeln und Wasserspinat. Sie ließ mich nicht aus den Augen, bis ich den ersten Bissen mit den Stäbchen in den Mund manövriert hatte.
Ich sagte übertrieben laut „Mmh“ und streckte den Daumen nach oben. Sie gackerte kurz, verließ mich zufrieden und schob den Servierwagen zum nächsten Abteil.
Der Zug hielt mehrmals am Tag in Provinzstädten. Die Bahnsteigabschnitte vor unserem Waggon waren stets von Händlern bereinigt. Keine Jungs, die mit Zweigen praller Litschis vor dem Fenster wedelten oder den Zugreisenden Zahnpastatuben entgegenstreckten, keine Frauen, die frische Dumplings und frittierte Gänsekrallen in ihren Bauchläden vor den Zugtüren feilboten. Ihr Rufen und Fenstergeklopfe sollten den privilegiert Reisenden offenbar erspart bleiben.
Dennoch kam es vor, dass Fahrgäste Bai mit Geldscheinen in den geschäftigen Teil des Bahnsteiges schickten. Mit gefüllten Plastiktüten hastete sie dann rotwangig zurück, um pünktlich ihren Waggon abfertigen zu können.
Für manch einen war sie das Mädchen für alles.
Wenn Bai nichts zu tun hatte, fegte sie mit einem Reisstrohbesen den Gang, wohl auch, um sich zu bewegen, oder sie saß in einer tür- und fensterlosen Kabine nahe der Waggontür. Den Vorhang hatte sie dann zugezogen bis auf einen Spalt, durch den man sie Tag und Nacht kontaktieren konnte.
Einmal erhaschte ich einen Blick auf diesen Raum, der kaum einen Quadratmeter maß. Auf einem Board standen sorgfältig aufgereiht Toilettenartikel, ein Bilderrahmen, ein Wecker und zwei oder drei Bücher.
In der vergangenen Nacht, auf dem Weg zur Toilette, hatte ich unter dem Vorhang ihre Beine gesehen. Die Perlonstrümpfe hatte sie noch an den Füßen. Sie schlief tatsächlich auf dem kleinen Sessel vor dem Schreibbrett mit dem Fahrtenbuch.
Am frühen Nachmittag kam Bai erstmals außerhalb der Essenszeiten in mein Abteil. Sie brachte Notizblock und Bleistift mit. Ich lud sie ein, sich zu mir an den Klapptisch vor das Fenster zu gesellen. Sie wehrte ab und setzte sich neben die Tür, die sie fest verschloss.
Über kleine Zeichnungen, die wir uns reichten – wir begannen mit Strichen, Kreisen und Wellenlinien –, kamen wir uns näher. Ich verstand, sie stammte aus den Bergen. Die hatte sie mir im Morgengrauen zeigen wollen. Als Nächstes zeichnete sie zwei Strichmännchen mit etwas zwischen den Beinen. Das große kreuzte sie durch. Das kleine berührte sie sanft mit der Fingerkuppe. Aha, sie hatte keinen Mann, aber einen Sohn. Um den Sohn kümmerten sich die Großeltern. Aber nur, wenn sie auf Tour war, darauf legte sie Wert.
Sie zeichnete mehrere Blätter voll, bevor sie den Block zu mir schob und ich ihn dann wieder zu ihr.
Nach einer halben Stunde wurde sie unruhig. Jenseits des Vorhangs bewegte sich ein Schatten auf und ab. Sie vermutete, einer der Fahrgäste suche sie.
Bevor sie mich verließ, zog sie ein Familienfoto aus der Anzugtasche. Ihr Sohn und die anderen Kinder waren in Schuluniformen, die Erwachsenen in farbenfrohe Trachten und Hüte gekleidet. Die Frauen trugen den prachtvollen Schmuck einer ethnischen Minderheit.
Sie kam noch zweimal bis zur Nacht.
Einmal vor dem Abendessen und einmal danach. Ich bemerkte erst jetzt, sie zog jedes Mal ihre Schuhe im Abteil aus, nicht wie üblich davor. Sie schien darauf zu achten, dass niemand sie bei mir vermutete.
Wir wollten mehr voneinander erfahren, und so zogen wir in unserer Kommunikation auch Arme, Beine, Mimik und Laute hinzu. Wir amüsierten uns und konnten uns nicht nur verständigen, sondern auch austauschen. Mit ihr war alles so einfach, und ich vergaß, dass sie kein Englisch und ich kein Chinesisch sprachen.
Kurz vor Mitternacht brachte sie einen Flachmann mit Reisschnaps und zwei kleine Gläser mit. Wir betranken uns nicht, aber unsere neue Sprache beherrschten wir bald fließend.
Bai war pflichtbewusst und mochte ihren Job als Zugbegleiterin. Sie war stolz darauf, ihn erhalten zu haben, da diese Posten meist nur von Han-Chinesen besetzt waren. Auch war er besser bezahlt als die harte Land- oder Waldarbeit bei der Forstgesellschaft oben in den Bergen.
Sie sagte, sie fühle sich frei beim Reisen.
Ich sagte, so gehe es mir auch.
Bai wollte zu keinem Zeitpunkt Devisen tauschen, mir irgendetwas unter der Hand verkaufen oder Englisch lernen.
Sie wollte mich, die Fremde, die Gleichaltrige, kennenlernen und ihren Blick weiten auf eine andere Welt. So wie sie mir den auf ihre gab. Ohne irgendein Streben, Nutzen oder Vergleiche.
Am nächsten Morgen regnete es. Der Himmel war grau, und Nebel verhüllte die letzten Ausläufer der pittoresken Landschaft. Meine Reise neigte sich dem Ende zu, und ein merkwürdiges Gefühl erfasste mich. In wenigen Tagen würde ich mit dem Flugzeug von Hongkong in ein kaltes Berlin katapultiert werden.
Ich erzählte Bai von dem anderen Grund, warum ich so weit von Deutschland fortgereist war. Nicht nur aufgrund eines Interesses an ihrem Land. Auch wegen eines Mannes, den ich vergessen wollte.
Sie zog die Stirn zusammen und legte meine Hand in ihre kleine weiche. Die erste Berührung in diesem Land.
Sie sagte, der Vater ihres Sohnes sei tot.
Das heißt, sie machte eine schlimme Handbewegung. Bei der Waldarbeit erschlagen von einem Baum.
Sie sagte, ihr Mann sei mausetot. Darum reise auch sie.
Als sie das letzte Mittagessen brachte, wich sie meinem Blick aus.
Ich fragte sie, ob sie Kummer habe.
Sie schüttelte den Kopf.
Von einem Moment auf den anderen wirkte sie wie eine der vielen anderen Zugbegleiterinnen in den letzten sechs Wochen. Distanziert und kontrolliert.
Als sie gegangen war, ließ ich die vergangenen zwei Tage Revue passieren. Am Vormittag hatte ein Funktionär vor ihrem Raum gestanden und streng hineingesprochen. Ihre Arbeit erledigte sie gewissenhaft, daran konnte es nicht liegen. Vermutlich plauderte sie zu viel mit mir. Mit der Frau aus dem Westen. Ich erinnerte mich, dass der gleiche Mann bereits am Vortag auf sie eingeredet hat, nachdem sie mein Abteil verlassen hatte. Bisher hatte sie ihm wohl getrotzt.
Als ich den Zug am Nachmittag an der Endstation verließ, stand Bai schon eine Weile auf dem Bahnsteig. Die übrigen Fahrgäste waren bereits auseinandergestoben.
Ich sagte, ohne zu stottern: »Xièxiè nǐ wèi wǒ zuò de yīqiè.« Danke für alles. Mein erster und letzter Satz in ihrer Sprache. Ich hatte ihn unter dem Kapitel „Chinesisch für den Alltag“ hinten im Reiseführer gefunden und auswendig gelernt.
Bai schaute mich mit großen Augen an und bekam einen Lachanfall, der sie in die Knie zwang. Sie war wieder die Alte.
Nur wir beide standen noch herum, als eine Putzkolonne in die Waggons stieg.
Ich solle wiederkommen, und dann werde sie mit mir in die Berge fahren. In ihr Hochtal. In ihr Dorf. Dort sei China bunt.
In den nächsten Tagen ging sie mir nicht aus dem Kopf.
Wir hatten uns gesagt, wir fühlten uns frei. Genauso wie ich mich auf meiner großen Reise fühlte sie sich auf ihren kleinen Reisen. Ich dachte darüber nach, dass Freiheit ein Begriff war, den man nach Belieben dehnen und schrumpfen konnte. Bai schien zufrieden mit ihrer Freiheit. Aber wie frei war sie wirklich in diesem Land, als Volksangehörige der Zhuang? Meine so viel einfachere und grenzenlose Freiheit fühlte sich unbedeutend und bescheiden an.
Die Botschaft der Volksrepublik China in der ehemaligen DDR wurde noch im gleichen Jahr geschlossen.
Mit einem Schaudern las ich Jahre später im Netz einen Artikel vom 30. September 1989 aus der Zeitung Neues Deutschland mit folgender Notiz: „Botschafter Zhang Dake dankte für das Verständnis und die Unterstützung, die die DDR der VR China bei der Niederschlagung des konterrevolutionären Aufruhrs in Peking gewährt habe.“
Ich erinnere mich an den Botschafter, der mich belächelt und mich angeschwiegen hat.
Und ich erinnere mich an Bai, die mit mir gelacht und mit mir gesprochen hat.
Transsibirien - von Julia Malchow
„Priviet“, Hallo, sagt der blonde, leicht gebräunte Besitzer dieses aufwühlenden und gleichzeitig entspannenden Augenpaars. Gefolgt von einem Satz auf Russisch, mit dem er sich als Juri vorstellt. Er streckt mir seine Hand entgegen.
„Julia“, sage ich und hoffe, dass er möglichst lange unser Nachbar bleibt. Ritas Familie rechts, Juri links, was soll da noch passieren?
„Irkutsk?“, frage ich.
Erst jetzt merkt Juri, dass ich keine Russin bin. „Krasnojarsk“, antwortet er.
Ich habe keine Ahnung, wann wir in Krasnojarsk einfahren. Dauert hoffentlich noch. Lächelnd schauen wir gemeinsam aus dem Fenster und auf die vorbeiratternden Birken, als Juri mich auf Levianisch fragt, woher ich käme.
„München“, sage ich. Und: „Germani“, wobei ich versuche, die Aussprache von Sergei nachzuahmen.
„Erfreut, Sie kennenzulernen“, sagt Juri in fast akzentfreiem Deutsch.
„Wir können uns ruhig duzen“, gebe ich lachend zurück.
Er hat Deutsch in der Schule gelernt und es offensichtlich besser behalten als ich mein Schulfranzösisch. „Ich ziehe in zehn Tagen in die Türkei. Ans Meer“, sagt Juri, „um zu kochen!“, und das Strahlen seiner Augen droht den Zug zu sprengen. Er ist Koch und beginnt sein neues Leben westlich von Side. In einem Ferienhotel.
„Ich liebe das Meer, ich beneide dich!“, sage ich.
„Was machst du dann in diesem Zug?“, fragt Juri, als mein Sohn Levi seinen Ich-bin-jetzt-wach-Singsang anstimmt.
Olga startet ihre morgendliche Mülltütenrunde, sieht mich plaudernd mit Juri und ruft etwas herüber.
„Da“, antwortet Juri, und Olga wird hektisch. Sie verstaut die Tüte unter dem Samowar und eilt zu uns.
„Sie möchte dich etwas fragen“, sagt Juri. „Sie fragt, ob ich übersetze, damit sie alles versteht.“
Olga wechselt einige schnelle Sätze mit Juri, dann heften sich ein grünes und ein blaues Augenpaar auf mich, und Juri sagt: „Du fährst zum Baikalsee mit deinem Baby, ja? Und dann über die Mongolei bis nach Peking, ja?“
Ich nicke.
„Warum machst du das? Alleine mit Levi. Wo ist der Vater?“
Olga schimpft leise mit Juri. „Vater nicht gefragt!“, sagt sie grinsend.
Ich starre die beiden an. Meine Hände kribbeln, und mein Magen fühlt sich auf einmal flau an. Vielleicht war der Lachs doch nicht in Ordnung gestern? Levi spielt mit meinen Schnürsenkeln und vermittelt den Eindruck, die nächsten Stunden nichts anderes machen zu wollen. Dem Geruch nach zu urteilen, braucht er auch keine neue Windel. Es gibt also keine Ausreden. Was werden die beiden wohl darüber denken, dass ich mich mit meiner Mission unter sie gemischt habe? Also los: „Ich reise, wenn ich Antworten suche“, hebe ich an.
Juri lacht, übersetzt und sagt: „Ich hau auch immer ab, wenn es schwierig wird!“
Sergei und Rita strecken die Nasen aus ihrem Abteil. Levi und Rita eröffnen ihre morgendliche Ballspielrunde. Sergei stellt sich zu uns und fragt Olga, was hier los sei. Olga erklärt die Situation, und dann schaut mich neben dem blauen und dem grünen auch noch ein spöttisch lächelndes braunes Augenpaar an.
„Abhauen bringt nichts“, sage ich. „Die Fragen holen mich immer ein. Also reise ich, um der Routine zu Hause zu entfliehen, eine neue Idee zu finden und die dann mit nach Hause zu bringen. Als Versöhnungsgeschenk sozusagen. Für meine Abwesenheit.“
Juri lächelt, übersetzt und sagt sonst nichts.
„Was ist deine Frage dieses Mal?“, lässt Sergei Juri fragen.
„Viele Menschen sagen, mit einem Kind wird alles anders. Auch die Eltern selbst verändern sich, heißt es immer. Und zwar nicht unbedingt zum Guten. Die Mütter verblöden bei Windeln und Kinderreimen, und die Väter entfernen sich von der Familie. Oder umgekehrt. Das will ich nicht.“
Olga fragt: „Ist denn so bei dir? Du nicht blöd!“
„Nein, noch nicht. Aber ich habe Angst davor.“
Katharina kommt aus dem Toilettenraum und stellt sich zu uns. Sergei spricht kurz mit ihr, dann fragt sie, wovor genau ich Angst hätte.
„Ich habe Angst, mein Leben mit Levi nicht zu finden. Und meine Träume zu verlieren.“
Katharina schaut Juri an.
Juri übersetzt.
Sonia stellt sich mit verschlafenem Gesicht und zerstrubbelten Haaren zu uns.
„Ich träume von Venedig! Ich möchte von der Giudecca aus auf das Markusbecken blicken und in La Fenice ein Klavierkonzert hören. Oder eines geben“, sagt Katharina und lacht auf. Ihre Augen leuchten, ihre Wangen sind leicht gerötet. Dann senkt sie ihre Augen und sagt leise: „Ich möchte einmal nach Venedig! Das echte Venedig, nicht das Venedig Russlands.“
Sergei erzählt uns, er träume davon, mit seiner Frau und Rita zusammen in Sankt Petersburg zu leben. Und von einem zweiten Kind: einem Sohn. Dann gibt er zu bedenken: „Viel zu teuer. Und keine Arbeit für mich!“
Sonia sagt, sie träume von einem Mann mit ganz viel Geld. „Geld“ sagt sie auf Deutsch.
Sergei sagt: „Ich auch!“ Und alle lachen.
Marina, die zweite Waggonschaffnerin und Vertreterin von Olga, sagt, sie weiß nicht genau, wovon sie träumen soll.
Olga entgegnet, dass sie davon träume, ins All zu fliegen: „Ich habe gelesen, dass das jetzt nicht nur für Astronauten möglich ist. Ich würde gerne diese Weltraumflugzeuge mitentwickeln und die Erde von oben sehen.“
Alle sprechen auf einmal ein paar Worte Deutsch. Und ich schäme mich ein wenig für meine fehlenden Russischkenntnisse. Wo immer es geht, versuche ich meinen Wortschatz, der mit da, spasibo und priviet fast zu Ende erzählt ist, einzustreuen. Als Sonia mir eine Kekstüte unter die Nase hält, greife ich zu und sage: „Spasibo!“ Oder muss es spasiba heißen? Sagt man als Frau grundsätzlich spasiba oder nur, wenn ich mich bei einer Frau bedanke? Und wenn mein Gegenüber ein Mann ist, spasibo? Konzentriert versuche ich, mich daran zu erinnern, wann wer im Zug „o“ oder „a“ gesagt hat. Es mag mir einfach nicht einfallen. Ist das jetzt schon die mit vierundzwanzigstündiger Babybetreuung einhergehende viel zitierte Verblödung? Oder ist mein Hirn mit Transsib und Levi einfach ausgelastet? Egal! Was hat Juri gerade gefragt? Ob ich bisher meine Träume gelebt habe? Vor Levi?
Gut, ich wusste, dass die Reise nicht einfach wird. Aber so schwierig?
„Work in progress“, sage ich, lache und fange an, von der Bedeutung des Reisens für mich zu erzählen. Dass ich auch andere Menschen dazu verführen möchte, sich hinauszuwagen, um dem Trott zu entkommen. Den Mühlen, die einem das Feuer aus den Augen stehlen. Und dass ich deswegen nach einer Bhutanreise einen Reiseveranstalter gegründet und nach einer Reise zum Salar de Uyuni eine Reisebuchhandlung übernommen habe. Dass ich in Bhutan zum Chomolhari Base Camp getrekkt bin, als ich gerade erfahren hatte, dass ich schwanger war. Und von Grönland mit Babybauch.
„Und jetzt bin ich hier. Mit euch!“
Wir sprechen noch eine Stunde über Träume, Ziele und das Leben, bis Sonia etwas sagt, das Juri nicht sofort übersetzt. Mit aufgerissenen Augen und in einem leicht harschen Ton spricht er in die Runde. Es gibt ein paar Wortwechsel, offensichtlich ist man sich uneinig, ob die Frage angemessen oder wie sie zu stellen sei.
Dann fragt Juri: „Findest du diese Reise nicht zu gefährlich? Für Levi? Auf der Suche nach deinen Träumen?“
„Ich fand es gefährlicher für uns alle, zu Hause zu bleiben“, antworte ich. „Außerdem möchte ich herausfinden, ob abenteuerliches Reisen mit Levi funktioniert. Ob es ihm guttut, so wie mir. Wenn nicht, breche ich ab.“
„Es scheint ihm gut zu gehen“, sagt Marina und beobachtet Levi, wie er an Ritas pinker Plastiksandale herumdoktert.
„Ich kann Levi den Schlüssel, den ich für mich gefunden habe, nur anbieten. Ob er das, was für mich ein Geschenk ist, annimmt, ist seine Entscheidung.“
„Warum Transsib?“, fragt Juri.
„Unterwegs mit dem eigenen Haus auf Rädern und Chauffeur. Mich treiben lassen können zusammen mit Levi, nicht selbst das Steuer in der Hand haben müssen. Und: durch Zufall“, antworte ich.
„Warum bist du nicht in Omsk ausgestiegen wie die anderen Touristen?“, lässt Olga mich fragen.
„Slow travel“, sage ich und erkläre, dass ich Levi versprochen habe, immer mindestens vier bis fünf Tage an einem Ort zu bleiben. Damit er sich an eine Umgebung und die Menschen gewöhnen kann. Damit es für ihn nicht stressig wird und ich entspannt bleibe. Wir machen kein klassisches Sightseeing, wir wollen was erleben. Uns erleben. Außerdem halte ich die Gegend um den Baikalsee und die Mongolei für spannender als Jekaterinburg, Omsk oder Krasnojarsk. Und ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich auf Reisen zu beschränken. Weniger zu machen, aber das intensiv.
Mittlerweile stehen auch noch die beiden männlichen Waggonschaffner aus dem Nebenwagen bei uns. Als Yulia mit ihrem Wägelchen um die Ecke biegt, gibt sie mir einen Kaffee, Levi und Rita je einen Keks und unterbricht ihre Versorgungstour.
Levi zupft an meinem Bein, Juri hebt ihn hoch und sagt: „Du hast eine sehr mutige Mama.“
Ich schaue aus dem Fenster: Dass die Birken sich lichten, kann ich durch meine schwimmenden Linsen gerade noch erkennen. Außerdem mischen sich bunte Holzhäuschen unter die Birken.
Olga fragt etwas auf Russisch, und alle nicken daraufhin. „Ihr seid mutig!“, erklärt Olga. Sie lächelt mich warm an, Sergei spöttisch-liebevoll, Sonia schwankt zwischen einem neutralen und mahnenden Gesichtsausdruck, Katharina wirkt nachdenklich, und die beiden jungen Waggonschaffner albern herum.
Und ich stehe da, inmitten einer Gruppe von Russen, die ich drei Tage zuvor noch nicht einmal kannte, mit Levi auf meiner Hüfte und dem sicheren Gefühl, in diesem Moment genau an diesen Ort zu gehören. Und zu diesen Menschen.
Gerade mache ich es mir in der Schönheit des Augenblicks so richtig gemütlich, als der Zug hält und Juri auf den Bahnsteig hüpft.
„Warst du schon mal in der Türkei?“, fragt er und drückt mir einen Zettel mit seiner E-Mail-Adresse in die Hand. „Falls du Hilfe brauchst unterwegs. Ich kenne fast überall jemanden, ein Freund meines Schwagers wohnt am Baikalsee, und die Schwester einer Freundin ist mit einem Mongolen verheiratet.“
„Spasibo!“, rufe ich und frage: „Wie ist es am Baikalsee? Kannst du mir was empfehlen?“
„Ich war noch nie da“, antwortet Juri. „Zeitlich und finanziell keine Möglichkeit. Du wirst in ein paar Wochen mehr von meinem Land sehen als ich in vierzig Jahren!“ Strahlt, winkt und verschwindet, als der Zug eine Rechtskurve fährt.
Und uns bleibt das Rattern.
Das erste Mal seit unserer Abreise bin ich mir sicher, das Richtige zu tun.
„Nur noch eine Nacht“, seufze ich, während Levi im Abteil versucht, sein Mittagessen zu sich zu nehmen. Ein Drittel landet in seinem Mund, ein Drittel am Rest seines kleinen Körpers und das letzte Drittel an der Fensterscheibe. Der orangefarbene Brei gibt den Birken eine interessante künstlerische Note.
Unsere Tage in der Transsibirischen Eisenbahn gehen definitiv zu schnell vorbei. Mit jedem Tag entfaltet ihr Rattern eine stärkere Kraft. Mit jeder Minute im Zug lasse ich mich mehr ein auf diese besondere Zwischenwelt. Auf diesen Ort, den es nicht gibt.
Gerade kann ich Levi noch abwaschen und umziehen, bevor ihm die Augen zufallen.
Die Transsib ist ideal für Levis und meine gemeinsame Reise: Auf eine Art passiert nichts. Keine Sehenswürdigkeiten, keine zeitlichen Verpflichtungen. Nichts, was uns abhält, bei uns zu sein. Dieses Nichts ist ein ganz besonderes Nichts. Wann kann man schon mal nichts machen. Nichts müssen. Nichts vorhaben.
Draußen rattern die Birken vorbei. Diese herrliche Monotonie vor meinem Fenster fordert mich jeden Tag, jede Stunde aufs Neue auf, mich zu öffnen. Mich auf das Hier und Jetzt einzulassen. Auf die Menschen. Diese wunderbaren Menschen! Das Rattern ist so intensiv, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als mitzuschwingen.
Yulia scheppert mit ihrem Wagen vorbei, und ich kaufe einen Joghurt.
Mit dem Einstieg in die Transsibirische Eisenbahn in Sankt Petersburg habe ich uns von unserem alten Leben abgeschnitten. München ist nicht hier. Wir sind nicht erreichbar. München?
Die Transsib hat mich mit ihrem hartnäckigen Rattern dazu gebracht loszulassen. Mich einzulassen. Auf mich. Und auf Levi. Und auf mich und Levi. Ohne zu wissen, wie wir aussteigen werden. Die Transsib ist ein konsequenter Schnitt mit dem Davor. Ohne eine Garantie auf das Danach. Und gerade deswegen der perfekte Reiseeinstieg für Levi und mich.
Sonia schlendert auf dem Weg zum Samowar an unserem Abteil vorbei und winkt. Levi dreht sich im Schlaf und seufzt. Draußen rattert zur Abwechslung mal ein Fluss vorbei.
Die Transsib ist wie eine Dusche: Sie hat alles weggespült, was störte. Für dieses Gefühl benutze ich gerne noch jahrelang Feuchttücher statt Duschgel zur Körperpflege. Wir sind jetzt bereit für die Reise. Ich fühle mich angenehm leer. Das Leben im Zug hat es geschafft, dass meine Zweifel und meine hoffnungsvolle Suche einem entspannten Nichts gewichen sind. Ich weiß nicht, was kommt. Ich will es noch gar nicht wissen. Denn es fühlt sich gut an.
Vor dem Abteil laufen die 5978 Mitglieder einer russischen Jugendgruppe in Tarnanzügen im Stechschritt Richtung Restaurant: Essen fassen. Gruppendynamik in Uniform war mir schon immer unheimlich. Der gewalttätige Klang ihrer stampfenden Füße bringt die Vergangenheit Sibiriens als Strafkolonie in unseren Zug. Bestrafung für Andersdenkende. Abschneiden vom politischen und geistigen Leben des zentralistisch geführten Russlands. Auch deshalb heben die Reiseführer die künstlerische und kulturelle Atmosphäre in Irkutsk als Zentrum Westsibiriens hervor. Die Jugendgruppe läuft unabhängig davon, wer oder was sich ihnen in den Weg stellt, in unverändertem Tempo weiter. Zweimal konnte ich Levi nur knapp vor den alles zermalmenden Füßen retten. Im Gegensatz zu meinen gesamten bisherigen Erfahrungen sehe ich in diesen pickeligen Gesichtern unter kahl geschorenen Köpfen keine Regung von Bedauern oder Mitgefühl. Oder gar Interesse. Zudem höre ich von meinen Mitreisenden keinen einzigen Kommentar zu der Gruppe, auch nicht in Form von genervtem Augenverdrehen oder einer Geste in Richtung „notwendiges Übel“. Alle springen hektisch zur Seite, sobald die stampfende Schallwelle anrollt, und senken teilnahmslos den Blick, wenn sie durch unser Abteil schwappt. Scheint eine Elitetruppe zu sein.
Levi wacht auf. Wir kuscheln, bis Rita in unser Abteil hereinschneit und Levi zu einer Partie Handfußball einlädt. Sergei setzt sich zu mir in den Gang, und wir teilen die Tafel Schokolade, die ich gestern von Yulia erstanden habe.
Gemeinsam schauen wir auf die Birken. „Ich mag Birken“, sage ich zu Sergei. Der lacht und sagt: „Hast du russisches Blut in dir?“
Olga arbeitet sich mit dem Staubsauger durch den Gang und die Abteile, um den letzten Staub von Juris Schuhen wegzufegen. Sergei und ich schweigen gemeinsam dazu.
Ein Gedanke trifft mich wie ein Lichtstrahl, der sich durch die Wolkenpracht oberhalb der Birken gekämpft hat: Transsibirien entsteht nur, wenn man einige Zeit am Stück darin verbringt. Wenn man, wie es viele Touristen machen, abends einsteigt und am nächsten Morgen wieder aussteigt, um ein Heimatkundemuseum und einen sicher hübschen Platz zu besichtigen, dann zeigt Transsibirien sich nicht. Transsibirien scheint scheu. So scheu wie die Reisenden, die suchen.
Levi klettert auf meinen Schoß und erinnert mich daran, dass es Zeit wird, zu unserem letzten gemeinsamen Abendessen in Zug Nummer 10 aufzubrechen. Nach Ulan-Bator fahren wir in einem Zug mit dreistelliger Nummer weiter. Je höher die Zahl, desto schlechter der Zug, habe ich im Reiseführer gelesen. Rossija, der Vorzeigezug Russlands, hat von Moskau in Richtung Wladiwostok die Nummer 1 und von Wladiwostok nach Moskau die Nummer 2.
Mittlerweile ist es stockdunkel. Levi schläft, und alle Taschen sind gepackt. Bei offener Abteiltür höre ich über Kopfhörer Musik und konzentriere mich aufs Atmen. Ich bin stolz darauf, wie selbstverständlich Levi und ich in der Transsib leben. Alles fließt im Rhythmus des Zuges. Ich spüre mich wieder. Als Mensch. Und als Mutter. Als die Mutter, die in mir steckt. Als die Mutter, die ich bin.
Im nächsten Moment schwebt eine Flasche Krimsekt an meiner geöffneten Abteiltür vorbei. Sie wackelt von rechts nach links. Gehalten von einer Hand mit langen rot lackierten Fingernägeln. Kurz darauf erscheint Sonias Kopf, eingerahmt von ihren kurzen braunen Haaren mit auf halber Stirnhöhe abgeschnittenem Pony, wie ich es bei zahlreichen Frauen in Sankt Petersburg auch gesehen habe, in meinem Türrahmen. Sie lacht und eröffnet die Abschiedsparty. Von Sergei, Marina, Olga, Katharina, Ritas Oma und der Teenagermama, die aus den Vorräten ihres bereits berauscht schlafenden Mannes eine Flasche Wodka stibitzt hat, erhalte ich eine Russischstunde, bei der ich nur erahnen kann, was mich meine Lehrer da sagen lassen.
„Wann muss ich morgen aufstehen, Olga?“, frage ich, da ich in diesem ganzen Chaos aus Moskauzeit, Ortszeit, Münchenzeit, die mein iPhone hartnäckig anzeigt, und dem Wodka den Überblick verloren und keine Ahnung habe, was meine Notiz „Ankunft Irkutsk zwölf Uhr“ denn nun genau bedeutet.
„Ich wecke euch, keine Sorge“, sagt Olga und rollt das r, wie es nur Russen können. Ich freue mich jetzt schon darauf, nach zwei Wochen Baikalsee Richtung Ulan-Bator zum zweiten Mal nach Transsibirien einzureisen.
Mit angewinkelten Knien, Füßen, die gegen eine beige Plastikwand drücken, einer rechten Hand über meinem Kopf, die sich gegen eine zweite Plastikwand stemmt, süßlichem Milchgeruch in der Nase und mit einem Rattern im gesamten Körper schlafe ich ein.

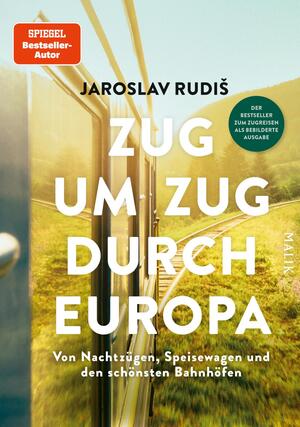











































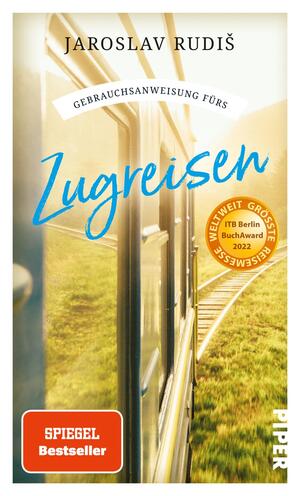
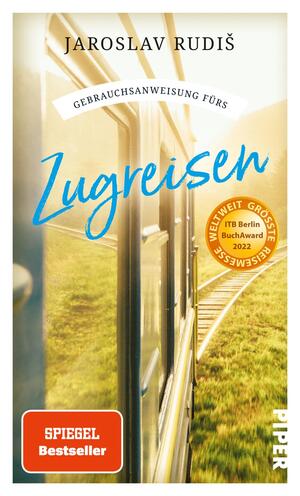







Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.