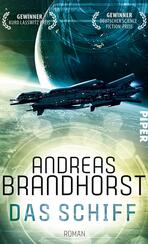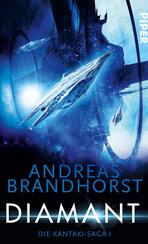Unsere Science Fiction-Bestseller
Seit 2015 hat der Piper-Verlag sein eigenes Science-Fiction-Programm, in dem er ausgewählte Titel des Genres anbietet. Bei uns finden Sie unter anderem die besten SF-Romane von Erfolgsautor:innen wie Andreas Brandhorst, Roger Zelazny, Robert Corvus oder Peter F. Hamilton.
Bestellen Sie sich Ihre Lieblingsbücher und tauchen Sie ein in faszinierende Zukunfts- und Parallelwelten!
Was sind Science Fiction-Bücher?
Der aus dem Englischen stammende Begriff „Science-Fiction“ bedeutet so viel wie „Wissenschafts-Dichtung“ und beschreibt ein bestimmtes Genre von Literatur, Film und bildender Kunst. Science-Fiction-Romane drehen sich oft um Weltraumfahrten, Reisen in eine andere Zeit oder die Konfrontation mit Außerirdischen. Dabei nutzen die Romanheld:innen futuristische Transportmittel und wissenschaftlich-technische Errungenschaften, die es so in Wirklichkeit (noch) nicht gibt.
Ist Science-Fiction gleich Fantasy?
Science-Fiction und Fantasy-Literatur sind eng miteinander verwandt. Während jedoch in Fantasy-Büchern der Glaube an Magie und Wunderkräfte eine wichtige Rolle spielt, wird in der Science-Fiction auf wissenschaftliche Weise das Unmögliche möglich gemacht. Das Genre nutzt reale wissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelt diese fantasievoll weiter. So entstehen faszinierende futuristische Welten, in die der Leser entführt wird.
Die Helden der Science-Fiction-Romane
Der typische Science-Fiction-Roman stellt die Technik der Zukunft meist auch in einen gesellschaftlichen Kontext. Die Leser:innen tauchen ein in fremdartige Kulturen und begegnet außerirdischen Wesen mit spitz zulaufenden Ohren, Insektenköpfen oder anderen befremdlichen Merkmalen. Andere Science-Fiction-Romane spielen in der Vergangenheit, wo sie der Geschichte einen völlig neuen Verlauf geben können.
Die Anfänge der Science-Fiction-Literatur
Als Pioniere des Genres gelten Autoren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wie Mary Shelley, Jules Verne und H. G. Wells. Während in Mary Shelleys Roman Frankenstein ein skrupelloser Arzt künstliches Leben erschafft, ließ Jules Verne seinen Kapitän Nemo mit dem U-Boot Nautilus die Weltmeere erforschen. H. G. Wells dagegen schrieb schon Geschichten über Raumschiffe, als es die Weltraumfahrt noch gar nicht gab.
Welches sind die besten Science-Fiction-Bücher? - Die Top 10 SF-Bücher
Dies ist unsere Auswahl an Science-Fiction-Klassikern, die man gelesen haben sollte.
- 1984 (George Orwell)
- Report der Magd (Margaret Atwood)
- Schöne Neue Welt (Aldous Huxley)
- Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)
- Solaris (Stanilsaw Lem)
- Dune (Frank Herbert)
- Per Anhalter durch die Galaxis (Douglas Adams)
Für viele gehören aber auch die Star Wars-Bücher zur beliebtesten Science-Fiction-Literatur, obwohl sie auch Fantasy-Elemente enthalten.
Deutsche Science-Fiction-Romane
Als Vater der Science-Fiction im deutschsprachigen Raum gilt Kurd Laßwitz, Autor des 1897 erschienenen Romans „Auf zwei Planeten“. Utopische Abenteuerromane und technisch-wissenschaftliche Zukunftsromane erfreuten sich im Deutschland der 1920-er, 1930-er und 1940-er Jahre großer Beliebtheit. Aktuelle SF-Bestseller schreibt der 1956 geborene, bereits mehrfach mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnete Schriftsteller und Übersetzer, Andreas Brandhorst.
Bei guter Science-Fiction ist es gar nicht so wichtig, die technische Entwicklung der Zukunft „richtig“ zu erraten, sondern eben irgendeine Schraube unserer Verhältnisse weiterzudrehen und dann zu überlegen, welche Tragweise, welche Konsequenzen das haben könnte.
Daher auch der in meinen Augen sehr schöne Zweitname der Science-Fiction: Speculative Fiction. Sie leistet ein Weiterdenken technischer – oder gesellschaftlicher, biologischer, wirtschaftlicher – Möglichkeiten, um anhand ihrer vorgenommenen Prämissen über Allgemeines und Aktuelles zu reflektieren. Und damit sagt sie eigentlich weniger über die Zukunft als über unsere Gegenwart und den Horizont unserer Gegenwart aus.
„1984“ und „Brave New World“ sind technisch auch längst überholt, aber immer noch relevante Science-Fiction-Romane. Über die Möglichkeiten unserer Gegenwart werden wir auch in 50 Jahren noch nachdenken müssen, und kaum eine Literatur kann das besser als die Science-Fiction.