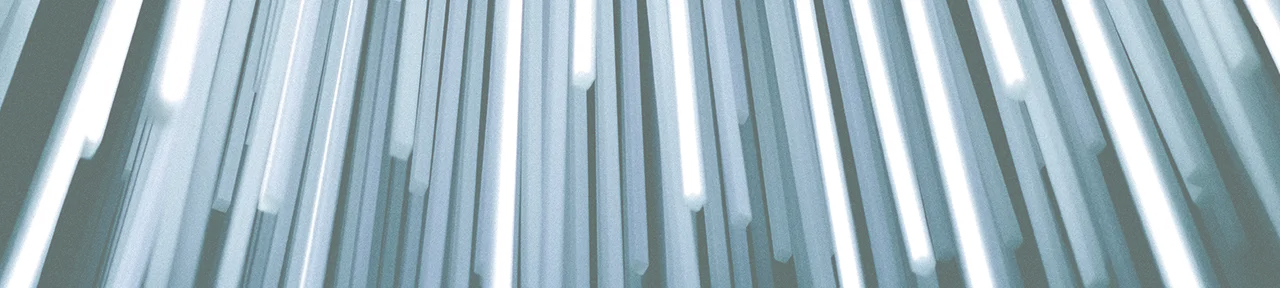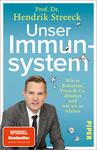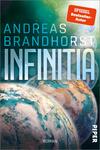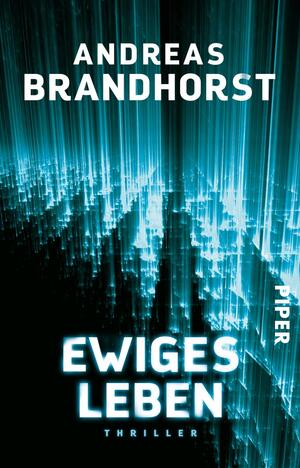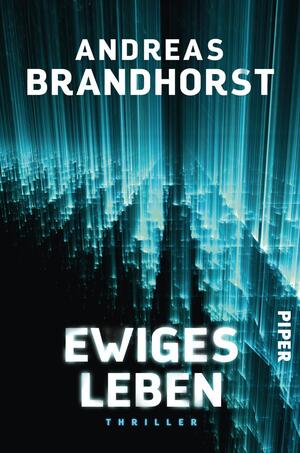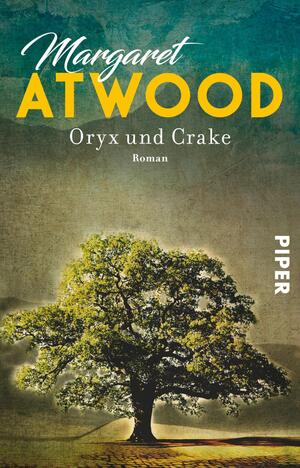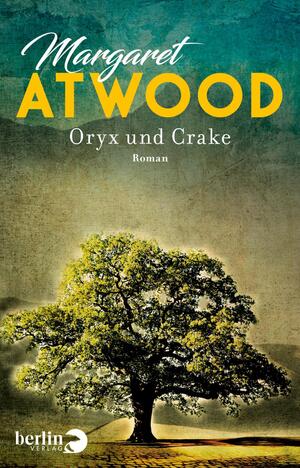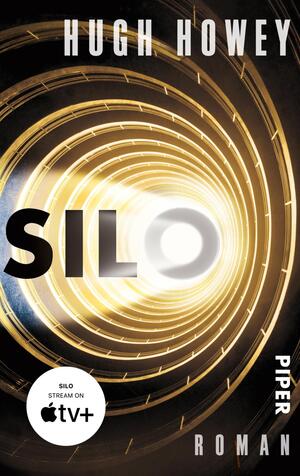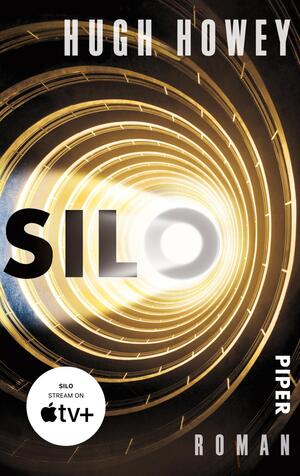Kapitel 1 – Morgendusche
Vince
Die Uhr auf dem Display zeigt 3:14 Uhr. Für einen Moment halte ich inne und starre gedankenverloren auf den Nieselregen, der den Blick durch die Windschutzscheibe meines Toyota Prius nach und nach verschwimmen lässt. Ich steige aus dem Auto aus. Die vielen winzigen Tropfen auf der Haut fühlen sich angenehm an. Mein Gesicht, meine Haare sind sofort nass. Aber das macht nichts. Erst vor zehn Minuten hat mich ein Anruf aus dem Bett geholt. Geduscht habe ich nicht, sondern mir nur schnell ein weißes Hemd und die Chinos, die vor meinem Bett lagen, angezogen, um hierherzufahren. Der Regen ist erfrischend, und ich schaue für einen Moment hoch in den Nachthimmel. Ich schließe die Augen, um das Wasser auf meinen Augenlidern zu spüren. Dann holt mich die Realität zurück.
Die Ames Street, die zur Uferpromenade des Charles River führt, ist bereits mit gelbem Flatterband gesichert, und Streifenwagen verstellen die Straße weitläufig. Zwei große Scheinwerfer fluten den Bürgersteig und die nähere Umgebung vor dem achtzehnstöckigen Green Building mit Licht; es ist das höchste Gebäude auf dieser Seite des Charles Rivers, in dem die Abteilungen für Atmosphären- und Planetenforschung des Massachusetts Institute of Technology untergebracht sind.
Oft schon habe ich die verschiedenen meteorologischen Instrumente und Funkkommunikationsgeräte auf dem Dach aus der Ferne bestaunt und mich gefragt, ob diese nicht eher der Spionageabwehr dienen, als wissenschaftliche Forschungsinstrumente zu sein.
Zügig gehe ich auf die beiden Streifenpolizisten zu, die den Tatort sichern. Die Officer haben mich bereits bemerkt. Bevor sie etwas sagen können, zeige ich ihnen meine Marke. Sie nicken und lassen mich passieren. Ich halte Ausschau nach meinem Partner Kirk.
Mit seinen zweiundsechzig Jahren steht er kurz vor der Rente. Vor einigen Jahren hatte er sein dreißigjähriges Dienstjubiläum. Seine Plakette war das Erste, was er mir stolz auf seinem Schreibtisch gezeigt hat. Im Morddezernat des Boston Police Department ist er bald zwanzig Jahre dabei. Ich bin erst vor ein paar Monaten zum Team dazugestoßen. Deshalb wurde mir Kirk als Partner an die Seite gestellt.
Der Wind lässt die Tropfen im Scheinwerferlichtkegel umherwirbeln, der auf den nassen Asphalt gerichtet ist. Deswegen bin ich hier. Eine junge Frau liegt mit dem Gesicht nach unten am Boden. Wie Magma drückt sich immer noch das venöse Blut zähflüssig zu einer breiter werdenden Lache unter ihrem Kopf hervor und ist längst durch das Regenwasser auf der Straße verdünnt.
Der Kollege von der Spurensicherung signalisiert mir, dass ich näher treten darf. Ich beuge mich zu der Frau hinunter und versuche, ihr Gesicht zu erkennen. Vorsichtig drehe ich ihren Kopf zur Seite. Erstaunlich unversehrt. Nur etwas Rollsplit klebt an der Wange. Dann spüre ich ein unangenehmes Knirschen durch meine Finger und lasse ab. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Unter der unversehrten Haut sind viele kleine Knochenbrüche zu spüren, und die scharfen Kanten reiben durch die Bewegung der Finger aneinander. Neben ihren Haaren liegt ein kleiner weiß glänzender Klumpen. Ich zücke meinen Kugelschreiber, um den Klumpen zu bewegen, aber dann halte ich inne. Es muss ein Stück vom Gehirn sein, welches aus einem Loch des Schädels herausgequollen ist.
„Sie sollten Handschuhe tragen“, sagt der Kollege von der Spurensicherung irritiert.
„Ist gut“, erwidere ich und richte mich auf.
„Da hat wohl jemand Suizid begangen“, sagt Kirk und beugt sich jetzt seinerseits über die Leiche. Ich habe nicht bemerkt, dass er in der Zwischenzeit gekommen ist und bereits eine Weile hinter mir steht. Trotz der warmen Temperaturen trägt mein Partner seine etwas zu weite Regenjacke mit dem Logo unseres Departments.
Ein dicklicher Streifenpolizist drückt sich ächzend unter dem Absperrband hindurch und kommt breitbeinig auf uns zu. „Mein Name ist Martin, ich war der Erste am Tatort.“
„Detective Vince Brickle, und das ist Detective Kirk Douser“, stelle ich uns vor.
Der Officer nickt und berichtet: „Sie hat sich anscheinend von dem Gebäude gestürzt. Ein Student, der nebenan im Studentenwohnheim wohnt, hat den Aufprall gehört und sie so aufgefunden. Das war gerade mal vor zwanzig Minuten.“
Martin zeigt dabei auf einen jungen Mann mit rötlichen Haaren und bleicher Haut, der vor dem Green Building steht. Er hat nur eine Shorts und ein T-Shirt an und tritt mit seinen nackten Füßen nervös auf der Stelle, während er zu uns herüberschaut.
„Ich verstehe nicht, wie man in der Gegend wohnen kann“, fährt der Officer fort. „Das Gebäude nennen wir nicht ohne Grund Suicide Tower. Alle naselang lassen sich Studenten von da oben runterfallen. Wegen Liebeskummer oder sonst was. Das kann man nur schwer aushalten. Ich frage mich, warum die Universitätsverwaltung die Zugänge zum Dach nicht besser sichert.“
Ich war hier mal zum Kürbisspektakel im Oktober, erinnere ich mich. Einmal im Jahr werfen Studenten gut gereifte Kürbisse aus dem obersten Stock, die dann auf dem Asphalt in alle Richtungen platzen. Das orangefarbene Fleisch verteilt sich auf der ganzen Straße. Ich hatte es damals nur zufällig gesehen, als ich zu einem Vorstellungsgespräch in die Stadt kam. Das Schauspiel ist bei Touristen sehr beliebt. Auch ich fand die platzenden fleischigen Kürbisse ebenso merkwürdig wie faszinierend. Obwohl das Event verboten ist, drückt die Campusverwaltung mittlerweile beide Augen zu, da das Interesse an diesem Spektakel so groß ist.
Kirks Frage holt mich ins Hier und Jetzt zurück. „Wie ist sie aufs Dach gelangt?“
Martin winkt den Kriminaltechniker heran. „Zeig den Detectives bitte die Zugangskarte.“
Der Mann im weißen Ganzkörperanzug der Spurensicherung reicht mir wortlos einen Beweismittelbeutel, in dem eine Plastikkarte steckt.
„Es handelt sich bei der Toten um Donna Myers. Sie unterrichtete als wissenschaftliche Assistentin Studenten im Gebäude. Aber wohl nur in den Sommermonaten, hat der Pförtner gesagt“, erklärt Martin.
„Und was genau hat sie unterrichtet?“, frage ich.
Martin zuckt die Schultern. „Das wusste der Pförtner auch nicht. Er hat sich nichts dabei gedacht, als sie gestern ins Haus ging. Die Wissenschaftler gehen hier ein und aus, und dass sie auch mal die Nacht zum Tag machen, ist ja nichts Ungewöhnliches.“
Ich sehe, wie Kirk jemanden auf der anderen Seite des Platzes beobachtet, und folge seinem Blick. Es hat aufgehört zu regnen, und nur vereinzelte Regentropfen fallen noch von den Blättern der Bäume und Vorsprünge der Häuser herab. Ich sehe einen großen, hageren Mann, der unter einem Baum steht und uns beobachtet. Hinter ihm kann man in der Ferne den schwarzen Fluss erkennen. Ein Schaulustiger. Manchmal kann man sich über die Menschen nur wundern. Hat der Mann um diese Uhrzeit nichts Besseres zu tun?
„Der Pförtner kann uns bestimmt weiterhelfen und uns aufs Dach lassen. Kommst du mit, Vince?“, fragt Kirk.
Er scheint so schnell wie möglich hier fertig werden zu wollen. Ich schüttle den Kopf.
„Ich will die Tote untersuchen. Geh du ruhig aufs Dach“, erwidere ich.
Ich weiß, dass Kirk meine Alleingänge nicht mag. Aber um diese Uhrzeit lässt er mir meinen Willen. Seine klitschnassen Haare kleben ihm an der Stirn, und seine Regenjacke glänzt vor Nässe. Ich schaue ihm nach, bis er die Eingangstür des Gebäudes erreicht.
Dann erst wende ich mich an den Kriminaltechniker. „Sie haben die Leiche bereits durchsucht?“
„Nein, das wollte ich Ihnen überlassen.“ Er reicht mir ein Paar Handschuhe.
Widerwillig streife ich sie mir über, beuge mich wieder zu der Frau hinunter und greife in ihre Hosentaschen. Ich ziehe ein türkisfarbenes Portemonnaie aus Polyester hervor und öffne den ausgeleierten Klettverschluss. Einige Geldscheine, wenige Münzen und eine Kreditkarte sind darin. Ah, und eine Berechtigungskarte für das virologische Institut am Industriehafen. Interessant. Das ist am anderen Ende der Stadt. Ich betrachte die Zugangskarte und das Foto auf der Karte. Hübsch. Warum will so eine junge Frau nicht mehr leben? Liebeskummer, Depressionen? Sie wirkt nicht depressiv auf dem Bild. Aber Bilder können täuschen.
„Dr. Donna Myers, Postdoc“, lese ich laut. Was, zur Hölle, ist ein Postdoc? Ein Doktor, der nach dem Doktor kommt? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ich betrachte die Tote erneut. Sie war also eine Virenforscherin. Vielleicht hatte sie sich bei der Arbeit aus Versehen mit einem tödlichen Virus infiziert, und der Suizid war der einzige Weg, die Menschheit zu retten? Ihre Haut wirkt sehr bleich. Ist sie infektiös? Ich weiche unwillkürlich einen Schritt von der Leiche zurück. Doch innerlich muss ich über mich schmunzeln. Das hier ist nicht der Anfang eines Pandemie-Thrillers, denke ich.
Die Idee ist aber gut.
Ich lasse das Portemonnaie mit der Zugangskarte in meine Jackentasche gleiten. Der Kriminaltechniker räuspert sich und wirft mir einen strengen Blick zu.
„Entschuldigen Sie. Eine Angewohnheit von mir“, grummle ich und lasse beides in den Spurensicherungsbeutel fallen, den der Kriminaltechniker mir entgegenhält.
Ich durchsuche weiter die Taschen der Toten, aber da ist nichts mehr zu finden. Ihr Hals und ihre Haut sind so gut wie unversehrt. Nur ihre rechte Hand ist auffällig. Sie scheint gebrochen zu sein, und aus ihrer geballten Faust ragt ein weißes Stück Papier. Ich zücke wieder meinen Kugelschreiber und spreize ihre Finger mühelos auseinander. Die Totenstarre hat noch nicht eingesetzt. Ich ziehe eine Visitenkarte aus ihrer Hand.
Dr. Daniel Western steht darauf und eine Telefonnummer.
Der Kriminaltechniker ist mit Officer Martin ins Gespräch vertieft. Ich stecke die Visitenkarte ein.
„Der Gerichtsmediziner kann die Leiche dann mitnehmen“, sage ich zu dem Kollegen von der Spurensicherung.
Kirk kommt eilig herbeigelaufen. Er hat rote Wangen und ist außer Atem. In der frischen Regenluft hängt jetzt ein leichter Schweißgeruch.
„Der Pförtner konnte mir nicht mehr sagen. Ich war auf dem Dach. Da war nichts weiter außer einer leeren Flasche Weißwein und viel Möwenschiss. Sie muss sich betrunken haben.“
Kirk trägt immer noch seine blauen Latexhandschuhe, obwohl sich darunter bereits der Schweiß abzeichnet. Über seiner Jacke sieht man, wie seine Körperwärme dampfend durch den Stoff nach oben steigt. Ihm muss warm sein. Er hält mir eine durchsichtige Tüte mit einer Flasche entgegen. Australischer Sauvignon Blanc. Na ja, nicht der beste Wein. Ich trinke gerne Weißwein, aber Sauvignon Blanc kann ich nicht leiden. Und das ist auch eher eine billige Sorte.
Kirk übergibt den Beutel dem Kollegen der Spurensicherung und sagt: „Lass uns noch mit dem jungen Mann sprechen, der die Frau gefunden hat. Dann sind wir hier fertig, oder?“
Ohne meine Antwort abzuwarten, geht er zu dem Mann, der unter dem Vordach steht. Ich folge ihm wortlos.
„Sie haben die Polizei gerufen. Ist das richtig?“, beginnt Kirk seine Befragung.
Der Mann tippelt in seiner hellbraunen Shorts mit seinen bleichen Füßen auf dem nassen Steinboden hin und her. Seine roten Beinhaare kräuseln sich. Ihm muss kalt sein.
„Ja, das ist richtig“, bestätigt er.
„Und Sie heißen?“
„Kevin O’Hare. Ich wohne im Nachbargebäude, Sir.“
„Sie haben zu dem Kollegen gesagt, dass Sie den Aufprall gehört haben. Waren Sie draußen?“
„Nein, Sir. Aber mein Fenster war offen. Sehen Sie?“ Er zeigt mit seinem Finger auf ein geöffnetes Fenster im ersten Stock.
Kirk grummelt und fragt mit einem gelangweilten Unterton: „Gut. Warum waren Sie um diese Zeit noch wach?“
„Wir haben nächste Woche Semesterzwischenprüfung. Ich habe noch gelernt.“
„Und Sie sind dann zur Tür und haben die Leiche so gefunden.“ Mit einer Handbewegung schließt Kirk bereits sein Notizbuch.
„Das ist richtig, Sir. Ich habe sie aber nicht als Erster gefunden. Ein anderer Mann war auch noch da. Als ich rauskam, hat er sich gerade zu ihr gebeugt. Er ging weg, als er mich gesehen hat.“
„Ein Mann?“, fragt Kirk überrascht und klappt sein Notizbuch wieder auf.
„Ja, er stand eine Weile da vorne am Ufer, aber ich sehe ihn nicht mehr“, sagt der Student nun etwas aufgeregter.
„Können Sie mir den Mann beschreiben?“, frage ich.
Kirk schaut mich missmutig an, ich grätsche in seine Befragung rein, er lässt mich aber gewähren.
„Es war dunkel. Er war groß und mittleren Alters. Etwas größer als Sie. Er hat braune oder schwarze Locken. Er trug einen blauen Anzug. Da bin ich mir sicher.“
„Hat er irgendetwas zu Ihnen gesagt?“, hake ich nach.
„Nein, nichts. Gar nichts.“ Der Student tippelt nun noch nervöser.
Ich habe Mitleid mit ihm. Nachdem ich seine Kontaktdaten aufgenommen habe, entlasse ich ihn. „Danke. Das war’s. Sie können gehen.“
Dann wende ich mich Kirk zu. „Was machen wir mit dieser Information?“
Kirk zieht seinen Hosenbund nach oben und sagt dann: „Nichts. War eben noch jemand hier und hat die Tote gefunden. Erwähnen wir im Bericht. Den Fall können wir abschließen. Das ist eindeutig ein Suizid.“
„Ja, gut möglich“, murmle ich vor mich hin. Jetzt folgen allerdings noch die Formalien, denke ich. Der Gerichtsmediziner muss Fremdverschulden ausschließen, und wir werden das Apartment der Toten einmal aufsuchen, um einen Anhaltspunkt zu haben, warum sie sich das Leben genommen haben könnte. Vielleicht finden wir einen Abschiedsbrief. Außerdem brauchen wir die Kontaktdaten, um die Angehörigen und den Arbeitgeber zu informieren.
Ich sehe Kirk seine Anstrengung deutlich an. Diese nächtlichen Aktionen steckt er nicht mehr so spurlos weg. Ich biete ihm an, dass ich mir die Wohnung der Toten auch allein anschauen kann. Er willigt dankend ein.
Donna Myers Apartment liegt in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, dem virologischen Institut. Das ist gleich beim Industriehafen. Eine triste Gegend. Es gibt eine Reihe von Bürogebäuden, einen Makler und einige wenige Eigentumswohnungen. Die Straßen wirken sonderbar verlassen, wie ausgestorben. Manche Stadtteile strahlen auch in der Nacht Leben aus, aber dieser hier nicht. Die Häuser sind gleichmäßig angelegt. Nur wenige Autos stehen am Straßenrand. Alles ist sauber. Fast zu sauber. Irgendwie steril. Es fehlt das Leben.
Die Wohnungstür kann ich schnell öffnen. Donna Myers hatte sie beim Hinausgehen nur ins Schloss fallen lassen. Seit meiner Jugend trage ich ein Lock-Picking-Set bei mir. Es hat mir schon viele gute Dienste geleistet, auch wenn es nicht zur typischen Ausrüstung eines Polizisten gehört.
Mein Vater war damals nicht sehr begeistert, als ich mir die Fähigkeit aneignete, fremde Türen zu öffnen. Er glaubte, dass ich auf dem besten Weg sei, ein Verbrecher zu werden. Einmal nahm er mir das Set weg, nachdem ich bei der Nachbarin die Terrassentür geöffnet hatte. Ich hatte Mitleid mit ihrer Katze, die für Stunden bei sengender Hitze in der Wohnung eingesperrt war. Ich ließ sie frei, und für ein paar Stunden waren alle in Sorge, dass sie nun für immer weg sei. Aber sie fand ihren Weg nach Hause. Das tat sie immer. Sie musste nicht im Haus eingesperrt sein. Als klar war, dass ich es gewesen war, der die Tür geöffnet hatte, kassierte ich erst eine Backpfeife, dann sprach mein Vater für Tage nicht mehr mit mir. Ein paar Wochen später holte ich mir das Etui mit den Werkzeugen wieder aus seiner Schreibtischschublade. Er hat es nicht gemerkt oder ließ mich gewähren, ich weiß es nicht. Im Job hat es mir bereits mehrfach gute Dienste geleistet. Bis auf das eine Mal. Das war in Chicago und hat mich in ziemliche Schwierigkeiten gebracht.
Im Apartment der Toten bleibe ich in der Eingangstür stehen und lasse das kleine, spärlich eingerichtete Studio, knappe zwanzig Quadratmeter, auf mich wirken. Viel ist das nicht. Gerade mal drei Schritte sind es bis zum Bett. Es fällt mir schwer, mir eine Vorstellung davon zu machen, wie es ist, hier zu leben. Unter dem Fenster steht ein kleiner Esstisch, der gleichzeitig auch als Schreibtisch genutzt wurde. Über eine alte Couch hatte Donna Myers einen gelb-grünen Überzug geworfen, wohl um alte Flecken in den Polstern zu bedecken. So lebt also eine Virenforscherin.
Ich hole das Paar Latexhandschuhe aus meiner Hosentasche, das ich aus dem Auto mitgenommen habe. Hemd und Hose kleben mir unangenehm feucht vom Regen am Körper. Ich ziehe die Handschuhe an. Normalerweise trage ich sie in solchen Fällen nicht, ich muss hier keine Fingerspuren vermeiden. Mir ist beim Anblick des Apartments aber nicht wohl. Es riecht muffig. Und wer weiß, ob sie nicht doch, aus Versehen oder mit Absicht, Viren hier hinterlassen hat. Schließlich arbeitete sie täglich damit. Keiner kann mir garantieren, dass sie immer aufgepasst hat. Man hört des Öfteren von Virenausbrüchen in Afrika oder Asien.
Wie schnell so etwas gehen kann, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Und gab es nicht Gerüchte, dass das neue Coronavirus in Wirklichkeit aus einem Labor in China stammt? Ein Laborunfall! Ich denke an Filme wie Outbreak und Contagion und wie schnell so ein Virus die Menschheit bedrohen kann. Immer sterben die Ermittler in diesen Filmen als Erstes, und immer sinnlos, bevor man das Virus identifiziert hat. Ich muss unbedingt heute noch den Gerichtsmediziner anrufen und nachfragen, was die toxikologischen Untersuchungen der Toten ergeben haben. Sicher ist sicher.
Die Wohnung liegt wie eine dunkle, bedrohliche Höhle vor mir. Ich zögere. Es hilft nichts. Ich werde das Studio betreten müssen. Unweigerlich halte ich den Atem an, aber bereits an der Kochnische muss ich tief Luft holen. Meine Kondition war auch schon mal besser. In der Spüle stapeln sich ungewaschene und zum Teil mit Essensresten verkrustete Teller. In einem Einbauschrank hängt die Kleidung der Toten, der Großteil liegt aber am Boden des Schranks. Das wird ihre Schmutzwäsche sein.
Mein Gott, das ist nicht mehr als eine Schlafstätte. Hatte sie kein Leben? Papierblätter liegen neben ihrem Bett und stapeln sich auf dem Schreibtisch. Ich nehme einige der ausgedruckten Artikel in die Hand und blättere sie durch. Das ist alles Fachchinesisch für mich: Orthomyxovirus, Picornavirus, Nef-depleted HIV, Sting-mediated viral recognition. Einige Sätze sind unterstrichen, hier und da ist ein Wort eingekringelt, oder es wurde etwas Unleserliches an den Rand geschrieben. Ich zucke mit den Schultern und schaue mich weiter um. Auffällig viele solcher Artikel liegen verstreut im Raum. Auf dem Esstisch finde ich mehrere ungeöffnete Briefe. Ich begutachte die Absender, vermutlich Rechnungen. Einen Abschiedsbrief finde ich nicht. Zwei Glasröhrchen liegen ebenfalls da. Sind da etwa Viren drin? Ich bemerke, dass ich gar nicht weiß, wie Viren eigentlich aussehen. Zwar habe ich im Fernsehen oder in der Zeitung schon Abbildungen gesehen, aber wie sie in Wirklichkeit aussehen? Sie sind doch so klein. Ich lasse die Glasröhrchen liegen.
Wo ist ihr Wohnungsschlüssel? Bei der Leiche haben wir keinen gefunden. Neben der Eingangstür hängt ein Schlüsselbrett. Aber das ist leer. Auch sonst ist hier weit und breit kein Schlüssel zu sehen.
Ich entdecke neben ihrem Bett ein Buch mit einem ledernen Einband. Ich nehme es in die Hand und fange an zu blättern. Ihr Tagebuch. Es ist zur Hälfte vollgeschrieben. Ich setze mich auf die Bettkante und beginne auf der ersten Seite zu lesen.
2. April
Ein neuer Lebensabschnitt – ein neues Buch. Heute war mein erster Arbeitstag im virologischen Institut. Ricardo hat mich am Shuttlestopp in der Stadt beim Massachusetts General Hospital abgeholt, und wir sind gemeinsam ins Institut gefahren. Er ist so ein netter, zuvorkommender Mensch. Obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben, haben wir uns gleich wieder gut verstanden. Er hat so eine warme Art – fast wie ein Teddybär. Im Institut wurde ich von einer freundlichen Assistentin begrüßt, die mich durch die langen Flure zu meinem neuen Büro führte. Es ist ein heller, aber sehr kleiner Raum mit einem großen Fenster, das den Blick auf den Innenhof freigibt, in dem künstliche Pflanzen etwas lieblos die kargen Steinwände aufhellen sollen. Mein Name steht bereits an der Tür, ein kleines Detail, das mir das Gefühl gibt, willkommen zu sein und dazuzugehören.
Der Vormittag verging mit einer Flut von Informationen, Treffen mit den Kollegen und der Einarbeitung in die neuen Aufgaben. Jeder im Institut scheint unglaublich kompetent und engagiert zu sein, was mich einerseits anspornt, andererseits aber auch ein wenig einschüchtert. Es gab viel Papierkram auszufüllen, und Ricardo druckte mir eine Reihe von Publikationen aus, von denen er meinte, dass ich sie lesen solle.
Ich muss zugeben, dass das alles noch sehr schwer zu verstehen ist. Es geht um Schaltstellen und Regulatoren in Viren, Enzyme, die an bestimmten Stellen schneiden, doch vor allem um virologische Techniken. Die Vorstellung, meinen Beitrag zu leisten, bereitet mir Sorge. Sie sind bestimmt alle viel besser als ich.
Als ich weiterblättere, fällt mir ein Foto entgegen. Es muss festgeklebt gewesen sein und hat sich nun gelöst. Darauf ist Donna Myers mit einer anderen jungen Frau zu sehen, beide stehen Arm in Arm lächelnd am Meer. Sie wirkt so unbeschwert und glücklich. Ich stecke das Bild zurück in das Buch. Was wohl in ihrem Leben vorgefallen ist, dass sie anscheinend keinen Ausweg mehr sah?
Ich blättere wieder weiter. In der Mitte des Buches fehlen ein paar herausgerissene Seiten. Davor steht an einer Stelle über die gesamte Seite in riesengroßen Lettern M9 geschrieben, mit mehreren Ausrufezeichen dahinter. Und an einer der Abrissstellen steht eine kurze Buchstabensequenz, die für mich keinen Sinn ergibt: CGACAATC. Merkwürdig!
Weiter hinten liegt noch ein Namensschild Donna Myers’ zwischen den Seiten. Es ist von einer Konferenz, Keystone Symposia.
Ich blättere zur letzten beschriebenen Seite. Ein Eintrag von gestern. Es scheint, dass Tränen die Schrift verschmiert haben. Trotzdem ist der Eintrag gut zu lesen.
7. Juni
In was für einen Strudel bin ich nur geraten? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein ganzes Leben ist ins Chaos gestürzt. Alle haben mich fallen gelassen. Dr. Ohno, Alice, aber vor allem Ricardo. Warum du? Wie kannst du nur! Warum ist dir das alles egal? Wenn du nur auf mich hören würdest. Warum hört keiner auf mich. Es ist falsch! Es ist einfach falsch!
Ich weiß keinen anderen Ausweg. Ich bin so verzweifelt. Ihr nehmt mir alles, alles, was ich habe! Meine ganze Arbeit. Mein Leben. Warum tut ihr mir das an? Warum lasst ihr mich jetzt allein? Meine Forschung ist mein Ein und Alles. Warum nehmt ihr mir das? Ich hasse euch dafür. Ich liebe die Forschung doch so sehr.
Weißt du noch, Anni, als du mir mein erstes Mikroskop geschenkt hast und wir ganz vorsichtig eine Zwiebel präpariert haben? Wir haben eine Haut der Zwiebel auf den Objektträger gelegt, mit etwas Wasser, und das Deckblättchen wieder drauf. Was für ein Wunder haben wir unter dem Mikroskop entdeckt. Hunderte filigrane Zellen. Ich konnte meine Augen nicht mehr davon lassen. Leben unter dem Mikroskop. Ich war so fasziniert. Ich habe alles mikroskopiert, was mir unter die Finger gekommen ist. Anni, meine Anni, du hast mich so glücklich gemacht. Du hast mich für die Wissenschaft begeistert. Du hast mich immer so sehr unterstützt. Mein ganzes Leben lang.
Anni, liebste Anni, es tut mir so leid. Bitte sei mir nicht böse! Ich kann und will ohne die Wissenschaft nicht leben. Kein Mensch kennt mich so gut wie du. Du hast immer verstanden, wie wichtig mir meine Arbeit ist, wie wichtig mir meine Wissenschaft ist. Du hast mich immer ermutigt, weiterzumachen und dranzubleiben. Alles um mich ist zusammengebrochen. Alles ist weg. Alles! Ich will …
Die Zeilen brechen ab. Mein Atem stockt. Die letzten Worte klingen so verzweifelt, so tieftraurig. Donna schien ihren Beruf zu lieben. Sie gab alles für ihn und musste am Ende doch aufgeben. Die Zeilen klingen wie ein Abschiedsbrief – und dennoch: eine junge Frau, die wegen ihres Berufs so verzweifelt war, dass sie sich das Leben nahm? Ich frage mich, wer Anni ist. Und wer Ricardo und Alice. Seltsam auch, dass sie ihren Eintrag nicht beendet hat. Einen Abschiedsbrief, eine Erklärung schreibt man doch zu Ende – und nicht als Eintrag im Tagebuch. Warum hat sie das nicht getan? Wurde sie durch etwas gestört?
Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger ergibt es einen Sinn. Sie hat sich doch nicht wirklich wegen ihres Berufes umgebracht?
Ich erhebe mich vom Bett. Mittlerweile ist es 7:13 Uhr, und das virologische Institut ist nicht weit von hier. Bald werden die ersten Mitarbeiter kommen. Eine gute Gelegenheit, Donna Myers’ Umfeld zu befragen. Vielleicht treffe ich ja jemanden, der sie kennt und mir etwas Aufschluss über Donna geben kann. Was ist bei ihr nur passiert? Erst wenn ich das weiß, werde ich diesen Fall abschließen können. Als ich die Tür wenig später hinter mir zuziehe, habe ich das Tagebuch bei mir.
Kapitel 2 – Morgenkaffee
Vince
Auf meinem Handy in der Google Maps App suche ich nach Cafés in der Umgebung des virologischen Instituts und finde einen Dunkin’ Donuts, der nur einen Block entfernt liegt und bereits seit 5 Uhr geöffnet hat. Eigentlich bin ich ein Genussmensch, aber ich mag den dünnen Filterkaffee, den sie dort servieren. Manchmal trinke ich auch einen Espresso, und auch sonst habe ich allerlei Zubereitungsarten probiert: Frappuccino, Mocca, Flat White oder diesen Kaffee, der in einem modernen Verfahren über Vakuumfiltration gekocht wird. Meine Erfahrung war aber immer die gleiche: War der Kaffee zu stark, war mein Stuhlgang flüssig. So ein Durchfall kann gerade im Dienst ziemlich unangenehm werden. Die leichte Plörre von Dunkin’ Donuts hingegen vertrage ich gut und trinke sie gerne bis in den Nachmittag. Am besten verdünnt mit etwas fettarmer Milch. Erst zum Abend wechsle ich dann zu Wasser oder wahlweise Bier oder Wein.
Mein Magen beginnt zu knurren. Ich habe noch nicht gefrühstückt und gönne mir zwei Boston Cream Donuts. Vorne am Tresen direkt am Fenster ist noch ein Platz frei, von dort aus kann ich die Kommenden und Gehenden gut beobachten.
Nach einer Weile greife ich nach einer aktuellen Tageszeitung, die jemand liegen gelassen hat, und schlage die Wirtschaftsseite auf. Wirtschaft hat mich schon immer fasziniert. Wäre ich nicht Polizist geworden, dann hätte ich bestimmt irgendetwas mit Wirtschaft gemacht. Vielleicht sogar studiert. Rekordgewinne für BioNexus, steht da. Ich seufze. Seit Jahren beobachte ich die Aktienmärkte. Es ist wie ein Spiel. Es scheint so leicht zu sein, vorherzusagen, wie sich die Kurse entwickeln, und trotzdem traue ich mich nicht zu investieren. Von BioNexus hatte ich vor Monaten gelesen. Ich hatte sogar kurz überlegt, von meinem Ersparten ein paar Aktien zu kaufen, habe es dann aber nicht gemacht. Ich hatte zu viel Sorge, alles zu verlieren. Hätte ich mal … Ein bisschen ärgere ich mich schon. Darum bin ich eben kein Wirtschaftsboss, sondern Polizist – mir fehlt der Mumm, mit Geld zu spekulieren. Gar nicht zu reden von der ganzen Verantwortung für die Mitarbeiter in den Banken und Konzernen, geschweige denn die Aktienanleger. Es wäre ja nicht nur das eigene Risiko, mit dem ich spielen würde, sondern das von so vielen, die davon abhingen.
Ich lege die Zeitung beiseite und hole mein Notizbuch aus der Jackentasche. Ich habe bereits einige Stichpunkte, die ich mir für meinen Fallbericht notieren will, bevor ich sie vergesse.
Das Café füllt sich nach und nach mit Gästen. Da sind die frühmorgendlichen Jogger, die für ihre Dusche nach dem Lauf noch den besonderen Koffeinkick brauchen. Die Väter und Mütter, die ihre Kinder zur Schule bringen und für die vielen lästigen Fragen auf der Autofahrt einen Kaffee in Übergröße benötigen. Makler, Hafenarbeiter und Büroangestellte, ein Polizist und zwei Sanitäter. Sie kommen für ihre Aufwachdroge, ihren Muntermacher, ihren Energieschub, um zur Arbeit zu gehen. Ich mag es, den Menschen bei ihrer Tätigkeit zuzuschauen und mir ihr Leben vorzustellen. Ob sie allein leben oder einen Partner, Haustiere oder ein ungewöhnliches Hobby haben. Vielleicht kommt das mit meinem Beruf, aber die Frau, die gerade nach ihrem Skinny Latte greift, hat bestimmt eine Katze. Diese langen, parallelen Kratzer am Arm müssen von einer Katze stammen.
Dann betritt ein junger blonder Mann in Jeans mit einer einfachen Ledertasche über der Schulter das Café. Wenn das kein Wissenschaftler ist. Bingo!
„Das Übliche, Frank?“, fragt die Barista.
Frank lächelt sie mit einem zustimmenden Nicken an. „Sehr gerne, Dani.“
„Was machen die Viren? Seit Corona ist ja nicht mehr viel los, und der letzte Winter war auch recht mild. Kaum einer war krank oder hat gehustet. Da müsst ihr euch das nächste Mal etwas Besseres ausdenken“, neckt sie ihn mit ihrer lauten Stimme.
Der junge Mann scheint den Witz nicht verstanden zu haben, denn ich sehe ihm seine Empörung deutlich an.
Die Barista fragt nach: „Was macht die nächste Pandemie? Seid ihr bald so weit?“
Sie lacht schallend, und für einen Moment zucken die anderen Gäste zusammen. Als wäre ein Alarm losgegangen, der sie vor einer Gefahr warnen würde.
„Wir arbeiten doch an nichts Gefährlichem“, erwidert Frank etwas konsterniert und lächelt dann, als ob man sich nun wirklich keine Sorgen machen müsste. Er zieht ein paar verkrumpelte Dollarscheine aus seiner Hosentasche und gibt an der Bar noch einen guten Schuss Milch in seinen Becher.
Mit einem Winken verabschiedet er sich von der Barista, die ihm zuzwinkert. „Bis morgen, Frank!“
Er dreht sich zur Tür. Vielleicht sollte ich mit ihm sprechen? Mit etwas Glück kennt er Donna Myers. Ich springe von meinem Barhocker auf und stelle mich ihm in den Weg.
„Haben Sie eine Minute?“, frage ich.
Er schaut mich verwirrt an.
„Mein Name ist Vince Brickle. Ich arbeite für das Boston Police Department.“ Ich halte ihm meine Dienstmarke entgegen, die er nur flüchtig betrachtet. Er wirkt angespannt.
„Keine Sorge, Frank … Darf ich Frank sagen?“, frage ich und mache eine einladende Geste Richtung Tresen. „Setzen wir uns.“
Ich lasse mich auf meinem alten Platz nieder, aber Frank bleibt an den Tresen gelehnt stehen.
„Darf ich Du sagen?“, frage ich. Als er nickt, fahre ich fort: „Nenn mich Vince. Also, ich habe gehört, dass du im virologischen Institut arbeitest?“
„Ja, das ist richtig. Warum fragst du?“, erwidert Frank mit misstrauischer Stimme und fährt sich mit der Hand durch sein Stirnhaar.
„Kennst du eine Wissenschaftlerin namens Donna Myers?“
„Ja, ich kenne Donna sogar sehr gut.“
Er schaut mich prüfend an und setzt hinzu: „Darf ich noch mal nachhaken, wieso du das alles fragst?“
Ich blicke ihn mit ernster Miene an und fordere ihn mit meinen Augen nochmals auf, doch endlich Platz zu nehmen. Erst als er sich widerwillig hingesetzt hat, fahre ich fort.
„Donna Myers wurde heute in den frühen Morgenstunden vor dem Green Building tot aufgefunden. Wir gehen davon aus, dass sie sich vom Gebäude gestürzt hat.“
Franks Gesicht wird kalkweiß. Er holt tief Luft, dann ohne Ausatmen ein zweites Mal. Tränen schießen in seine Augen. „Was? O Gott! Das kann nicht sein …“ Seine Stimme bricht. Dann schluckt er schwer und wischt sich die Tränen von den Wangen.
Ich warte einen Moment. Der Schock sitzt tief bei ihm. Das ist deutlich zu sehen.
Nach einer Weile frage ich ihn: „Frank, kannst du mir mehr über Donna Myers erzählen? Ich habe ihr Tagebuch gefunden, aber ich werde nicht ganz schlau daraus. Warum sollte sie sich umbringen?“
„Ich, ich weiß es nicht.“ Frank schüttelt zögerlich den Kopf. „Ich weiß es nicht.“ Sein Blick geht ins Leere.
Eine befriedigende Antwort zu bekommen scheint schwerer zu sein, als ich dachte. „Fangen wir mit den Fakten an“, sage ich und hole wieder mein Notizbuch aus der Hosentasche hervor.
„Du heißt?“
„Frank Munters.“
„Und du arbeitest im virologischen Institut?“
„Ja. Ich bin dort als Postdoc angestellt.“
„Ah, du hast also den gleichen Beruf wie Donna Myers. Was ist denn ein Postdoc?“ Das war wohl eine dumme Frage, so wie Frank mich anschaut.
„Ein Postdoc oder Postdoktorand ist ein Wissenschaftler.“
„Ah, verstehe, also eine Art Professor.“
„Nein, nein“, erwidert Frank genervt und wischt sich mit dem Handrücken neue Tränen aus den Augen. „Ein Postdoktorand ist der Karriereschritt nach dem Doktor und vor dem Professor. Jeder Postdoc arbeitet an etwas anderem. Er ist kein Student in der Ausbildung mehr, aber irgendwie auch noch kein eigenständiger Wissenschaftler. Ein Postdoc halt.“
Ich habe das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. „Ich habe in meiner Arbeit nicht häufig mit Wissenschaftlern zu tun“, erkläre ich entschuldigend. „Ein Postdoc ist also weder Professor noch Doktorand. Nicht Fisch, nicht Fleisch, oder? Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig.“
Meine einzige Berührung mit der Wissenschaft erfolgte in der Schulzeit, und dort hatte ich Biologie, Chemie und Physik gehasst. Ich bekam in diesen Fächern auch meine schlechtesten Noten. Für meinen Bericht brauche ich das sicherlich nicht, und ich muss mich jetzt nicht weiter blamieren.
Aber Frank beginnt bereits auszuholen: „Die Position wurde in den Sechzigerjahren aus der Not heraus erfunden. Das Problem war damals – und ist es heute immer noch –, dass mehr Studenten ihren Abschluss machen, als an der Universität Professorenstellen verfügbar sind. Also hat man kurzerhand eine Zwischenstufe auf dem Weg zum Hochschullehrer eingeführt. Du arbeitest genauso hart wie ein Doktorand und wirst genauso schlecht bezahlt. Und auch wenn keine besondere zusätzliche Ausbildung daran geknüpft ist, so ist es doch eine Phase der Berufsausbildung, in der man sich noch mal beweisen muss. Du bist also jemand, der Professor werden will, den man aber einfach noch ein bisschen länger hinhalten kann.“
„Das klingt fast wie modernes Sklaventum“, sage ich mit einem Lachen.
Bei meinem Gegenüber kommt das gar nicht gut an. Frank schaut mich ernst an. Um dieser peinlichen Situation zu entkommen, lenke ich ab: „Wie kommt man denn dazu, in die Wissenschaft zu gehen und an Viren zu forschen?“
Jetzt scheine ich positiv einen Nerv getroffen zu haben, denn stolz erklärt Frank: „Wissenschaft fasziniert mich. Man muss für das Thema brennen. Virologe ist mehr eine Berufung als ein Beruf. Es ist eine wunderschöne Tätigkeit … eigentlich.“ Dann hört er auf zu sprechen.
„Warum eigentlich?“, frage ich in der Hoffnung, mehr zu verstehen.
Aber Frank winkt ab. „Ich muss immer an Donna denken. Wie schrecklich … Nein, es ist ein wunderschöner Beruf. Durch die Wissenschaft können wir unsere Welt verbessern und uns eine bessere Zukunft bauen. Wissenschaft befördert Kreativität und Neugier und schafft Wissen! Was gibt es Schöneres!“
Das ist nicht die ganze Antwort: Irgendetwas will Frank mir nicht erzählen. Sicherlich, jeder Beruf hat Schattenseiten. Aber meine Intuition sagt mir, dass die Probleme bei Frank größer sind und damit möglicherweise die gleichen Probleme wie bei Donna. Vielleicht kann ich ihm später mehr entlocken?
Um sein Vertrauen zu gewinnen, frage ich weiter Belangloses: „Was genau fasziniert dich an Viren?“
„Ich fand sie schon immer faszinierend. So einfach, aber doch so komplex. So klein und doch so tödlich. Viren sind in uns und um uns herum. Allein auf einer Hand haben wir mehrere Millionen Viren und bemerken es gar nicht.“
Unweigerlich betrachte ich meine Hände. Millionen Viren? Das ist nicht nur unglaublich, sondern ganz schön ekelig.
Es ist mir unbegreiflich, wie man sich mit solchen Viechern beschäftigen kann. Viren, Bakterien, Parasiten und das ganze Kleingetier. Mich schüttelt es beim Gedanken an Eiter. Ich habe einmal ein Video auf YouTube gesehen, wo jemand sich einen großen Pickel ausgequetscht hat. Mir ist übel geworden. Das Schlimmste aber ist, dass ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriege. Franks Augen hingegen funkeln, wenn er von Viren erzählt.
„Tut mir leid. Ich finde diesen ganzen Eiter widerlich.“
„Das siehst du falsch. Viren verursachen nur selten Eiter.“
Ich schaue ihn verblüfft an.
„Viren sind so vielfältig. Sie können hilfreich sein oder krank machen. Leben verbessern oder beenden. Sie zu verstehen, sie zu besiegen, sie zu manipulieren … Nur wer mit ihnen arbeitet, versteht die Faszination, die sie ausüben.“
„Und Donna? War sie auch so begeistert von Viren?“
„Donna hat gebrannt für ihre Arbeit. Sie ist völlig darin aufgegangen, hat Tage und Nächte durchgearbeitet. Sie war schlau, erfolgreich und richtig gut. Sie war kurz vor einem Durchbruch.“
„Einem Durchbruch?“ In ihrem Tagebuch klang es ganz anders. „Was für ein Durchbruch?“
„Ihre Versuche funktionierten. Das war ein großer Erfolg für sie. Alles war auf einem guten Weg.“
Was Frank erzählt, passt wirklich nicht zu ihrem Tagebucheintrag. Daher frage ich: „Hatte Donna ein Alkoholproblem?“
Erstaunt schüttelt Frank den Kopf. „Warum fragst du? Donna? Ganz sicher nicht.“
„Wir haben eine leere Flasche Wein am Tatort gefunden.“
„Sie hat selten was getrunken. Wenn überhaupt, dann höchstens ein Glas. Ein Alkoholproblem hatte sie bestimmt nicht.“
Ich grüble. Nach einer Weile sage ich: „Wir vermuten, dass Donna sich wegen ihres Jobs umgebracht haben könnte. Weil es nicht gut lief. Wie passt das mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast?“
Frank schweigt und seufzt dann. „Sie war gut. Sie war talentiert. Ihr wurde aber auch übel mitgespielt. So habe ich das empfunden. Vielleicht war ihr nicht bewusst, dass sie kurz davor war, erfolgreich zu sein.“
„Was meinst du damit?“
„Sie hatte spannende Daten. Sie hatte einen Weg gefunden, Viren ein- und wieder auszuschalten.“
„Moment, das geht mir zu schnell. Bitte was hat sie?“, frage ich ungläubig.
„Die Details sind doch nicht wichtig. Viel wichtiger ist es, dass Donna sehr erfolgreich war, bis …“ Frank bricht ab und senkt den Kopf. „Ich verstehe einfach nicht, warum sie sich umgebracht haben soll.“
„Du meinst, dass Donna nicht unglücklich war? Nicht depressiv? Keinen Suizid begehen wollte?“
Frank hebt den Blick. Ich kann an seinen Gesichtszügen sehen, wie ihm die Tragweite dieser Sätze bewusst wird.
„Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat sie sich umgebracht. Die letzten Wochen, sogar Monate, waren hart für sie. Vielleicht wollte ich es nicht wahrhaben, wie schlecht es ihr ging. Sie kroch auf dem Zahnfleisch“, sagt er gedankenversunken und fragt dann: „Was steht denn im Tagebuch?“
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Frank den Inhalt erzählen sollte. Ich habe selbst erst wenige Seiten gelesen und mehr Fragen als Antworten.
„Das kann ich dir im Moment noch nicht sagen“, entgegne ich schließlich. „Ich würde den Fall gerne bald abschließen, aber ich verstehe Donnas Motive für einen möglichen Suizid bisher nicht. Aus ihrem Tagebuch werde ich nicht schlau, aber wenn ich jetzt davon erzähle, wird es deine Sicht der Dinge beeinflussen. Vielleicht geht daraufhin ein wichtiges Detail verloren. Daher bitte ich dich um Verständnis.“
Frank nickt. „Natürlich. Aber ich möchte helfen. Was kann ich tun?“
„Du sagst, Donna war erfolgreich. Sie stand vor einem Durchbruch, und ihre Arbeit war ihr Ein und Alles. Und dann sagt du, sie ging auf dem Zahnfleisch. Da passt für mich etwas nicht zusammen. Warum also könnte sie in einer so ausweglosen Situation gewesen sein?“
Frank schaut auf die große Uhr hinter dem Tresen. Ich tue es ihm gleich. Es ist 8:12 Uhr. Frank scheint kurz zu überlegen, dann sagt er: „In Ordnung.“